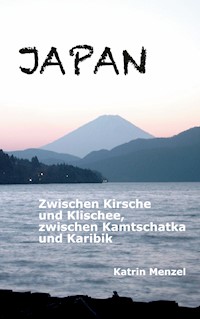
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Japan, das sind Klischees wie die berühmte Kirschblüte, Erdbeben, Sushi, High-Tech und höfliche, aber auch verrückte Menschen. Aber Karibik? Und wo liegt überhaupt Kamtschatka? Sind alle Japaner verrückt? Und sind WIR Deutschen DEN Japanern vielleicht sogar ein wenig ähnlich? Blickt man hinter die Kulissen des ersten Scheins, der einem als Ausländer bisweilen seltsam und fremd vorkommt, ist man überrascht, wie viel mehr Farben als nur die rosa Kirschblüte Japan ausmachen. Manches, das einem am Anfang typisch japanisch vorkommt, wirkt bei genauerem Hinsehen plötzlich gar nicht mehr so exotisch - erst recht wenn man um die enge, historische Verbundenheit zwischen Japan und dem Westen, und damit auch Deutschland, weiß. Aber manches ist und bleibt selbst nach mehreren Jahren im Land der aufgehenden Sonne ein Rätsel. So erging es Katrin Menzel, die in diesem Buch ihre persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse aus vier Jahren Japan mit den Leserinnen und Lesern teilt, angereichert mit vielen Hintergrundinformationen über dieses faszinierende Land und seine Leute. Dabei dürfen Einblicke in das Leben mit heißen Quellen, die dabei helfen, die Straßen im Winter schneefrei zu halten, und schwarzes Essen nicht fehlen. Dazu gehören aber auch eine Wetteransage mittels dezenter Hintergrundmusik und die Rücksichtnahme durch perfektes Styling sowie eine zu lange Toilettenschlange. Und auch Love-Hotel-Abenteuer sowie der Schock eines mittelalterlichen Japaners über die Scheidungsankündigung seiner Frau kommen nicht zu kurz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Wie alles anfing
Kulturschock Japan?
Leben auf einem bunten Pulverfass
Deutsches Bier mit schwarzem Knoblaucheis
Shoppen wie Gott im High-Tech-Paradies
Dauerwelle für den rücksichtsvollen Nagel
Grenzenlose Hilfsbereitschaft wie überall
Japan ändo ze resuto ofu ze wörudo
Typisch Mann!
Liebe führt zu Ehe führt zu Sex?
Hotaru no Hikari
Nachwort und Dank
Weiterführende Webseiten
1. Wie alles anfing
Es war ein kalter, grauer Tag Anfang November 2002. Ich war kurz zuvor von einem zweimonatigen Praktikum in Montréal, dieser quirligen und internationalen Metropole am Sankt-Lorenz-Strom, nach Deutschland zurückgekehrt. Das Semester hatte wieder begonnen. Ich saß in meinem zwölfeinhalb Quadratmeter großen Zimmer im Studentenwohnheim und bereitete mich auf ein Seminar in englischer Linguistik vor. Das Telefon klingelte. „Hallo Katrin.“ Es war mein Freund. „Ich hab‘ den Job in Tokio!“
Tausende Gedanken schossen mir durch den Kopf. Was bedeutete das? Drei Jahre Distanzbeziehung, obwohl wir noch gar nicht so lange zusammen waren. Würden wir das überstehen? Vermutlich nicht. Und selbst wenn doch, hatte ich nicht sonderlich viel Lust darauf. Doch Mitkommen war einfach keine Option für mich. Zwar wäre dies visatechnisch durchaus möglich gewesen, aber ich war ja noch nicht einmal zur Hälfte durch mit meinem Studium. Was also tun?
So gingen einige Tage in getrübter Stimmung ins Land. Bis ich entschied: „Ich komme trotzdem mit!“ Ich wollte meinen Freund nicht ziehen lassen und mich dann immer fragen, ob er der Mann meines Lebens gewesen wäre. Und hey, was hatte ich zu verlieren? Im schlimmsten Fall würde ich mein Studium in Deutschland zwei bis drei Jahre später abschließen, wäre dafür aber um viele wertvolle Erfahrungen reicher und hätte eine völlig andere Kultur kennengelernt. So eine Chance, ein so anderes Land kennenzulernen, durfte ich mir nicht entgehen lassen.
Bis zu diesem Zeitpunkt war Japan für mich ein Land irgendwo weit weg im Osten Asiens, von dem ich keine genaueren Vorstellungen hatte. Ich interessierte mich noch nicht einmal besonders für das damals immer bekannter und beliebter werdende asiatische Essen. Die wenigen Erfahrungen, die ich mit asiatischem Essen gemacht hatte und die sich im Wesentlichen auf deutschchinesische Tiefkühl-Gerichte beschränkten, hatten mich nicht gerade begeistert.
Und auch mein erstes Erlebnis mit japanischem Essen, genauer gesagt, Sushi, während meines Praktikums in Montréal war von zweifelhaftem Vergnügen. Ich wusste, dass mein Freund mit seinem Arbeitgeber über einen potenziellen Job in Japan sprach. Daher nahm ich alles Japanische um mich herum besonders bewusst wahr. Als dann auf einem Empfang bei ARTE ein Kellner mit einem Tablett Sushi an mir vorbeilief, ergriff ich die Gelegenheit, endlich die vielgerühmte Spezialität zu probieren. Ich nahm eine der Rollen und tunkte sie in den grünen Dip, den der Kellner ebenfalls auf seinem Tablett trug, und ab in den Mund. Puh! Was war denn das? Kurzzeitig hatte ich das Gefühl, meine Augen würden herausquellen und meine Nase bersten. Glücklicherweise verschwand die Schärfe wieder genauso schnell, wie sie sich entfaltet hatte. Im Nachhinein klärte mich mein Chef auf, dass es sich um Wasabi (japanischen, grünen Meerrettich) gehandelt hatte.
Auf meine Entscheidung hin, nach Japan mitzugehen, folgte bald ein Training zur Sensibilisierung für das Leben in der fremden Kultur. Dieses wurde von der Firma meines Freundes für die angehenden Expatriates, kurz „Expats“ (hier allgemein für Menschen, die im Ausland leben) und deren Partner durchgeführt. Eine Übung dort hinterließ einen besonders nachhaltigen Eindruck bei mir. Der Trainer spielte mit seiner Assistentin folgende Situation nach: Er, zu Gast in einem fremden Land, besuchte einen einheimischen Kollegen zu Hause. Als er ankam, wies ihn die Ehefrau an, sich auf einen Stuhl zu setzen. Sie kniete sich barfuß vor ihm auf den Boden, verbeugte sich tief, wobei sie mit ihrer Stirn den Boden berührte, und blieb dann auf ihren Knien sitzen. Sogleich regte sich in mir feministischer Widerstand. „Typisch Mann!“, dachte ich. „Lässt die Frau vor sich auf dem Boden knien, während er wie ein Pascha auf dem Thron sitzt.“ Und schon war ich in die Falle getappt; denn der Trainer erklärte die Szene folgendermaßen: „In dem Land, in dem die Szene spielt, werden Frauen im Gegensatz zu Männern als reine Wesen angesehen und haben infolgedessen die alleinige Erlaubnis, in direktem Kontakt mit dem heiligen Boden, der Mutter Erde, zu stehen.“ Die Ehefrau des Kollegen nahm eine Vermittlerrolle zwischen Mutter Erde und dem männlichen Besucher ein, dem es nicht gestattet war, Schuhe und Socken auszuziehen und damit den Boden zu berühren.
Wie schnell ich geurteilt und mir angemaßt hatte zu glauben, den Hintergrund für das Gesehene verstanden zu haben! Gerade in einer so fremden und mir noch unbekannten Kultur, wie Japan sie für mich darstellte, würde es also sehr hilfreich sein, offen zu bleiben und keine voreiligen Schlüsse zu ziehen – und gegebenenfalls lieber einmal zu oft als zu selten zu versuchen, hinter die Kulissen zu blicken.
Mitte Februar flog ich dann zum ersten Mal nach Tokio. Nachdem ich am Flughafen Frankfurt zunächst bei der freundlichen, japanischen Stewardess eingecheckt hatte, folgte die Handgepäcks-Kontrolle. „Was haben Sie denn da?“, fragte der Zollbeamte, der auf dem Computerbildschirm die Innereien meines Rucksacks in Augenschein genommen hatte. „Ähm…“ „Ist das ein Wurstring?“ „Äh, ja,“ stammelte ich verlegen. „Soso, was denn für eine Sorte Wurst?“ „Ähm, Blutwurst.“ „Wo fliegen Sie denn hin?“ „Nach Japan.“ „Meinen Sie, die Japaner lassen Sie damit rein? Die lassen Sie mal besser hier.“ Er warf seinen Kollegen einen vielsagenden Blick zu und fing an, mit ihnen auszuhandeln, wer die Wurst bekommen würde. Langsam kam ich ins Schwitzen. Nach kurzer Diskussion gaben sie jedoch Entwarnung. Ich durfte die Wurst behalten und passieren. Glück gehabt!
Schnell kaufte ich noch ein bisschen Schokolade im Duty-Free Shop und ging dann zum Gate, wo zahlreiche Japaner auf das Boarding des Japan Airlines Fluges warteten. Als blondierte Westlerin fiel ich dort geradezu auf. Alle meine Sinne erwachten und schalteten auf Empfang. Fremde Laute drangen an mein Ohr und sofort umfing mich ein irgendwie andersartiger Geruch. Vielleicht ein Reinigungsmittel, Parfum oder spezielle Essensgerüche? Schon jetzt fühlte ich mich von einer fremden und geheimnisvollen Welt umgeben.
Und endlich ging es ins Flugzeug mit seiner hauptsächlich japanischen Besatzung und damit tiefer ins Abenteuer hinein. Ich hatte das Privileg, Business Class zu fliegen, und kam so unter anderem in den Genuss eines exquisiten Menüs. Dabei hatte ich die Wahl zwischen einem verlockend lecker und vertraut klingenden, europäischen und einem für meinen ungeübten Gaumen interessant bis experimentell klingenden, japanischen Abendessen. Ich entschied mich für das Letztere, war ich doch gespannt, was die japanische Küche zu bieten hatte. Das Menü beinhaltete neben Quallengelee auch Meeresschnecke. Als die Stewardess das Essen servierte, fragte sie mich, ob ich schon einmal Meeresschnecke gegessen hätte und ob ich wüsste, wie man sie am besten zu sich nimmt. Beides verneinte ich, die bis dato noch nicht einmal französische Weinbergschnecken probiert hatte. Sie erklärte mir daraufhin, dass man die Schnecke zuerst aus dem Gehäuse ziehen und sie dann mit sehr viel Salz bestreuen müsse. Ansonsten würde sie sehr bitter schmecken. Dann teilte sie mir noch mit, dass sie, die Japanerin, diese Kostbarkeit noch nie genossen hätte, und ließ mich mit einem etwas mitleidigen Blick und meiner Meeresschnecke allein. Kaum war sie weg, wagte ich den Biss ins Schneckenfleisch. Vor lauter Salz musste ich husten. Darunter schmeckte, wie vorhergesagt, das ziemlich bittere Fleisch der Schnecke hervor. Vor dem nächsten Gang kam die Stewardess wieder bei mir vorbei und fragte mit einem verschmitzten Lächeln „Na, wie war’s?“ Na ja…
Immerhin war ich eine Erfahrung und ein Stück Nippes reicher. Bis heute dient mir das Gehäuse der Meeresschnecke in meinem Bücherregal als Beweisstück meines Heldenmuts.
Abbildung 1: Gehäuse der Meeresschnecke (KM)
Nach elf, langen Flugstunden war es schließlich so weit. Das Flugzeug landete in Narita, wo einer der beiden großen Flughäfen in der Nähe von Tokio liegt. Mit dem Shuttle fuhr ich in das nächste Terminal. Und siehe da, es schneite! Und das, obwohl Tokio ungefähr auf der geographischen Breite von Algier und Teheran liegt! Nachdem ich noch etwa 60 Minuten an der Passkontrolle für Ausländer angestanden hatte, halb im Delirium aufgrund des Schlafmangels, wartete mein Gepäck bereits auf mich. Hoffentlich ging nun trotz der Wurst bei der Zollkontrolle alles gut. Der japanische Beamte warf einen kurzen Blick in meinen Pass und fragte in gebrochenem Englisch, was ich in Japan machen würde. „Visit my boyfriend.“ Und schon winkte er mich durch. Glück gehabt! Ich hatte den Eindruck, dass er an einer eingehenderen Untersuchung nicht interessiert war, zumal er sich mit Englisch nicht besonders wohlzufühlen schien. Endlich war ich in Japan!
Zur Feier des Tages war mein Partner, der zu diesem Zeitpunkt noch kein eigenes Auto hatte, zusammen mit einer Firmenlimousine samt Chauffeur zum Flughafen gekommen, um mich abzuholen. Im Wagen erwarteten mich weiße Häkeldeckchen über den Kopfstützen und Rückenlehnen, wie sie auch in vielen japanischen Taxis zu finden sind. Mit seinen weißen Stoffhandschuhen hievte der freundlich lächelnde Fahrer mein Gepäck in den Koffer.
Und schon ging es auf der linken Seite der mautpflichtigen Autobahn los, dem circa 70 Kilometer entfernten Tokio entgegen. Inmitten flacher Reisfelder lagen pittoresk verstreute Hügel, die mit Bambuswäldchen bewachsen waren und nun einen leichten, weißen Flaum trugen - wie Felsen im Meer. Dazwischen vereinzelte, alte Holzbauernhäuser mit blauen Ziegeldächern. Wir passierten eine Mautstelle, an der der Ticketautomat irgendetwas auf Japanisch babbelte und ein Ticket ausspuckte. Überall waren fremde Schriftzeichen zu sehen.
Und dann waren sie da, die Ausläufer der Metropolregion Tokio, die circa 38 Millionen Einwohner umfasst. Nach und nach wurde die Bebauung immer dichter und die mautpflichtige Autobahn wurde zur Hochstraße, unter der eine mautfreie Straße mit vielen Kreuzungen und Ampeln entlangführte. Vorbei ging es an Industriegebieten, einer Skihalle und Wohnblocks, unterbrochen durch Siedlungen von eng nebeneinander gebauten, kleinen Einfamilienhäusern mit Gärtchen sowie Baseballfeldern an einem der diversen Kanäle, die sich ihren Weg in die Bucht von Tokio bahnen. Aus der Ferne grüßte der Vulkan, der in Tokyo DisneySea® jeden Tag mehrmals brav seinen Dienst verrichtet, mit Rauchzeichen. Und auch der Verkehr wurde immer dichter und kam schließlich auf der Rainbowbridge, mit Blick auf die Skyline von Tokio, vollends zum Erliegen. Der erste Stau.
Was war das? Die Brücke bebte leicht. War dies mein erstes Erdbeben? Auf einer Brücke über der Bucht von Tokio? Na bravo! Einen viel besseren Ort für ein Erdbeben konnte man sich ja kaum aussuchen! Glücklicherweise stellte sich jedoch schnell heraus, dass es nur die schweren Lastwagen waren, die sich auf der Gegenfahrbahn ihren Weg aus der Stadt bahnten und mit ihrem Gewicht bei jedem Holpern die Straße ein wenig erzittern ließen.
Langsam wurde es dunkel und die ersten Lichter gingen an. Von weitem konnte ich die Spitze des rot-weiß-gestreiften, erleuchteten Tokyo Towers sehen, der, aus dieser Perspektive betrachtet, zwischen den umliegenden Hochhäusern und Wolkenkratzern beinahe ein wenig unterging.
Und mit der Zeit machte sich zunehmend die Flüssigkeit bemerkbar, die ich während des Fluges zu mir genommen hatte. Aber es war kein Ende des Staus oder eine Abfahrt in Sicht. Gab es hier in der Stadt an der Hochstraße überhaupt irgendwo Rastplätze mit Toiletten? Und wie sie wohl aussahen? Öffentliche Toiletten in einer Millionenstadt? Egal, es musste einfach sein. Also fuhren wir von der nächsten Ausfahrt ab. Der erste persönliche Kontakt mit Tokio! Mein Partner hatte mir eine 500-Yen-Münze (abhängig vom Wechselkurs ungefähr vier Euro) mitgegeben, für den Fall dass die Benutzung etwas kostete. Doch dies wäre nicht nötig gewesen. Weder Toilettenfrau noch Tellerchen standen da. Und auch Toilettenpapier, das man insbesondere in ländlicheren Gegenden Japans manchmal, in kleine Portionen verpackt, vorab an einem Automaten kaufen muss, war vorhanden. Allerdings war das Papier sehr dünn und gleichzeitig trotzdem irgendwie hart. Und was war das? War die Toilette verstopft? Das Wasser stand in der Schüssel. Ein Blick in die anderen Zellen zeigte mir jedoch, dass dies in Japan wohl grundsätzlich so gehandhabt wurde.
Nach verrichtetem Geschäft wollte ich mir schnell die Hände waschen. Ich machte diese nass und nahm etwas Seife. Und dann nichts wie zurück zum Auto. Doch was war das? Als ich die Hände abspülen wollte, spritzte mich ein voller Strahl aus dem Wasserhahn nass. Vom Schlafentzug komplett vernebelt, hatte ich nicht bemerkt, dass ich den Hahn zuvor völlig unbewusst genau in die entgegengesetzte Richtung, wie ich es aus Deutschland gewohnt war, bewegt hatte.
Nachdem diese Erkenntnis schließlich in mein Kleinhirn vorgedrungen war und ich es geschafft hatte, den Wasserhahn wieder zu schließen, setzten wir die Fahrt in unser Zuhause im Tokioter Stadtviertel Shirokanedai fort. An der Wohnung angekommen, schloss mein Partner die Tür auf – und drehte dabei den Schlüssel zum Türrahmen hin, also wieder genau in die entgegengesetzte Richtung wie ich dies aus Deutschland kannte.
In der Wohnung ließ er mir ein heißes Bad mit Hilfe der vollautomatischen Steuerungselektronik der Badewanne ein, über die man nicht nur die gewünschte Wassertemperatur, sondern auch den Füllstand der Badewanne eingeben konnte. Damit aber nicht genug: als die Wanne bereit war, piepste sie auch noch freundlich. Abgefahren! Ich kam mir vor wie Alice im Wunderland, ein Mädchen, das aus einer schwäbischen Kleinstadt stammte und nun mitten in dieser hochtechnisierten Metropole am östlichsten Zipfel Asiens gelandet war.
Abbildung 2: Bedien-Panel für die Befüllung der Badewanne (KM)
Ich warf einen letzten Blick aus dem zur Sicherheit bei Erdbeben von einem dünnen Drahtgeflecht durchzogenen Fenster. Überall waren wirr und offen herumhängende Stromleitungen über der Straße zu sehen und an den Gebäuden gegenüber fielen mir die vielen kleinen Kacheln auf, mit denen so viele Häuserfronten in Japan eingefasst sind. Mit dem Geräusch japanischer Krankenwagensirenen und getunter Motorräder im Hintergrund schlief ich wohlig müde von der langen Reise, den ersten Eindrücken und dem warmen Bad, ein - bis mich am nächsten Morgen die „Schreie“ eines traditionellen Nō-Theaterstücks aus dem Radiowecker in die Realität zurückholten.
Nihon e yōkoso! Willkommen in Japan!
2. Kulturschock Japan?
„Wow, Du hast in Japan gelebt? War das nicht ein Kulturschock für Dich?“ So oder so ähnlich werde ich immer wieder gefragt.
Ich würde sagen: „Ja und nein.“ Natürlich ist in Japan vieles fremd und anders als in Deutschland. Dies fängt bei Kleinigkeiten an, was selbstverständlich noch keinen Kulturschock auslöst. So „kochen“ japanische Waschmaschinen zwar auch nur mit Wasser, allerdings in der Regel mit kaltem. In so mancher japanischen Kneipe befindet sich Pfeffer im Gewürzstreuer für Salz und anderssherum. Und den typisch japanischen Zucker kann man gleich gar nicht aus einem Streuer schütten; denn dieser ist feiner als in Deutschland und verklumpt schnell, beziehungsweise wird als Klumpen verkauft.
Gekrönt wurde das Ganze durch den Besuch eines Baseballspiels. Dieser Mannschaftssport erfreut sich in Japan neben Fußball äußerst großer Beliebtheit. Als Deutsche hatte ich die Spielregeln jedoch nicht direkt mit der Muttermilch aufgesogen; daher bestand das Spiel für mich aus unverständlichen Wechseln zwischen irgendwelchen Aktionen und Pausen auf dem Spielfeld, untermalt durch Action, die die Fans auf den Rängen mit Hilfe von Maskottchen, Trommeln und Trompeten, Gesängen und Tänzen machten. Dies gab mir an besagtem Tag den Rest.
Diese Überfüllung, dieses Viel an fast allem, begleitet das Leben in Japan, einem Land, in dem Platz Mangelware ist, in den unterschiedlichsten Bereichen. Bekannt sind Bilder der wenigen Freibäder, in denen ein Besucher neben dem anderen im Wasser steht, oder Bilder von U- und S-Bahnen, in die die Fahrgäste zur Rush Hour von Ordnern regelrecht hineingestopft werden.
Abbildung 3: Leuchtreklamen in Shinjuku (KM)
Berühmt-berüchtigt sind ebenfalls die Mega-Staus, die sich an den Wochenenden im Winter in die Berge, zur Kirschblütenzeit hinaus zu den tollsten Blüten-Spots und im Sommer an die Küste quälen, am Samstagmorgen aus Tokio hinaus und am Sonntagnachmittag wieder hinein. Der Stau, den wir eines Sonntagabends nach einem Kirschblütenwochenende bei der Rückfahrt von Freunden auf einer der kostenpflichtigen Autobahnen erlebten, war bezeichnend. Etwa 50 Kilometer vor Tokio (!) stockte plötzlich der Verkehr und es ging nur noch sehr langsam voran. Das konnte ja heiter werden. Aber welch Glück, eine Ausfahrt nahte und wir fuhren ab. Doch so schlau waren überraschenderweise auch einige unserer Leidensgenossen, weswegen sich der Stau auf den ersten Kilometern der Ausfahrt fortsetzte.
So extrem geht es aber nicht immer und überall zu. Beispielsweise mussten wir beim Skifahren an den Liften in der Präfektur Gunma in der Nähe von Tokio sowie in Niseko, einem bekannten und beliebten Skisportort auf Hokkaidō, der nördlichsten der vier japanischen Hauptinseln, erstaunlicherweise nie lange warten und die Pisten würde ich ebenfalls nicht gerade als überfüllt bezeichnen. Außerhalb der Rush Hour kann man sich meistens sowohl auf den Straßen als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ziemlich normal durch Tokio bewegen. Und das minimalistisch klare und aufgeräumte Design und die Inneneinrichtung vieler traditioneller, japanischer Herbergen und Tempel und deren Gärten sowie sonstige Parks bilden einen wunderbaren Gegenpol und schaffen mitten im Großstadttrubel immer wieder Oasen der Ruhe.
Zudem kann man sich natürlich bis zu einem gewissen Grad an das Leben in dieser Metropole gewöhnen. Glücklicherweise war dies bei mir recht schnell der Fall, so dass mir das Gewusel bald nichts mehr ausmachte. Im Gegenteil erinnere ich mich daran, wie ich gegen Ende meines Aufenthaltes in Japan wieder einmal an der bekannten Kreuzung im Tokioter Bezirk Shibuya stand, bei der jeweils alle Fußgänger gleichzeitig Grün haben und dann senkrecht und diagonal über die Straße wuseln. Ich saugte die Energie um mich herum auf und genoss richtiggehend das Gewusel, das Brummen und Summen wie in einem Bienenstock.
Nach besagtem Abend, an dem wir das Baseballspiel besuchten, war es für mich mit der Reizüberflutung also mehr oder weniger auch schon wieder vorbei.
Nach einigen Monaten in Japan reisten wir für einige Tage in das „nahe“ gelegene Australien. Wir verbrachten wunderschöne, entspannte Tage unter dem intensiv blauen Himmel des Südens. Doch irgendwann kam der Tag der Rückreise über Hong Kong nach Tokio. Wir fuhren zum Flughafen Melbourne, durchliefen den Check-In und die Handgepäckskontrollen und setzten uns schließlich in den Wartebereich unseres Gates. Und dort überkam es mich, das große Elend. Ich wollte nicht wieder zurück nach Japan und vergoss völlig unjapanisch bittere Tränen in aller Öffentlichkeit. Da half es auch nicht, dass mir die gebürtige Melbournerin Natalie Imbruglia gegenübersaß, die offensichtlich ebenfalls mit uns fliegen würde. Was war passiert?
Neben den beeindruckenden Landschaften und dem traumhaften Wetter hatte ich es in Australien unbewusst sehr genossen, mit den offenen, humorvoll-lebenslustigen, freundlichen und entspannten Menschen um mich herum auf flirthaft-kokette Art in Kontakt zu kommen - sei es nur ein Blickkontakt oder ein lockerer, unverbindlicher Austausch von positiven Bemerkungen über das Wetter und guten Wünschen im Vorbeigehen.
Solche Interaktion, die für mich eine gewisse Leichtigkeit und Lebendigkeit mit sich bringt, ist in Japan, insbesondere in den großen Städten, nicht üblich. Direkter Blickkontakt über eine bestimmte Dauer hinaus wird weitestgehend vermieden. Dieser würde als aufdringlich empfunden werden.
Und selbst wenn man in die Gesichter und Augen der Japaner blickt, kann man als Japanneuling erst einmal kaum Gefühlsregungen erkennen. Die Gesichter wirken maskenhaft neutral und man hat das Gefühl, dass sich zwischen dem sichtbaren Äußeren der Augen und der verborgenen, inneren Gefühlswelt des Gegenübers eine Mauer befindet, durch die es in kaum ein Durchkommen gibt. Dem liegt das Prinzip von Honne und Tatemae zu Grunde. Die wahren Wünsche und Vorlieben (Honne) bleiben in aller Regel unter einem ausdruckslosen Gesichtsausdruck, einer offiziellen Haltung oder Meinung (Tatemae) verborgen. Höchstens gegenüber den engsten Freunden und der Familie werden diese geäußert. Bei kleinen Kindern ist dies noch anders. Sie wirken - wie überall auf der Welt - offen, emotional nahbar und lebendig, und man hat das Gefühl, einen „normalen“ Zugang zu ihnen finden zu können. Ab einem gewissen Alter ändert sich dies jedoch und der Blick wirkt wie bei einem Pokerface nicht mehr greifbar. Die innere Mauer ist errichtet. Dies geschieht wohl bis zum Alter von vier Jahren, wenn laut Dr. Harvey Karp (2010) die linke, eher verstandesgesteuerte Gehirnhälfte an Einfluss gewinnt1 - und damit vermutlich auch kulturspezifische Prägungen.
Und derartige Erlebnisse und Eindrücke führten dazu, dass ich mich anfangs unbewusst ein Stück weit sozial ausgehungert und isoliert fühlte. Bewusst wurde mir dies allerdings erst so richtig in dem Moment, als ich wieder zurück nach Japan „musste“.
Was mir den rein visuellen Zugang zu meinem Gegenüber in Japan am Anfang zusätzlich erschwerte, war die Tatsache, dass ich zunächst nur wenig Unterschiede in den Gesichtern der Menschen um mich herum erkennen konnte. So war ich eines Tages mit der Angestellten einer Relocation Agentur unterwegs, die mich als Japanneuling bei einigen Behördengängen unterstützte. Im Bahnhof Shibuya, auf dem für gewöhnlich reges Treiben herrscht, ließ mich meine Betreuerin für ein paar Augenblicke alleine stehen, da sie auf die Toilette musste. Währenddessen beschäftigte ich mich damit, die Menschen um mich herum zu beobachten. Ich drehte mich nach links und drehte mich nach rechts und war ganz fasziniert von all den Eindrücken, die auf mich einströmten, als meine Betreuerin plötzlich so unvermittelt wieder vor mir stand, dass ich erschrak. Offensichtlich war sie für mich in der Menge der Leute völlig untergegangen.
Beruhigenderweise geht es Japanern mit westlichen Gesichtern ähnlich. Zumindest interpretierte ich dies in folgendes Erlebnis hinein: Als ich eines Nachmittags in einem Starbucks-Café in Tokio meine Bestellung aufgab, wirkte der Angestellte plötzlich nervös und stammelte aufgeregt im wenigen Englisch, das er zusammenkratzen konnte: „Iksukujūsu mī, āru yū Kjameron Diazu?“ („Excuse me, are you Cameron Diaz?“). Ich war baff. Ja, zugegeben, damals blondierte ich meine Haare noch. Ansonsten konnte ich keine Ähnlichkeit zwischen mir und der echten Cameron Diaz feststellen, zumal ich eine Brille trug. Leider war ich viel zu verdattert und wollte den armen Mann nicht unnötig nervös machen, so dass ich schnell Entwarnung gab. Was wohl passiert wäre, hätte ich seine Frage bejaht?
Was mir in Australien zusätzlich zur Art der Interaktion mit den Mitmenschen und der vertraut wirkenden, westlich geprägten Lebensweise, ein heimeliges Gefühl verliehen hatte, waren erstaunlicherweise der Anblick von Kirchtürmen und das Läuten von Kirchenglocken – erstaunlicherweise, weil ich mich schon damals eher als Atheistin denn als gläubige Christin bezeichnet hätte. Aber irgendwie gehörten Kirchtürme und -glocken aus Gewohnheit für mich offensichtlich zu einem gewissen Heimatgefühl dazu.
Mit dem Gefühlsausbruch in Melbourne war es dann jedoch auch schon wieder vorbei mit der Wehmut und dem Hadern mit der fremden Kultur und Umgebung, in der ich nun lebte. Zurück in Japan fand ich es wiederum spannend, die andere, für mich immer noch relativ fremde Welt zu entdecken. Was das Einleben dort zudem angenehm machte, waren die weit verbreitete Höflichkeit, Rücksichtnahme und Serviceorientierung. Dank dieser funktioniert das Zusammenleben sogar in der Millionenstadt Tokio ziemlich reibungslos und sicherlich deutlich ruhiger und entspannter als in den meisten anderen Metropolen dieser Welt.
Und so überstand ich auch meine erste Autofahrt als Fahrerin in Japan unbeschadet – und das, obwohl ich diese spontan aus einer Laune heraus und völlig unvorbereitet antrat, ohne Begleitung war, mit einer mir bis dahin unbekannten Automarke und zum ersten Mal mit einem Automatikauto fuhr, nur über ein komplett japanisches Navigationssystem aber noch keine brauchbaren Japanischkenntnisse verfügte, es langsam dunkel wurde und zu regnen anfing und ich auch zum ersten Mal im Linksverkehr fuhr – und all dies eben mitten in Tokio, wo ich mich noch nicht auskannte und wo die abendliche Rush Hour einsetzte. Um mich nicht hoffnungslos zu verirren, versuchte ich, mich nicht zu weit von unserer Wohnung zu entfernen, weswegen ich auf der vierspurigen Straße, die an unserer Wohnung vorbeiführte, immer wieder wendete. Vermutlich verlangte ich bei dieser Fahrt den Autofahrern hinter mir eine gehörige Portion Geduld ab; denn die Bremsen unseres Autos reagierten sehr sensibel, so dass es jedes Mal eine Vollbremsung vollführte, wenn ich das Tempo ein wenig verlangsamen wollte. Glücklicherweise hupte jedoch niemand, so dass dieses kleine Abenteuer trotz allem ziemlich entspannt ablief.
Was mir die Eingewöhnung in Japan ebenfalls erleichterte, war die Tatsache, dass das Leben in Japan dem in Deutschland und „die“ Japaner „uns“ Deutschen, soweit man dies verallgemeinern kann, in vielerlei Hinsicht gar nicht so unähnlich sind. Lebens- und Hygienestandards, Sicherheit und Klima gleichen in weiten Teilen denen in Deutschland oder übertreffen diese sogar. Und Japaner werden manchmal nicht ganz von ungefähr als „Deutsche Asiens“ bezeichnet.
Nehmen wir das Beispiel Pünktlichkeit. „Wir“ Deutschen werden in südeuropäischen und lateinamerikanischen Ländern gern einmal wegen unserer Pünktlichkeit aufgezogen. Einen Klassiker erlebte ich, als spanische Freunde und ich uns einmal zum gemeinsamen Kochen gegen 20:00 Uhr in der Küche unseres Studentenwohnheims verabredet hatten. Ich, die Deutsche, erschien pünktlich und ziemlich hungrig um 20:00 Uhr in der Küche unseres Studierendenwohnheims, bereit mit dem Kochen zu beginnen – und fand mich dort, wenn man die tierischen Bewohner einmal ignorierte, allein auf weiter Flur. Meine spanischen Freunde trafen gemütlich irgendwann gegen 20:30 Uhr ein, mit Kochen fingen wir gegen 21:00 Uhr an und aßen dann letztlich gegen 22:00 Uhr.
Ähnlich „den“ Deutschen verstehen Japaner abgestimmte Zeiten wörtlich und man sollte diese absolut ernst nehmen – ernster als in Deutschland, wo man zu Geschäftsmeetings trotz aller Genauigkeit gern fünf bis zehn Minuten zu spät kommt, um die eigene Wichtigkeit oder den aktuellen Stresspegel zu unterstreichen - von den häufig verspäteten Zügen der Deutschen Bahn ganz zu schweigen, von denen im Fernverkehr beinahe jeder dritte Zug unpünktlich ist.2 Bei Meetings wird in Japan erwartet, dass die Teilnehmer am besten fünf bis zehn Minuten zu früh erscheinen, und bei Zügen auf der viel befahrenen Strecke zwischen Tokio und Ōsaka im Westen Japans betrug beispielsweise die durchschnittliche Verspätung im Jahr 2004 laut einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen lediglich sechs Sekunden! Verspätungen wie in Deutschland wären in Japan undenkbar. Hat der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen eine Verspätung von 60 Sekunden, wird diese explizit als solche angekündigt.3 Über äußerst seltene Verspätungen von mehr als einer halben Stunde wird sogar in den Nachrichten berichtet. Zugegebenermaßen verdanken Japaner die Pünktlichkeit ihrer Züge zum Teil wohl dem Aufbau des Schienennetzes, das zumindest im Falle des Shinkansen komplett getrennt von anderen Linien verläuft. Sicherlich spielt aber auch die grundlegende Mentalität, die Pünktlichkeit und damit Kundenorientierung eine sehr hohe Bedeutung beimisst, eine wesentliche Rolle. Ein Lokführer, der mehr als 60 Sekunden Verspätung hat, muss bereits zur Nachschulung 4 . Ab einer Verspätung von 90 Sekunden drohen oder drohten - zumindest 2005 - die Eisenbahngesellschaften Lokführern mit Kündigung oder erniedrigenden Strafen.5
Über die Sinnhaftigkeit dieser Haltung und vor allem des damit verbundenen Drucks auf die Lokführer kann man freilich streiten. Dieser war 2005 wohl die Hauptursache eines schweren Zugunglücks mit 106 Toten. Der Zugführer war damals mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve gerast, um eine Verspätung wieder aufzuholen.
Auch Genauigkeit wird in Japan ein hoher Wert beigemessen – ähnlich wie in Deutschland, das im Ausland als Land der sorgfältigen und hochwertigen Qualitätsarbeit der Ingenieure gesehen wird. Ein kleines Beispiel hierfür ist, dass japanische Züge auf den Zentimeter genau und in der richtigen Wagenreihung an den auf dem Bahnsteig markierten Stellen halten. Und so ergeben die detaillierten Markierungen, die Waggonnummer und Wartebereiche für die einsteigenden Passagiere auf beiden Seiten der sich öffnenden Türen kennzeichnen, auch tatsächlich Sinn.
Bei der Einrichtung von Gebäuden und der Dekoration von Innenräumen manifestiert sich ebenfalls die japanische Liebe zur Genauigkeit und zum Detail. So wurde im Inneren des Tokioter Bade-Themenparks Ooedo-Onsen Monogatari auf Odaiba der zentrale Platz einer traditionellen, japanischen Stadt mit umliegenden Geschäften und Restaurants nachgebaut. Oder da ist Tokyo DisneySea®, eines der zwei Tokioter Disney Resorts, in dem die nachgebildeten Orte äußerst realitätsgetreu daherkommen. Dementsprechend war ich durch Fotos von reisefreudigen, kanadischen Freunden zunächst verwirrt, die diese an ihrem ersten Hochzeitstag inmitten - zumindest im nächtlichen Licht der Straßenlaternen - täuschend echt erscheinender, venezianischer Kanäle zeigten. Wenige Tage zuvor hatte ich sie noch in Tokio getroffen und sie hatten nichts von einer bevorstehenden Reise nach Europa erzählt. Erst nach einigem Hin und Her lösten sie das Rätsel auf und gaben zu, dass sie zur Feier ihres Jahrestages eine Nacht in Tokyo DisneySea® verweilten.
Neben Pünktlichkeit und Genauigkeit spielen auch Regeln und bürokratische Abläufe in Japan, ähnlich wie in Deutschland, eine wichtige Rolle. Und auch diese werden in Japan manchmal noch ernster genommen als hierzulande. Dies reicht stellenweise bis ins Absurde, so dass die Sinnhaftigkeit der jeweiligen Regeln oder Abläufe nicht mehr direkt erkennbar ist.
Zum Beispiel musste ich zur Aufnahme an meiner Universität zwingend ein eigenes Bankkonto vorweisen. Das Konto meines Partners, auf das ich Zugriff hatte und das wir uns faktisch teilten, reichte nicht aus. Hintergrund dieser Regelung war vermutlich, dass man in Japan, zumindest zum Zeitpunkt meines Aufenthalts, selbst als Ehepaar kein gemeinsames Konto als gleichberechtigte Besitzer führen konnte





























