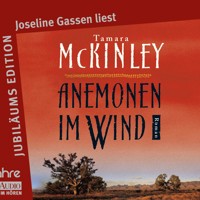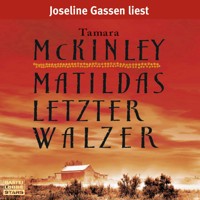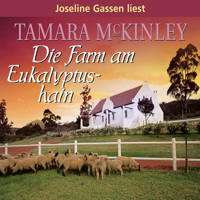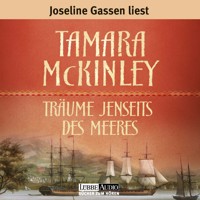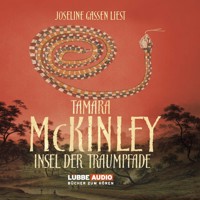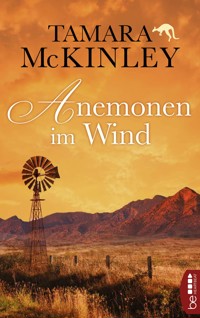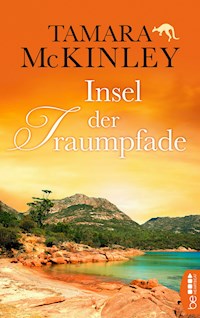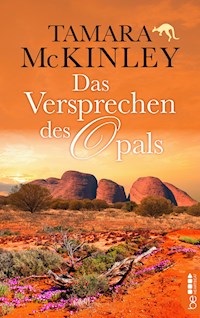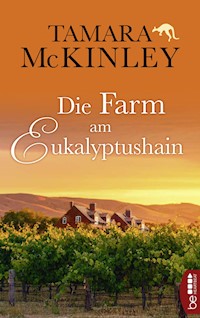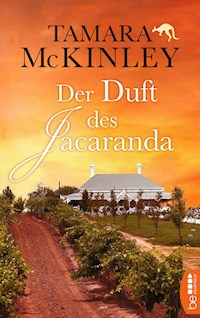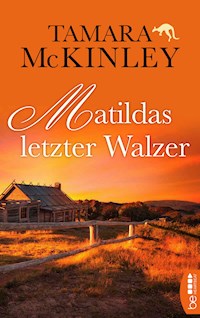9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Paris 1936. Die junge englische Krankenschwester Annabelle zieht in das turbulente Künstlerhaus ihrer Tante und taucht begeistert in die exotische Welt der Metropole ein. Als sie den Maler Henri kennenlernt, ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch wie so viele junge Männer zieht auch Henri bald an die Front des Spanischen Bürgerkriegs, und auch Annabelle muss sich den Schrecken des Krieges stellen. Auf grausame Weise wird sie von Henri getrennt. Doch zwanzig Jahre später trifft ihre Tochter auf einen Maler, der verletzt aus dem Spanienkrieg zurückkehrte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Ähnliche
Inhalt
Tamara McKinley
Jene Tage voller Träume
Roman Übersetzung aus dem Englischen von Ariane Böckler
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe:
»Echoes from Afar«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2015 by Tamara McKinley
Published by arrangement with Quercus Publishing Ltd., London
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anne Fröhlich, Bremen
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde
Einband-/Umschlagmotiv: © Debbie Clement Design
© Arcangel/Malgorazata Maj
© Corbis/Markus Lange/robertharting
© Corbis/68/Ocean
Datenkonvertierung E-Book: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-3002-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Prolog
Paris 1956
Obwohl seitdem so viele Jahre vergangen waren, hatte er gehofft, sie wie durch ein Wunder noch einmal dort zu sehen. Als sie dann tatsächlich erschien, fragte er sich, ob es allein die Macht seiner Sehnsucht gewesen war, die sie irgendwie herbeigezaubert hatte.
Sein Atem stockte, und sein Puls ging schneller, als er sich an der Balkontür im dritten Stock in seinem Rollstuhl nach vorne lehnte, das Weinglas und die Zigarette völlig vergessen, während er zu fassen versuchte, dass sie es wirklich war. Zwanzig Jahre waren vergangen, und seine Augen waren nicht mehr so gut wie früher. Spielten sie ihm womöglich einen grausamen Streich? Ging seine Fantasie mit ihm durch? Doch wie sie da auf dem Pont Neuf stand und über die schnell fließende Seine hinweg auf das Häusermeer von Paris in Richtung Eiffelturm blickte, schien es, als wären all diese Jahre ausgelöscht und sie sei zu ihm zurückgekehrt.
Er rutschte ein Stück nach vorne, sicher, dass sie ihn in dem allmählich dunkler werdenden Zimmer nicht sehen konnte, obwohl er seinen Augen noch immer nicht traute. Ihr Haar war länger als in seiner Erinnerung und wallte ihr in üppigen, weichen Locken über die schmalen Schultern. Ihre schlanke Gestalt besaß nach wie vor jene zarte Anmut, die so gar nicht zu der wilden Entschlossenheit passte, die sie immer ausgezeichnet hatte. Selbst noch in diesem entspannten Zustand hielt sie das Kinn fast trotzig gereckt, genau wie er es von früher kannte. Sie trug schmal geschnittene Hosen und einen Pullover, und zu ihren Füßen stand Reisegepäck; außerdem hatte sie eine Künstlermappe dabei und einen Mantel über dem Arm.
»Belle?«, flüsterte er verblüfft. »Bist du es wirklich?«
Als hätte sie ihn gehört, wandte sie sich vom Fluss ab und ließ den Blick von der Brücke über das Kopfsteinpflaster des Quai de la Mégisserie schweifen, hinauf zu den hohen grauen Häusern, deren Balkone und Fenster zur Seine hinausgingen.
Erneut stockte ihm der Atem, als ihr Gesicht von einer Straßenlaterne erleuchtet wurde. Einen Moment lang schien sie ihm direkt in die Augen zu blicken, dann wandte sie sich wieder ab. Die Enttäuschung tat weh. Es war nicht Belle, konnte unmöglich Belle sein. Zu viele Jahre waren verstrichen, und dieses Mädchen war jünger, als Belle an jenem schicksalhaften Tag gewesen war, als sie sich auf der Brücke kennengelernt hatten. Und doch hatte sie etwas an sich, was ein Echo der Vergangenheit in sich barg …
»Alles in Ordnung, Patron?«
Das Licht ging an und erschreckte ihn, die plötzliche Helligkeit ließ ihn blinzeln. »Machen Sie das Licht wieder aus, und kommen Sie her«, befahl er dem jungen Mann, während er sich erneut dem Fenster zuwandte. »Sehen Sie das Mädchen dort? Gehen Sie hinunter und finden Sie heraus, wer sie ist und woher sie kommt. Aber schnell jetzt, ehe sie von der Brücke verschwindet.«
Sein Blick war fragend und ein bisschen spöttisch. »Sie ist ein bisschen jung, sogar für Sie, oder nicht, Patron?«, witzelte er.
Die Ungeduld ließ seine Stimme schneidend klingen. »Tun Sie einfach, was ich sage, Max«, zischte er. »Ich erkläre es Ihnen später.«
Als Max gegangen war, wandte er sich erneut dem Fenster zu. Die junge Frau schaute jetzt herauf und ließ den Blick über das schmiedeeiserne Balkongeländer schweifen, vielleicht angezogen von dem plötzlich aufflackernden Licht, das ebenso schnell wieder erloschen war. Sie schien ihn eine Sekunde lang zu fixieren, und er spürte ihre Beklommenheit, als sie rasch beiseite sah und damit den Bann brach.
Er berührte das Glas der Balkontür, als könnte er sie dadurch festhalten, doch ehe Max auch nur unten auf der Straße angelangt war, hatte sie schon ihre Koffer genommen und sich umgewandt. Augenblicklich hatte sie der Strom von Büroangestellten, die nach Hause eilten, und flanierenden Touristen verschluckt.
Er ließ sich in seinem Rollstuhl zurücksinken. Der Moment war verloren, sein Schmerz brannte. Er schloss die Augen und versuchte so, etwas von seiner Pein zu vertreiben, doch das Einzige, was er vor sich sah, war die junge, lebenslustige Belle, die vor so vielen Jahren auf dem Pont Neuf gestanden hatte, und die Erinnerung und der tiefe Schmerz über die Ereignisse, die sie auseinandergerissen hatten, drohten ihn zu überwältigen.
1
London 1936
Annabelle Blake tappte über das kalte Linoleum und zog die dünnen Vorhänge zurück. Draußen regnete es in Strömen, und der Anblick des Wassers, das aus überfüllten Dachrinnen stürzte, über schmutzige Pflastersteine strömte und sich schließlich in den verstopften Rinnsteinen sammelte, schien die Ausweglosigkeit ihrer Lage zu unterstreichen. Die unfaire Kündigung im Krankenhaus vor zwei Wochen und das alles andere als glänzende Zeugnis, das man ihr anschließend zugeschickt hatte, raubten ihr jede Aussicht darauf, eine andere Stelle als Krankenschwester zu finden. Unterdessen ging ihr in rasendem Tempo das Geld aus.
Annabelle war dreiundzwanzig und hatte trotz jahrelanger Ausbildung und engagierter Arbeit im Krankenhaus so gut wie nichts vorzuweisen. Sie hatte keine Familie, an die sie sich wenden konnte, nachdem ihr Vater ihr das Haus verboten hatte. Ihre Mutter wagte nicht, ihm offen die Stirn zu bieten und mit ihr in Kontakt zu bleiben. Sie wohnte in einer heruntergekommenen Pension in einem armen Viertel Londons, wo sie nur wenig mit den anderen Mietern verband. Das Gefühl der Isoliertheit wurde noch dadurch verstärkt, dass Caroline Howden, ihre engste Freundin, London verlassen hatte, um sich als Krankenschwester im Spanischen Bürgerkrieg nützlich zu machen. Und auch der stets verlässliche und hilfsbereite George Ashton ließ sich nicht mehr blicken, seit sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hatte.
Sie trat vom Fenster zurück in den Raum, der ihr als Schlaf- und Wohnzimmer zugleich diente, fuhr sich mit den Fingern durch das zerzauste Haar und versuchte an all dem die positive Seite zu sehen. Zumindest verfügte sie jetzt über ein Zeugnis, so zweifelhaft es auch war. George war intelligent genug, um irgendwann zu begreifen, warum sie ihn hatte abweisen müssen, und auch wenn heute vielleicht kein Tag war, an dem man gern das Haus verließ, so hatte sie doch eine Verabredung mit ihrer Mutter Camille zum Kaffee. Dies war ein seltenes und außergewöhnliches Ereignis – schließlich mussten sie ihre gelegentlichen Treffen vor ihrem Vater geheim halten. Also musste sie gute Miene zum bösen Spiel machen und sich darauf konzentrieren, den Riss zwischen ihnen zu kitten, der im Lauf der letzten fünf Jahre immer breiter geworden war.
Annabelle schmerzte es, dass sie und ihre Mutter sich nie nahegestanden hatten, und auch wenn sie wusste, dass Camille eine gewisse Zuneigung zu ihr hegte, so blieb diese doch sorgsam hinter einer kühlen Fassade verborgen. Während ihrer Kindheit in dem großen, düsteren Haus in Fulham hatte Annabelle nur wenig Gelegenheit gehabt, ihre Mutter kennenzulernen – und ihren Vater Edwin noch weniger, obwohl sich das als Segen erwies, denn sie hatte Angst vor seinen harten grauen Augen und seinen starren Regeln.
Ihre frühe Kindheit hatte sie mit einer Reihe von Kindermädchen in ihrem Kinderzimmer im ersten Stock verbracht, wo sie ihre Mutter nur sporadisch sah, wenn sie nach oben kam, um ihr Gute Nacht zu sagen. Und selbst da hatte es weder eine Umarmung noch einen liebevollen Kuss gegeben, sondern nur ein zerstreutes Tätscheln oder Schulterklopfen. Camille war noch nie eine zärtliche Frau gewesen, sondern hatte sich stets reichlich reserviert gezeigt. Als Annabelle älter wurde, begriff sie allmählich, dass Camilles gesamtes Leben nur um Edwin kreiste – obwohl nicht zu übersehen war, dass er auch ihr Angst machte.
Annabelle riss sich von ihren Gedanken los, sah auf die Uhr und schlüpfte rasch in ihren besten Tweedrock und einen Wollpullover. Da ihr Geld schon kaum für Essen reichte, geschweige denn für neue Kleider, musste sie mit ihren bereits mehrfach gestopften Baumwollstrümpfen, dem Gabardinemantel und den schwarzen Schuhen vorliebnehmen, die auch schon bessere Tage gesehen hatten.
Zuletzt zog sie sich trotzig die Lippen nach und tuschte sich die Wimpern, ehe sie ihre dunkelblonden Locken mit einer Bürste einigermaßen zu bändigen suchte. Ein Blick in den fleckigen Spiegel zeigte ihr die Schatten, die schlaflose Nächte unter ihren tiefblauen Augen hinterlassen hatten. Ihr einst so strahlender Teint war fahl. Rasch puderte sie sich leicht das Gesicht, setzte ihren ältesten Filzhut auf, schlang sich einen Schal um den Hals und griff schließlich nach ihrem Schirm. Das musste reichen, auch wenn Camille garantiert entsetzt die Hände ringen würde, denn sie war sehr streng in Bezug auf Äußerlichkeiten.
Während Annabelle hinunterging, beschloss sie, das Fahrrad zu nehmen, damit es schneller ging, und so legte sie Handtasche und Schirm in den Korb und schob es nach draußen. Nachdem die Haustür hinter ihr zugeschlagen war, spannte sie den Schirm auf und versuchte, das Fahrrad einhändig zu lenken, während sie über das unebene Kopfsteinpflaster und durch Pfützen holperte.
Am Copper Kettle angelangt war ihr klar, dass sie entsetzlich aussah. Der Schirm hatte sich während der Fahrt umgestülpt, und nun war ihr Mantel durchweicht und die Strümpfe übersät von Schlammspritzern. Mühsam faltete sie den Schirm zusammen und legte ihn in den Fahrradkorb, ehe sie sich die feuchten Haarsträhnen hinter die Ohren schob und eilig den Teesalon betrat.
Der Copper Kettle lag in einer engen Gasse in einem Stadtteil, den ihr Vater niemals aufsuchte. Drinnen war es warm und behaglich, ein angenehmer Kontrast, wenn man aus dem kalten Regen kam, und die Tische boten mit ihren weißen Leinendecken und dem geblümten Porzellan einen heiteren Anblick. Drei Frauen saßen bereits bei ihrem Morgenkaffee, doch sie achteten gar nicht auf Annabelle, sondern plauderten munter weiter.
Camille war nirgends zu sehen, und Annabelle hoffte beklommen, dass sie es sich in Anbetracht des Wetters nicht anders überlegt hatte. Sie hatte noch genau sechs Pence in der Tasche und bezweifelte stark, dass die in diesem doch recht noblen kleinen Café für eine Tasse Kaffee reichen würden. »Ich warte auf jemanden«, erklärte sie der Kellnerin entschlossen. »Ich bin früh dran, darf ich mich kurz frisch machen?«
Man führte sie in einen kleinen Raum, der in leuchtendem Rosa und grellem Weiß gestrichen war und wo es heißes Wasser, Seife und ein Handtuch gab. Annabelle verzog das Gesicht, als sie sich im Spiegel sah, denn ihr Filzhut hing schlaff auf ihrem zerzausten, feuchten Haar, Wimperntusche und Lippenstift waren verschmiert und ihr Schal und Mantel tropfnass.
Mit einem Taschentuch tupfte sie die Mascaraflecken und den verschmierten Lippenstift ab, ehe sie sich mit einem der Handtücher die Haare trocken rieb und ihre bespritzten Strümpfe reinigte. Es machte die Sache nicht wesentlich besser, und so fuhr sie sich nur noch mit einem Kamm durch die verstrubbelten Locken und ließ es gut sein.
Nachdem sie das Wasser von ihrem Regenmantel abgeschüttelt und ihren durchnässten Schal in die Tasche gesteckt hatte, flehte sie innerlich darum, dass Camille inzwischen eingetroffen war. Es wäre entsetzlich peinlich, nur um ein Glas Wasser zu bitten, nachdem sie die Toilette des Hauses benutzt hatte. Sie sammelte ihre Sachen zusammen und kehrte in den Gastraum zurück.
»Mon dieu«, japste Camille, während sie sich aus ihrem Nerz schälte. »Tu fais peur à voir! Qu’est-ce qui est arrivé?«
Wie bei ihrem letzten Treffen im Café hatte Camille offenbar beschlossen, ihr Gespräch auf Französisch zu führen, damit die anderen Gäste sie nicht belauschen konnten. »Ich weiß, dass ich schrecklich aussehe«, erwiderte Annabelle ebenfalls in dieser Sprache, die sie seit ihrer Kindheit fließend sprach. »Aber so ist das eben, wenn man bei Regen mit dem Fahrrad fahren muss.« Sie lächelte ihre Mutter an, die in ihrem schwarzen Hut mit Schleier, dem dunkelgrauen Schneiderkostüm und den hochhackigen Lackschuhen wie aus dem Ei gepellt aussah. »Dich hat der Wolkenbruch offenbar nicht erwischt.«
Camille zog eine Schnute und legte sich den Pelz um die Schultern, während sie Platz nahm. »Ich fand die altbewährten Londoner Taxis bei Regenwetter schon immer enorm hilfreich. Du hättest dir auch eines rufen sollen, statt mit dem Rad zu fahren.«
Annabelle erkannte verblüfft, dass ihre Mutter keine Ahnung vom Ausmaß ihrer finanziellen Schwierigkeiten und ihrer prekären Lage hatte. Doch andererseits hatte Camille niemals Armut erlebt, und so kam sie gar nicht auf die Idee, dass Taxis die finanziellen Möglichkeiten der meisten Menschen überschritten, von denen arbeitsloser Krankenschwestern ganz zu schweigen.
Annabelle hängte Hut und Mantel auf und setzte sich zu ihrer Mutter an den Tisch. »Ich hätte ein Taxi genommen, wenn ich es mir leisten könnte«, sagte sie ruhig. »Vor allem an einem Tag wie heute.«
Camille betrachtete sie gelassen, bis die Bedienung ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Nachdem sie ihre Bestellung aufgegeben hatte, wandte sie sich erneut an Annabelle. »Normalerweise esse ich keinen Kuchen«, murmelte sie und nahm ihre Tochter genauer in Augenschein. »Aber ich dachte, dir könnte eine kleine Leckerei nicht schaden. Du bist viel zu dünn und wirkst mit diesen grässlichen Schuhen reichlich heruntergekommen.«
Daran brauchte Annabelle nicht erinnert zu werden, doch sie war entschlossen, das Gespräch auf einer lockeren und freundlichen Ebene zu belassen. »Kuchen wäre wirklich ein besonderer Genuss, vielen Dank, Maman.«
Camille schwieg eine Weile und blickte nachdenklich unter dem Schleier ihres schwarzen Hutes hervor. »Carolines Mutter hat mir erzählt, was passiert ist, bevor ich deinen Brief bekommen habe«, sagte sie schließlich. »Ist es sehr hart für dich?«
»Ich habe meine Stellung in dem Beruf verloren, den ich liebe, Maman, und meinen guten Ruf. Anscheinend will mich kein anderes Krankenhaus zum Bewerbungsgespräch einladen, und selbst die Personalchefs in den Fabriken haben mich für die niedersten Arbeiten abgelehnt. Natürlich ist es hart.« Sie warf die feuchten Locken zurück und bereute augenblicklich ihren bitteren Tonfall. »Aber ich schlage mich schon durch, keine Sorge.«
Camille schwieg, als die Kellnerin mit ihren Bestellungen kam, und als sie wieder weg war, ließ sie sich viel Zeit damit, den duftenden Kaffee in die kleinen Tässchen zu gießen. Nachdem sie daran genippt und ihn nach ihrem Geschmack befunden hatte, beugte sie sich vor. »Es tut mir leid, dass du in diese Notlage geraten bist«, sagte sie leise. »Aber vielleicht solltest du jetzt noch einmal über Dr. Ashtons Antrag nachdenken. Du bist schließlich nicht mehr die Jüngste, Annabelle, und er kann dir Ansehen und ein wesentlich ruhigeres Leben bieten.«
Annabelle starrte sie verständnislos an. »Ich bin dreiundzwanzig, Maman, also wohl kaum eine alte Jungfer. Und ich werde niemanden heiraten, nur um meiner jetzigen Lage zu entkommen«, erklärte sie entschlossen. »George ist ein Freund – ein sehr guter Freund –, aber ich bin nicht in ihn verliebt, und es wäre falsch, seinen Antrag anzunehmen, wenn ich ihm nicht die Art von Liebe geben kann, die er von einer Ehefrau erwarten darf.«
»Ach was. Liebe hat sehr wenig damit zu tun«, erwiderte ihre Mutter mit einer ungeduldigen Handbewegung. »Wenn du ihn als Freund gern hast und euch einiges verbindet, dann ist das eine solide Grundlage für eine Ehe. Du darfst nicht so wählerisch sein, Annabelle. George Ashton mag ja bedauerlicherweise Ire sein, aber er ist ein zuverlässiger junger Mann mit einem guten Beruf und hervorragenden Aussichten. Was willst du mehr?«
Annabelle rebellierte innerlich gegen die herablassende Bemerkung ihrer Mutter über Georges Herkunft, doch um des lieben Friedens willen schwieg sie dazu. »In den Mann verliebt sein, den ich heirate«, entgegnete sie. »Allmählich klingst du schon wie Vater«, fügte sie in weicherem Ton hinzu. »Bitte, Maman, lass mich meine eigenen Entscheidungen treffen und einen Weg aus dieser Bredouille finden, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Heiraten ist nicht die Lösung; das war es noch nie. Ich bin Krankenschwester – wenn auch ohne Stelle –, und ich muss unbedingt meinen guten Ruf wiederherstellen und tun, wozu ich geboren bin. Das ist das Einzige, was mich momentan interessiert.«
Camille seufzte tief. »Das habe ich schon befürchtet, und deshalb möchte ich dir helfen.«
»Ich kann nicht nach Hause kommen, Maman, falls du das vorschlagen willst.«
»Nein, nein, ganz und gar nicht.« Sie öffnete ihre teure Lederhandtasche und zog einen Umschlag heraus. »Ich möchte dir das hier geben.«
Annabelle schnappte nach Luft, als sie begriff, dass der Umschlag voller Geldscheine war. »Maman! Das kann ich nicht annehmen. Wenn Vater erfährt, dass du mir dein Taschengeld gegeben hast, wird er außer sich sein – und wir wissen alle beide, wozu er dann fähig ist.«
Camille setzte ein geheimnisvolles Lächeln auf und legte ein kleines Kuchenstück mit Zuckerguss auf Annabelles Teller, ehe sie sich selbst eine Scheibe Rotweinkuchen nahm. »Iss deinen Kuchen, Annabelle.«
Annabelle begriff, dass Camille nicht mehr über das mysteriöse Geld verraten würde, ehe sie ihren Kuchen gegessen hatte. Obwohl sie Hunger hatte und der Kuchen eine besondere Leckerei war, war sie so angespannt, dass sie kaum etwas schmeckte.
Camille nickte zustimmend, steckte sich ein Stück Rotweinkuchen in den Mund und seufzte genussvoll. »Fast so gut wie französischer Kuchen. Möchtest du noch ein Stück?«
Annabelle wurde allmählich unruhig, und der Umschlag auf ihrem Schoß schien mit jeder Minute schwerer zu werden. »Nein, Maman«, sagte sie ruhig. »Sag mir lieber, wie du es schaffen willst, mir so viel Geld zu geben, ohne dass Vater davon erfährt.«
Camille verspeiste ein weiteres Stückchen Kuchen. »Edwin weiß nicht, dass ich es habe«, erklärte sie leichthin.
»Aber du hast doch gar kein eigenes Geld«, erwiderte Annabelle. »Und ich weiß genau, dass er jeden Penny zählt, den du von deinem Taschengeld ausgibst.«
Camille blieb völlig ungerührt und widmete sich weiter genussvoll ihrem Kuchen, während Annabelle sich fragte, was sie im Schilde führte – und, wichtiger noch, wo das Geld herkam. Sie hatte Camille noch nie so erlebt, und das beunruhigte sie.
»Ich spare schon seit geraumer Zeit hier und da einen Sou vom Haushaltsgeld oder von meinem Taschengeld«, sagte Camille beiläufig.
Annabelle schüttelte den Kopf. »Es hätte Jahre gedauert, das alles anzusparen, Maman. Wo kommt es wirklich her?«
Camille seufzte tief. »Ich habe ein kleines Hobby, das mir gelegentlich ein wenig zusätzliches Kapital einbringt.« Diese Aussage war ärgerlich nebulös.
»Was für ein Hobby?«
Camille zuckte die Achseln und setzte ein schelmisches Lächeln auf. »Nur ein paar Partien Bezique, Piquet oder Bridge. Das kann recht einträglich sein, wenn man mit Frauen spielt, die lieber klatschen, statt auf die Karten zu achten.«
»Ich wusste nicht, dass du um Geld spielst.« Sie starrte ihre Mutter an, die nun unübersehbar mit sich selbst zufrieden schien, und fragte sich, ob ihr Spiel wohl ganz korrekt war, wenn sie dabei so viel Geld verdiente. Doch das war ein unverschämter Gedanke, den sie nicht äußern durfte. »Offenbar spielst du sehr gut«, sagte sie stattdessen. »Aber warum sammelst du deine Gewinne? Warum gibst du sie nicht für dich selbst aus?«
Camille senkte den Kopf und kramte in ihrer Handtasche. »Dein Vater hält nichts von Glücksspielen, also konnte ich es unmöglich für neue Kleider oder einen schicken Hut ausgeben – er hätte mich sofort gefragt, woher ich das Geld dafür habe.«
Annabelle wartete ungeduldig, während ihre Mutter ein goldenes Zigarettenetui zückte und ihm eine rosafarbene Sobranie entnahm.
»Früher dachte ich, ich spare es als Sicherheitspolster für den Tag, an dem ich endlich den Mut aufbringe, ihn zu verlassen«, gestand Camille. »Aber es hat mir gefallen zu sehen, wie es immer mehr wurde, und wenn er außer Haus war, habe ich das Geld gezählt und mir ausgemalt, wie ich es ausgeben würde, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte.«
Annabelle sah sie ungläubig an, denn sie hatte ihre Mutter noch nie so reden hören. Dann sammelte sie sich und schob den Umschlag über den Tisch. »Nimm es zurück, Maman«, drängte sie. »Deine Not ist weitaus größer als meine. Mit dieser Summe kannst du nach Paris zu Tante Aline reisen, und sie findet bestimmt eine Arbeit für dich, oder …«
Sie verstummte, denn Camilles Miene verriet ihr, wie lächerlich schon allein der Gedanke war, sie könnte mit ihrer Schwester in ihrem überfüllten Pariser Haus leben, geschweige denn dort eine Arbeit annehmen.
Camille konzentrierte sich darauf, ihre Zigarette in die lange Zigarettenspitze aus Ebenholz zu schieben. Als ihr goldenes Feuerzeug aufflammte und den Tabak entzündete, sog sie den Rauch ein und stieß ihn fast ungeduldig wieder aus. »Das Geld ist für dich«, erklärte sie entschlossen. »Ich bin zu alt und in meinen Gewohnheiten zu festgefahren, um zu meiner Schwester nach Paris zu flüchten. Aber du, Annabelle, du bist noch jung, und du musst dir bei Aline ein neues Leben aufbauen.«
»Aber ich will nicht nach Paris«, protestierte Annabelle. »Ich bin Engländerin, und mein Leben ist hier.«
»Du hast französisches Blut in den Adern, ma chère, und es ist an der Zeit, dass du eine Welt entdeckst, die über all das hier hinausreicht.« Sie machte eine abschätzige Geste in Richtung Regen, Teesalon und London im Allgemeinen.
»Aber meine Arbeit ist hier«, beharrte Annabelle. »Und jetzt, wo ich ein Zeugnis habe, werde ich bestimmt zu mindestens einem Bewerbungsgespräch eingeladen.«
Camille senkte den Blick und streifte die Asche ihrer Zigarette an dem gläsernen Aschenbecher ab. »Manchmal ist es besser, wegzugehen und woanders neu anzufangen«, sagte sie ruhig.
»Ich bin nicht bereit, aufzugeben und nach Paris zu fliehen«, versetzte Annabelle heftig. »Ich muss meinen Namen reinwaschen und hier in London eine neue Stelle als Krankenschwester finden.«
Camille hob den Kopf, und ihre Augen verrieten ihre Traurigkeit. »Du bist immer stark gewesen, Annabelle, obwohl manche dich vielleicht als eigensinnig und widerspenstig bezeichnen würden. Ich bewundere deinen Mut, aber in diesem Fall ist er fehl am Platz.« Sie fasste über den Tisch und ergriff Annabelles Hand. »Vergeude deine Zeit nicht mit einem Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Nicht hier. Nicht in London.«
Eine böse Vorahnung überkam Annabelle. »Was meinst du damit?«
Camille seufzte erneut, legte die Zigarette in den Aschenbecher und ließ sie dort glimmen, während sie beide Hände über die Annabelles legte. »Wenn du doch nur einmal meinen Rat annehmen würdest, anstatt mich mit Fragen zu bedrängen, Annabelle. Nimm das Geld, geh nach Paris und fang dort neu an. Hier gibt es für dich nichts mehr zu gewinnen.«
»Wie kannst du dir da so sicher sein?«, fragte sie ruhig.
Camille warf die Hände in die Höhe. »Zut alors, noch mehr Fragen. Du stellst meine Geduld auf die Probe, Annabelle.«
Annabelle registrierte, dass ihre Mutter ihrem Blick auswich und dass ihre Hand zitterte, als sie erneut zu ihrer Zigarette griff. »Was verbirgst du vor mir, Maman?«
Camille zuckte auf sehr französische Weise die Achseln. »Was weiß ich schon? Ich bin doch nur eine unbedeutende Hausfrau.«
»Hör auf, Mutter«, zischte Annabelle auf Englisch. »Hör auf, mir auszuweichen, und sag mir, worum es dir wirklich geht.« Erneut schob sie den Umschlag zu ihr hinüber.
Camille drückte ihre Zigarette aus, registrierte die neugierigen Blicke der anderen Gäste und beugte sich vor, ehe sie leise und schnell auf Französisch zu sprechen begann. »Du magst ja dank der Hartnäckigkeit von Carolines Vater ein Zeugnis erhalten haben, aber du wirst keine neue Stelle an einem Londoner Krankenhaus bekommen. Und ich vermute, dass es dein Vater war, der dafür gesorgt hat.«
Annabelle lehnte sich zurück und fixierte ihre Mutter verwirrt. »Vater? Aber wie denn? Das verstehe ich nicht.«
»Natürlich nicht, wie solltest du auch? Ich habe keinen Beweis dafür, dass er es war, aber es wäre typisch für etwas, das er aus Bosheit tun würde. Er ist ein rachsüchtiger Mann, und er hat dir nie verziehen, dass du gegen seinen erklärten Willen die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht hast.«
»Aber das ist schon fünf Jahre her«, stieß Annabelle hervor. »Warum sollte er bis jetzt gewartet haben?«
Camille zog den Pelzmantel über ihren Schultern zurecht. »Er hatte die Geduld dazu, und er wusste, dass du früher oder später einen Fehler machen würdest – und wenn jemand in der Patsche sitzt, zeigt er sich von seiner grausamsten Seite.«
Annabelle wusste, dass Edwin Blake einer der gefürchtetsten Anwälte Englands war. Bei einem Strafverfahren konnte man von Glück sagen, wenn man ihn auf seiner Seite hatte – doch gnade Gott seinem juristischen Gegner. Die lange Liste von Angeklagten, die seinetwegen ins Gefängnis gewandert waren, zeugte von seiner Skrupellosigkeit. Allerdings wäre Annabelle niemals auf die Idee gekommen, er könnte diese Eigenschaft seiner eigenen Tochter gegenüber einsetzen, um sie für ihr Zuwiderhandeln zu bestrafen.
»Du bist ein so dummes Mädchen«, seufzte Camille. »Warum hast du dich nur an diesem Aufstand in der Cable Street beteiligt und dann auch noch die Krankenhausvorschriften gebrochen, indem du diesen Demonstranten im Park verarztet hast? Hättest du nicht ausnahmsweise einmal darüber nachdenken können, welche Konsequenzen dein Handeln hat?«
Annabelle konnte sich gut an diesen Moment im Hyde Park erinnern. Es war nur wenige Tage gewesen, nachdem George und sie in die schrecklichen Straßenkämpfe zwischen Faschisten, Gewerkschaftern und Kommunisten am Tower Hill und in der Cable Street geraten waren. Die Polizisten hatten die verhassten Blackshirts geschützt, indem sie mit Pferden in die Menge geritten waren. Frauen und Kinder waren dabei verletzt und zur Flucht durch die Seitengassen gezwungen worden. Annabelle war gekommen, um zu sehen, wie die Männer nach ihrem langen, friedlichen Protestmarsch aus Jarrow endlich ihr Ziel erreichten. Nach den Reden hatte sie mitbekommen, wie ein Mann stürzte und sich den Kopf aufschlug. Sie hatte sich vergewissert, dass er nicht ernsthaft verletzt war, und ihm Wasser und ein wenig Kleingeld gegeben, damit er mit dem Bus zum nächsten Versammlungsort fahren konnte.
»Ich habe mich nicht absichtlich an den Aufständen beteiligt«, protestierte sie. »George und ich waren einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Und was die Vorschrift der Klinik angeht, den Demonstranten nicht zu helfen, so widerspricht sie allem, woran ich als Krankenschwester glaube. Ich habe nur getan, was jeder anständige Mensch unter diesen Umständen getan hätte. Woher hätte ich wissen sollen, dass mich jemand bei der Krankenhausleitung anschwärzt und dass ich so schwer bestraft werde?«
Sie musterte ihre Mutter und merkte an ihrem Blick, dass Camille genau wusste, wer sie verraten hatte, dies jedoch – vielleicht sogar aus Angst – nicht zugeben wollte. »In Wirklichkeit steckt Vater hinter alldem, nicht wahr?«
»Ich kann es nicht zweifelsfrei beweisen«, gestand Camille widerwillig. »Aber ich vertraue meinem Instinkt, und ich habe deinem Vater jahrelang bei seinen Rachefeldzügen zugesehen. Ich weiß nicht, wie er von der Sache im Park erfahren hat – vielleicht ist er zufällig vorbeigekommen und hat dich gesehen. Aber ich weiß, dass er mächtige Freunde in hohen Positionen hat und dass er es sich zur Aufgabe gemacht hat, ihre Geheimnisse zu kennen.«
Camille zündete sich die nächste Zigarette an. »Auch ich bin inzwischen geschickt darin, Geheimnisse aufzudecken«, erklärte sie mit einem angedeuteten ironischen Lächeln. »Ich lausche an Türen und höre Telefongespräche über den Nebenanschluss mit. Es lohnt sich, mit Wissen gewappnet zu sein. Das habe ich in meiner Ehe gelernt«, sagte sie bitter.
Annabelle musterte ihre Mutter mit wachsender Ehrfurcht. Camille zeigte sich hier von einer ganz neuen Seite. Sie hatte gelernt, Edwins hartes Regime und seine Schikanen zu überleben und war nun schlau und gewieft – nicht mehr die geduckte, brave Maus, die Annabelle von früher kannte.
»Natürlich schaffe ich das nicht alles allein«, fuhr Camille fort. »Meine Putzfrau Mabel Watkins hat sich als exzellente Mitverschwörerin erwiesen. Sie erzählt mir, wer ins Haus kommt, was sie mithört, wenn ich nicht da bin, und hält mich über seine täglichen Termine auf dem Laufenden.«
Sie hielt inne und trank einen Schluck Kaffee. »Vor zwei Wochen hat sie mir auch von einem unerwarteten Besucher berichtet, aber keiner von uns beiden war klar, was der Verwaltungschef des Krankenhauses bei ihm wollte.«
Annabelles Magen verkrampfte sich, und der Kaffee schmeckte plötzlich bitter.
»Offenbar hatte der Mann Schwierigkeiten, einen Fürsprecher zu finden, der ihm die Mitgliedschaft in einem bestimmten pompösen Club ermöglichen sollte, in dem dein Vater im Vorstand sitzt. Ich glaube, man erachtete ihn als nicht ganz standesgemäß, obwohl er der Klinikleitung angehört. Doch dein Vater hat ihm versprochen, sich darum zu kümmern, dass seinem Antrag stattgegeben wird. Im Gegenzug sollte der Mann dafür sorgen, dass dir deine Stellung im Krankenhaus aufgekündigt wird.«
»Aber er war doch sicher schockiert über ein solches Ansinnen? Außerdem hätte sein Wort allein ohnehin nicht ausgereicht. Es muss alles über den Vorsitzenden laufen.«
Camille drückte ihre Zigarette aus. »Anscheinend hat der Vorsitzende einen Neffen, der eine Art Rabauke ist. Der junge Mann war einige Monate zuvor verhaftet worden, doch Edwin hat, trotz der schlagenden Beweise gegen ihn, eine Gesetzeslücke gefunden und ihn freibekommen.« Sie zuckte die Achseln. »Eine Hand wäscht die andere. Dem Vorsitzenden ist ein Familienskandal erspart geblieben, und der Verwaltungschef bekam seine Clubmitgliedschaft. Du bist zum Opfer geworden, weil du geradewegs in ihre Falle getappt bist, indem du diesem Mann aus Jarrow geholfen hast.«
»Was ist mit den anderen Krankenhäusern? Vaters Einfluss ist doch sicher nicht so groß, dass er die auch manipulieren kann?«
»Ein Wort hier und da über deine Unzuverlässigkeit, ein Hinweis darauf, dass hinter deiner Entlassung mehr stecken könnte – das ist die stille Post in einer geschlossenen Gesellschaft. All das kann sich vernichtend auswirken, Annabelle.« Camille seufzte tief.
Die Beweise gegen Edwin waren zu zwingend, um dagegen zu argumentieren. Annabelle schloss die Augen und vergrub das Gesicht in den Händen. Edwin Blake mochte ja der Welt seine intelligente, erfolgreiche und ehrenwerte Seite zeigen, doch hinter dieser Fassade verbarg sich ein Gewaltmensch, der seine Frau und seine Tochter kleinhalten und sie beide nach seinen Wünschen formen wollte. Er hatte schon früher bewiesen, dass ihm jedes Mittel recht war, um seinen Willen durchzusetzen. Deshalb hatte er Annabelle des Hauses verwiesen, als sie sich weigerte, den Mann zu heiraten, den er für sie ausgewählt hatte, und stattdessen die kleine Erbschaft ihrer Großtante nutzte, um ihre Ausbildung zur Krankenschwester zu finanzieren. Sie hatte nie begriffen, warum er so dagegen war, dass sie Krankenschwester wurde – und er hatte es ihr nie erklärt. Und so war sie zu dem Schluss gekommen, dass er in jedem Fall dagegen gewesen wäre, egal, welchen Beruf sie gewählt hätte, einfach weil das seine Methode war, seine Macht auszuspielen.
»Es tut mir leid, Annabelle, ich wollte dir diese schändliche Geschichte eigentlich nicht erzählen. Aber jetzt weißt du, was dich erwartet, und siehst sicher ein, dass es klug wäre, das Geld zu nehmen und dich so weit wie möglich von hier zu entfernen.« Camille schob den Umschlag wieder über den Tisch. »Hier drin ist ein Ticket, mit dem du bequem nach Paris reisen kannst. Der Zug zur Nachtfähre fährt um neun Uhr in London ab.«
Annabelle schnappte nach Luft. »Heute Abend?«
»Um neun Uhr.«
»Aber ich …«
»Annabelle«, zischte sie. »Nimm ausnahmsweise mal einen Rat an und sei vernünftig. Dein Vater hat deine berufliche Laufbahn ruiniert und versucht nun mit allen Mitteln, dich in die Knie zu zwingen. Er weiß, wie du lebst und wie deine Lage ist, und es würde mich nicht im Geringsten wundern, wenn er noch etwas unternimmt, was dir keinen anderen Ausweg mehr lässt, als nach Hause zu kommen.«
»Ich komme nie zurück«, flüsterte sie.
»Dann fahr zu Aline. Dort bist du in Sicherheit, und mit deinem fließenden Französisch findest du schnell eine gute Stelle als Krankenschwester.« Sie kramte in ihrer Handtasche und zog Annabelles Reisepass und einen weiteren Umschlag hervor.
»Ich habe deinen Pass in einer abgeschlossenen Schublade im Arbeitszimmer deines Vaters gefunden – Mabel ist mittlerweile sehr geschickt darin, Schlösser zu knacken«, fügte Camille mit einem kurzen Lächeln hinzu. »Hier ist ein Brief an Aline, der die Situation erklärt. Ich habe ihre Adresse vorne draufgeschrieben für den Fall, dass du sie vergessen haben solltest.«
Sie reichte ihr den Umschlag und den Pass. »Du wirst Paris lieben, Annabelle. Es ist eine Stadt für alle, die im Herzen jung geblieben sind, und wunderschön. Fast beneide ich dich.«
»Dann komm mit, Maman. Wir können beide einen Neuanfang machen, und …«
»Non, ma chère«, fiel Camille ihr ins Wort. »Es ist zu spät für mich. Aber du … du bist jung und schön und hast noch das ganze Leben vor dir.« Sanft tätschelte sie Annabelles Wange. »Fahr nach Paris, werde zu der Frau, die seit jeher in dir steckt, und mach mich stolz.«
Annabelle schmiegte ihre Wange in die zarte, weiche Hand ihrer Mutter und blinzelte die Tränen weg. »Ich hab dich lieb, Maman«, flüsterte sie.
»Und ich dich«, erwiderte Camille leise. Der rührende Moment war von kurzer Dauer, dann wurde sie wieder ganz sachlich. »Aber jetzt müssen wir uns voneinander verabschieden. Ich muss zu meiner nachmittäglichen Bridgepartie nach Hause, und du musst packen und dich auf deine Reise vorbereiten.« Sie winkte der Kellnerin, um zu bezahlen, und bat sie, ihr ein Taxi zu rufen, ehe sie Mantel und Handschuhe anzog.
Während Annabelle ihren Mantel holte, schwirrte ihr der Kopf von all dem, was sie soeben erfahren hatte. Der Gedanke, dass sie in wenigen Stunden nach Paris aufbrechen würde, raubte ihr den Atem, und doch wusste sie, dass der Rat ihrer Mutter klug war und beherzigt werden sollte. Edwin hatte gezeigt, wie rachsüchtig und grausam er sein konnte, und ihr war klar, dass er nicht eher ruhen würde, bis sie völlig gebrochen war und wieder unter seinem Dach lebte – und das durfte nicht geschehen.
Das Taxi kam, und als sie hinaustraten, stellten sie fest, dass es aufgehört hatte zu regnen. Als Camille die Arme um sie legte, atmete Annabelle den vertrauten Duft ihres französischen Parfüms ein und fühlte sich für einen Moment in ihre Kindheit zurückversetzt. »Werde ich dich jemals wiedersehen, Maman«?
»Eines Tages vielleicht«, flüsterte Camille. »Aber in nächster Zeit müssen wir uns erst einmal viele, viele Briefe schreiben. Schick sie an Carolines Mutter, ma chère. Sie sorgt dafür, dass ich sie bekomme.«
Annabelle konnte durch die Tränen hindurch kaum noch etwas sehen, als ihre Mutter ins Taxi stieg und der Fahrer die Tür zuschlug. »Adieu, Maman«, stieß sie hervor.
»Nicht adieu, mein Schatz: au revoir«, erwiderte Camille durch das offene Fenster.
Das Taxi brauste davon, und Annabelle kämpfte mit den Tränen, als sie es um die Ecke verschwinden sah. Sowie das Motorengeräusch verklungen war, fuhr sie langsam auf ihrem Fahrrad zurück zu ihrer Wohnung. In ihrem Kopf überschlugen sich die Gedanken an all das, was sie noch zu erledigen hatte, ehe sie in den Zug stieg.
Dr. George Ashton hatte Annabelles Wohnung aufgesucht, weil er an diesem Morgen erfahren hatte, dass Angus Fraser es sich anders überlegt hatte und ihm nun doch die allgemeinärztliche Praxis in Dartford verkaufen wollte. Er hatte sein Glück mit ihr teilen wollen. Nun aber wurde seine freudige Erregung von einer ohnmächtigen Wut verdrängt. Er hatte die Dinge viel zu lange schleifen lassen, um jetzt noch das Ruder herumreißen zu können.
Wütend auf sich selbst und auf Annabelle marschierte er die Straße entlang. Was zum Teufel spielte sie da für ein Spiel, dass sie einfach so davonlief, ohne ein Wort oder einen Brief? Und warum hatte er sie in den letzten Wochen praktisch ignoriert, wo er doch gewusst hatte, wie schwierig ihre Lage momentan war? Natürlich war ihm im Grunde klar, dass er sich lächerlich gemacht hatte, indem er ihr zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt einen Heiratsantrag machte, und sein Stolz litt unter der entsetzlichen Peinlichkeit. Aber das entschuldigte nicht, dass er sie ausgerechnet jetzt so schrecklich vernachlässigte, wo sie ihn am dringendsten gebraucht hätte.
Als er ein Taxi erblickte, riss er sich von seinen Gedanken los und winkte es herbei. »Victoria Station«, sagte er mit gepresster Stimme. »Und es gibt einen Shilling extra, wenn Sie es in fünf Minuten schaffen.«
Während das Taxi durch die belebten Straßen jagte, strich sich George die dunkle Locke aus dem Gesicht, die ihm andauernd in die Stirn fiel, und versuchte die Ruhe zu bewahren. Annabelle hatte ihre Wohnung mit zwei Koffern verlassen und war allen Auskünften zufolge auf dem Weg zur Victoria Station – was bedeutete, dass sie nicht in ihr Elternhaus nach Fulham zurückkehrte. Irgendetwas musste passiert sein, dass sie so abrupt aufgebrochen war, und seine große Angst war, sie könnte wider jede Vernunft beschlossen haben, es Caroline nachzutun und nach Spanien zu reisen.
Von sämtlichen idiotischen Ideen war das so ungefähr die schwachsinnigste, dachte er ärgerlich. Ein Bürgerkrieg war kein Ort für ein Mädchen wie Annabelle – oder irgendein Mädchen –, und er konnte nur beten, dass er noch rechtzeitig kam, um sie aufzuhalten.
Als das Taxi mit quietschenden Reifen vor dem Bahnhof hielt, warf George dem Fahrer das Geld regelrecht hin, ehe er in die Bahnhofshalle eilte. Beklommen blickte er auf die Tafel mit den Abfahrtszeiten, registrierte, dass der Zug zur Fähre jeden Moment abfahren würde, und rannte los.
Als er schlitternd am Gleis zum Stehen kam, sah er gerade noch den letzten Wagen aus dem Bahnhof fahren. »Verdammt noch mal«, schimpfte er.
»Sie haben ihn verpasst, Sir«, sagte ein Gepäckträger überflüssigerweise.
»Das sehe ich«, fauchte er.
»Morgen Abend fährt wieder einer«, ergänzte der Träger mit leisem Spott.
George klammerte sich an den letzten Rest seiner Selbstbeherrschung. »Haben Sie eine hübsche junge Frau mit dunkelblonden Haaren einsteigen sehen? Man kann sie nicht übersehen. Sie hat absolut faszinierende violett-blaue Augen.«
»Nach zwanzig Jahren in meinem Beruf achte ich nicht mehr besonders auf die Leute. Aber da war ein hübsches Mädchen mit einem Platz in der ersten Klasse.«
George wusste, dass sich Annabelle keine derart luxuriösen Reisearrangements leisten konnte, und so bedankte er sich bei dem Mann und ging davon, zurück in die Bahnhofshalle, wo er gegen alle Vernunft hoffte, sie irgendwo zu erspähen. Als er begriff, dass er sich damit eine unlösbare Aufgabe gestellt hatte, gestand er sich seine Niederlage ein und nahm den Weg zur Bar des Bahnhofshotels, wo er sich einen doppelten irischen Whiskey bestellte.
Während er in den Spiegeln hinter dem Tresen sein Ebenbild musterte, ließen seine Wut und seine Ungeduld allmählich nach und gingen in ein schmerzhaftes Gefühl von Verlust über. Er hatte sich beim ersten Blick in ihre wundervollen Augen in Annabelle verliebt. Während der letzten fünf Jahre hatte er in der Hoffnung gelebt, ihr eines Tages einen Heiratsantrag machen zu können. Er wusste, dass er manchmal verschlossen und ungeduldig war; er wusste, dass man ihn für einen Mann mit unerschütterlichem Selbstvertrauen hielt, einen Mann, der stets alle Erwartungen erfüllte. Doch hinter dieser Fassade war er ein verliebter Mann – allerdings fiel es ihm schwer, seine Gefühle auszudrücken. Jetzt bereute er, dass er Annabelle derart nah an sich herangelassen hatte.
Er trank einen Schluck und spürte, wie ihm der Whiskey in der Kehle brannte. Sein Heiratsantrag war abgelehnt worden, was nicht weiter verwunderlich war. Doch was in aller Welt war in sie gefahren, dass sie, ohne ein Wort zu sagen, durchbrannte? Lag ihr denn überhaupt nichts an ihm?
Er leerte sein Glas, stellte es auf den Tresen und verließ das Hotel. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sein Leben weiterzuführen wie bisher, in der Hoffnung, dass Annabelle zur Vernunft kam und zu ihm zurückkehrte. An die Möglichkeit, dass sie das nicht tun könnte, wagte er gar nicht zu denken.
2
Annabelle war reibungslos durch die Zollabfertigung gekommen. Der Gepäckträger hatte ihre beiden Koffer in das Schlafwagenabteil erster Klasse gebracht, das bis Paris ihr gehören würde. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie das vor sich gehen sollte, da sie ja auf ein Schiff ging, aber sie wagte es nicht, ihn zu fragen. Nachdem sie ihm ein Trinkgeld gegeben hatte, packte sie Nachthemd und Waschbeutel aus, bewunderte das gemütliche und erstaunlich komfortable Schlafgemach und machte sich dann auf, um alles zu erkunden.
Der Speisewagen war so prächtig eingerichtet wie ein Speisesaal in einem großen Londoner Hotel. Die Tische hatten gestärkte weiße Leinentischdecken, und im gedämpften Schein der kleinen Tischlampen schimmerten Kristallgläser und Silberbesteck. Die Speisekarten steckten in Rahmen, die zwischen den großen, mit Vorhängen versehenen Fenstern an den Wänden hingen. Als sie weiterging, entdeckte sie einen gemütlichen Salon mit einer gut bestückten Bar, an der elegant gekleidete Stewards Getränke ausschenkten. Auf niedrigen Tischchen lagen aktuelle Tageszeitungen sowie die neuesten Hochglanzmagazine aus, und sowie Annabelle sich setzte, kam ein Steward und fragte sie, ob sie etwas trinken wolle.
Von der Umgebung ein wenig eingeschüchtert nippte Annabelle an ihrem Sherry und betrachtete die anderen Passagiere. Nach ihrer überstürzten Abreise war sie kaum zum Atemholen gekommen. Alles war in so wahnwitzigem Tempo abgelaufen, dass sie beinahe das Gefühl hatte zu träumen. Allerdings waren die Rufe der Schaffner und Gepäckträger sehr real. Genau wie der Luxus ihrer Erste-Klasse-Kabine und das Ticket in ihrer Handtasche waren sie Beweise dafür, dass sie tatsächlich unterwegs nach Paris war.
Die zwei kleinen Koffer, die sie bei sich hatte, enthielten alles, was sie an Wertvollem besaß. Für fünf Jahre Arbeit war das nicht viel, doch zumindest machte sie in ihren besten Kleidern einen respektablen Eindruck. Der helle Strohhut mit dem roten Samtband war ein Abschiedsgeschenk von Caroline gewesen und sehr schick, und auch wenn ihr dunkelblauer Mantel keiner näheren Betrachtung standgehalten hätte, war er von ordentlicher Qualität, genau wie ihre gute schwarze Lederhandtasche. Allerdings konnte sie nicht verbergen, dass ihre Schuhe abgenutzt waren, obwohl sie sie auf Hochglanz poliert hatte, und so kreuzte sie unter dem Sitz die Füße und hoffte, dass niemand hinsah.
Das Abteil begann sich zu füllen. Es wurde lauter, und sie hörte, dass hier nicht nur Englisch, sondern auch Französisch gesprochen wurde. Die Leute bestellten Getränke, zündeten sich Zigaretten an und zogen die Vorhänge zu. Einige raschelten mit Zeitungen oder falteten Reisedecken auseinander, und der Steward ging durch den Wagen, um sich zu erkundigen, welche Plätze man beim Abendessen im Speisewagen wünsche.
Annabelle war zwischen Vorfreude und Angst hin- und hergerissen. Sie war noch nie erster Klasse gereist, noch nie in Paris gewesen und auch noch nie mit dem Dampfschiff über den Ärmelkanal gefahren. Doch es gab kein Zurück, nicht jetzt, da sie über ihren Vater Bescheid wusste.
Sie fragte sich zerstreut, ob wohl erwartet wurde, dass sie sich zum Abendessen umzog, dann wanderten ihre Gedanken zu ihrem verlassenen Zimmer in der Goose Lane. Es war ein schäbiges Haus gewesen mit verzogenen Fenstern und feuchten Wänden, und zu jeder Zeit roch man, was die anderen Bewohner gerade kochten. Aber sie hatte ihr Zimmer mit ein paar gebrauchten Möbeln, Vorhängen und Teppichen nach ihrem Geschmack eingerichtet, und so hatte sie es doch etwas wehmütig zurückgelassen. Wahrscheinlich war es inzwischen bereits von den anderen Mietern geplündert worden, was sie ihnen nicht übel nahm. Aber sie würde London und George vermissen.
Sie schnappte nach Luft, als ihr einfiel, dass sie in der ganzen Eile und Aufregung keinen einzigen Gedanken an George Ashton verschwendet hatte. Wie hatte das nur passieren können? Es war schrecklich von ihr, ihn sang- und klanglos sitzen zu lassen, nachdem er von der Praxis, bei der er sich vorgestellt hatte, abgelehnt worden war. Noch dazu hatte sie seinen aufrichtigen, aber zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt vorgebrachten Heiratsantrag abgelehnt. Zwar war George ihr in letzter Zeit aus dem Weg gegangen, doch es würde ihn trotzdem kränken, wenn er erfuhr, dass sie ohne ein Wort fortgegangen war, und ganz zu Recht würde er sie für maßlos egozentrisch und lieblos halten.
Unentschlossen sah sie aus dem Fenster, wo die letzten Passagiere den Bahnsteig entlanghasteten. Sie sollte zu ihm gehen oder wenigstens im Krankenhaus anrufen und ihm eine Nachricht hinterlassen. Aber konnte sie aussteigen und ihr Gepäck zurücklassen? Damit würde sie wahrscheinlich nicht nur alles verlieren, was sie besaß, sondern auch ihre Fahrkarte verfallen lassen und das Schiff verpassen. Sie rutschte auf ihrem Sitz nach vorn bis an die Kante, war kurz davor aufzuspringen, aber außerstande, eine Entscheidung zu treffen.
Sie und George hatten sich während ihrer Ausbildung zur Krankenschwester in der Klinik kennengelernt, und obwohl er sechs Jahre älter war als sie, waren sie gute Freunde geworden. Sie hatten ihre knapp bemessene Freizeit miteinander verbracht, indem sie in den Londoner Parks spazieren gingen oder den Crystal Palace besuchten. Sie hatte ihm geholfen, einen Anzug auszusuchen, als er seinen Doktor machte, und er hatte sie zum Essen ausgeführt, nachdem sie die Schwesternprüfung bestanden hatte. Annabelle mochte ihn als Freund herzlich gern, hatte jedoch erst begriffen, dass George in sie verliebt war, als Caroline sie darauf hinwies. Auf seinen unvermittelten Antrag zum falschen Zeitpunkt hatte sie barscher reagiert als beabsichtigt. Sie war noch völlig erschüttert gewesen von ihrer Entlassung am Tag zuvor. Die ganze Zeit hatte sie überlegt, ob sie Carolines Drängen, sie nach Spanien zu begleiten, nachgeben oder ob sie dem Bedürfnis folgen sollte, in London ihren Namen reinzuwaschen. Zudem machte sie sich große Sorgen, wie wohl ihre Zukunft aussah, wenn sie nicht mehr als Krankenschwester arbeiten konnte. Wie hätte sie zu einem solchen Zeitpunkt irgendeine vernünftige Entscheidung treffen können?
Sie riss sich von ihren Gedanken los und sah, wie der Schaffner seine Fahne hob. Die letzte Tür wurde zugeschlagen. Ein schriller Pfiff gellte durch den Bahnhof, und Rauch und Dampf zogen am Fenster vorbei, als sich der Zug in Bewegung setzte. Mit gemischten Gefühlen ließ sie sich gegen die Lehne zurücksinken. Es war zu spät.
Sie unterdrückte ein reumütiges Seufzen und versprach George im Stillen, ihm sofort zu schreiben, sowie sie in Paris eingetroffen wäre. Ihre Freundschaft bedeutete ihr zu viel, um ihn einfach ohne jede Erklärung zurückzulassen.
Während der dreistündigen Zugfahrt nach Dover registrierte Annabelle, dass sie von Leuten vom Typ ihrer Eltern umgeben war, die den ganzen Luxus als selbstverständlich hinnahmen und reichlich blasiert auf all das reagierten, was sie selbst so aufregend fand. Sie verzehrte ein wohlschmeckendes Abendessen – das billigste Gericht auf der Karte –, beschränkte sich auf Mineralwasser und kehrte, nachdem sie noch eine Weile in dem überfüllten, verrauchten Salon zugebracht hatte, in ihr Schlafwagenabteil zurück. Es waren nur wenige Leute ihres Alters im Zug, und sie fühlte sich ein wenig ausgeschlossen, als die anderen angeregt miteinander plauderten und keinerlei Versuche machten, sie einzubeziehen.
Es war herrlich ruhig in ihrem Abteil, und als sie sich ans Fenster setzte und versuchte, in der vorüberziehenden Landschaft Details auszumachen, wurde ihr bewusst, dass es schon fast Mitternacht war und sie bald in Dover eintreffen würde. Nach wie vor war es ihr ein Rätsel, wie der Zug auf das Schiff kommen sollte, denn nur so war es möglich, dass sie hier drinnen schlafen konnte.
Während der Zug durch die Dunkelheit ratterte, wanderten ihre Gedanken zu Caroline und deren Brüdern. Sie hatten erst vor kurzer Zeit fast die gleiche Reise gemacht, auch wenn ihr Ziel Madrid gewesen war und nicht Paris. Annabelle fragte sich, ob sie wohl schon angekommen waren und was für Zustände in dem vom Bürgerkrieg erschütterten Spanien herrschten.
Caroline Howden war von Kindesbeinen an ihre Freundin gewesen. Ihre älteren Brüder, Bertram und Arthur, hatten Annabelle einfach als ein zweites nerviges kleines Mädchen akzeptiert, das ihnen ständig hinterherlief. Irgendwann einmal war sie heftig in Arthur verliebt gewesen, doch zum Glück hatte er nichts davon gemerkt, und so war die Ungezwungenheit zwischen ihnen erhalten geblieben. Und jetzt waren ihre Kindheitsfreunde unterwegs in ein Kriegsgebiet, obwohl sich ihre Eltern nach Kräften bemüht hatten, sie davon abzuhalten. Annabelle konnte nur beten, dass sie alles heil überstanden.
Sie starrte hinaus in die Finsternis und musste an den Abend vor einigen Wochen denken, als sie alle gemeinsam bei den Howdens gegessen hatten. Robert und Philippa waren so gastfreundlich gewesen wie immer, doch der nette Abend war durch eine unschuldige Bemerkung ruiniert worden, die Annabelle über die Menge an Käse und Butter machte, die Arthur auf seinem Brötchen verteilte. Er hatte entgegnet, dass er sich Reserven anfuttern müsse für den Fall, dass es in Spanien keine ausreichenden Rationen gab. Von da an war die Atmosphäre angespannt gewesen.
Als Caroline verkündete, dass auch sie nach Spanien reisen werde, war ihre Mutter in Tränen ausgebrochen, und auch dem Vater war es schwergefallen, seine Erregung im Zaum zu halten. Er hatte eine wortgewaltige, bittere Rede gehalten, die sie alle schockiert und sich in Annabelles Gedächtnis eingebrannt hatte.
»Ich zweifle nicht daran, dass dein Können als Krankenschwester in Spanien gebraucht wird«, hatte er Caroline erklärt, »aber du wirst dort nicht in einem tadellosen Krankenhaus mit frisch bezogenen Betten arbeiten oder auch nur mit der nötigsten Grundausstattung an Geräten und Medikamenten.« Mit seinen braunen Augen hatte er seine Tochter eindringlich gemustert. »Bestenfalls wirst du in einem Zelt auf einem matschigen Acker tätig sein. Chirurgen werden ohne Betäubungsmittel Männer operieren, die von Kugeln und Granaten zerfetzt wurden. Du wirst Menschen sehen, denen Gliedmaßen weggeschossen wurden, denen das halbe Gesicht fehlt und die ihre inneren Organe in der Hand halten, während sie nach ihren Müttern schreien. Und diese Schreie werden dich Tag und Nacht begleiten, Caroline – noch lange, nachdem du wieder nach Hause zurückgekehrt bist.«
Caroline hatte versucht, Einwände zu machen, doch er hatte stur darauf beharrt, es habe sich nichts geändert, seit er im Ersten Weltkrieg Soldat gewesen war. Er hatte über das endlose Sperrfeuer gesprochen, die Angriffe durch feindliche Flugzeuge, den Gestank des Todes und die tragische Sinnlosigkeit, wenn Männer als Kanonenfutter missbraucht wurden, um sich ein Stück Land anzueignen, das binnen Stunden wieder verloren gehen konnte.
Als seine Söhne versuchten, ihn zu beruhigen, war er erst recht in Rage geraten und hatte mit der Faust auf den Tisch geschlagen. »Krieg ist blutig und böse und eine entsetzliche Verschwendung jungen Lebens«, hatte er gebrüllt. »Und es gibt keine ruhmreichen Toten. Die Toten sind tot, und alle Opfer, die sie gebracht haben, werden bald vergessen sein, wenn sich die Friedhöfe wieder füllen.«
Annabelle erschauerte bei der Erinnerung. Seine Worte hallten in ihrem Kopf wider und beschworen die schrecklichsten Bilder herauf. Sie hatte selbst erwogen, mit Caroline nach Spanien zu gehen, doch nach dieser Rede hatte sie es sich noch einmal überlegt und angefangen zu bezweifeln, dass sie jemals tapfer genug wäre, sich solchen Schrecknissen zu stellen. Doch Caroline und ihre Brüder waren standhaft geblieben. Sie wollten die Chance nutzen, ihren Teil zum Kampf gegen den Faschismus beizutragen, und sich der sehr realen Bedrohung eines neuen Weltkriegs entgegenstemmen. Annabelle bewunderte sie dafür.
Ein leises Klopfen an der Tür riss sie aus ihren Gedanken. »Ja?«
»Ihr Steward, Miss.« Er öffnete die Tür. »Alle Passagiere steigen in Dover aus und gehen zu Fuß an Bord der SS Hampton. Ich rate Ihnen, sich warm anzuziehen, Miss. Es kann sehr kalt werden, so nah am Ärmelkanal.«
»Aber ich dachte, ich darf dieses Schlafwagenabteil behalten, bis wir in Paris sind?«
Er lächelte sie an. »Das dürfen Sie auch, Miss. Die Schlafwagen der ersten Klasse gehen alle aufs Schiff, und Sie werden nicht lange warten müssen, bis sie sich wieder zurückziehen können.«
Er schloss die Tür, ehe sie ihm weitere Fragen stellen konnte. »Mein Gott«, flüsterte sie. »Ich kann es kaum glauben.« Da sie sich nicht den kleinsten Moment dieser fantastischen Reise entgehen lassen wollte, zog sie erneut Hut und Mantel an, nahm Handschuhe, Schal und Tasche und schlüpfte wieder in ihre Schuhe. Es mochte zwar schon fast Mitternacht sein, noch dazu nach einem langen, anstrengenden Tag, aber sie war hellwach.
Als sie den Salonwagen betrat, stellte sie fest, dass er fast leer war. Alle waren schon davongeeilt, um sich auf die Ankunft am Hafen vorzubereiten. Sie setzte sich ans Fenster und konnte durch den Rauch aus dem Schornstein der Lokomotive in der Ferne den Hafen und die weißen Klippen von Dover erspähen. Als sich die Räder allmählich langsamer drehten und der Zug mit einem Schnauben zum Stillstand kam, füllte sich der Salonwagen schlagartig mit aufgeregt plappernden Menschen, die entschlossen in Richtung der Türen drängten.
Annabelle blieb hinter dem ersten Ansturm zurück und folgte dann den Leuten hinaus auf den Bahnsteig. Von dort aus strömten die Passagiere der zweiten und dritten Klasse rasch in Richtung ihres Wartesaals. Der Wind blies schneidend vom Meer her, doch die salzige Luft wirkte nach dem Aufenthalt in den stickigen Wagen recht erfrischend, und sie holte tief und lustvoll Atem.
Das riesige Dampfschiff lag am Ende der Bahngleise. Sie vernahm das Rauschen der Wellen und das Kreischen der Möwen über dem Brummen seiner laufenden Motoren. Sie folgte den anderen zum Wartesaal der ersten Klasse, wo sie von Stewards in Empfang genommen wurden, die ihnen Tassen heißer Schokolade reichten, und wärmte sich die Hände an dem Feuer, das heimelig im Kamin flackerte. Neugierig, was als Nächstes passieren würde, trat sie ans Fenster, wo schon bald andere an ihre Seite traten, die diese Reise auch zum ersten Mal machten.
Gespenstisch weiße Möwen flatterten kreischend im Schein der starken Hafenlaternen, welche auch das Schiff beleuchteten, das in einer Art Schleuse zu schwimmen schien. Als das Wasser allmählich das zweite Becken füllte und die Fähre sich langsam senkte, erblickte Annabelle schließlich die Gleise auf beiden Decks.
Die Schleusentore öffneten sich, und die Fähre schob sich dicht ans Ende des Bahnsteigs, so lange, bis die Gleise exakt aufeinandertrafen. Sofort liefen die Hafenarbeiter herbei und wanden dicke Taue um die Poller, um die Fähre festzumachen.
Annabelle und die anderen drängten sich vor den Fenstern, um zuzusehen, wie die Lokomotive abgekoppelt und auf ein Nebengleis gefahren und wie die Waggons der ersten Klasse vom Rest des Zuges getrennt wurden. Schließlich wurden die Waggons einer nach dem anderen über das Gleis aufs Schiff geschoben.
Die Hafenarbeiter schufteten unter lautem Rufen und emsigem Hin- und Herlaufen, doch schließlich schienen die Waggons gleichmäßig auf beiden Seiten des Schiffs verteilt zu sein. Nachdem sie mit Ketten sicher befestigt worden waren, schlossen sich die Schleusentore erneut, und die Fähre hob sich wieder auf Meereshöhe.
»Alles an Bord«, rief der Schaffner. »Passen Sie auf, wo Sie hintreten, Ladies und Gentlemen. Achten Sie auf der Gangway auf festen Halt.«
Unter lebhaftem Geplapper trotteten sie alle wieder hinaus in die kalte, salzige Luft und erklommen vorsichtig die steile Gangway zum Schiff. Dort warteten weitere Stewards darauf, die wenigen Glücklichen mit einem Platz im Schlafwagen in Empfang zu nehmen. Im Vorübergehen erhaschte Annabelle nur einen kurzen Blick auf die Gemeinschaftsabteile. Offenbar würden die weniger Glücklichen auf ihren Sitzen schlafen müssen, doch es gab eine Art Cafeteria, in der man ein Sandwich oder eine Tasse Tee erstehen konnte.
Als der Steward leise die Abteiltür hinter ihr schloss, spähte sie nervös aus dem Fenster in die schwarze Nacht, die nur von den Hafenlichtern durchbrochen wurde. Die See schien ruhig zu sein, doch da sie sich nach wie vor innerhalb der Hafenmauern befanden, mochte das nicht viel heißen, und Annabelle hatte keine Ahnung, ob sie sich als seefest erweisen würde oder nicht.
Bis zur Wasseroberfläche schien es unendlich tief hinunter zu gehen, und in einem plötzlichen Aufwallen von Panik suchte sie nach der Schwimmweste, die sie schließlich ordentlich verstaut unter ihrem Bett fand. Sie fühlte sich nicht besonders sicher. Wenn die See rau war, würden die Waggons doch bestimmt gefährlich ins Wanken geraten, obwohl sie von schweren Ketten gehalten wurden, oder?
Sie zog entschlossen die Jalousie herunter und machte sich bettfertig. Wenn sie über alles nachgrübelte, was schiefgehen konnte, würde sie nie in den Schlaf finden. Außerdem, so sagte sie sich, fuhren die Fähren schon seit Jahren ohne jeden Unglücksfall hin und her.
Als sie schließlich in ihrem schmalen Bett lag, hörte sie die Rufe der Männer am Kai und das Rumpeln der großen Dampfmaschinen unter Deck. Mit einem Fauchen aus dem Schornstein setzte sich das Schiff in Bewegung. Als es begann, sich zu heben und zu senken, begriff sie, dass sie die Hafenmauern hinter sich gelassen hatten und jetzt die bewegte See des Ärmelkanals durchpflügten.
Annabelle entspannte sich langsam, bis die Bewegung des Schiffs ihre Ängste vertrieb. Kaum hatte sie sich in die warmen Decken gekuschelt, forderte der anstrengende, aufwühlende Tag seinen Tribut, und sie schlief ein.
Die Schritte der Menschen, die durch den engen Korridor des Waggons hasteten, weckten sie. Sie setzte sich auf und reckte sich genüsslich, ehe sie feststellte, dass es noch früh am Morgen war. Sie hatte aber in diesen wenigen Stunden einen erholsamen Nachtschlaf genossen und war nun bereit für den nächsten Teil ihrer Reise.
Annabelle schlüpfte in ihren Morgenmantel, schob die Jalousie hoch und blinzelte in die aufgehende Sonne, die bereits auf dem Wasser glitzerte. Das Meer war glatt und glasklar, und die weiße Kielwelle des Schiffs kräuselte sich träge über dem Blau.
Ein diskretes Klopfen an der Tür ertönte, und eine Stewardess trat mit einem großen Tablett ein, das sie auf den kleinen Tisch am Fenster stellte. »Wir legen erst in einer Stunde an«, erklärte sie mit einem freundlichen Lächeln. »Sie brauchen sich mit Ihrem Frühstück also nicht zu beeilen.«
Annabelle erwiderte ihr Lächeln und setzte sich an das Tischchen. Als sie die silbernen Hauben von den heißen Platten hob, fand sie Rührei, gebratenen Speck, Toast und warme Croissants. Dazu gab es eine Kanne Tee mit Milch oder Zucker und Zitronenscheiben sowie kleine Schälchen mit Orangen- und Erdbeermarmelade. Ihr lief das Wasser im Mund zusammen, und sie merkte erst, als sie zu essen begann, wie hungrig sie war. Die Eier waren locker, der Speck knusprig – genau wie sie es mochte – und das Croissant so zart, dass es ihr auf der Zunge zerging.
Nachdem sie sich satt gegessen hatte, wusch sie sich und zog sich für die Weiterreise an, ehe sie an Deck ging, um einen ersten Blick auf die französische Küste zu werfen. Mittlerweile war es heller geworden, und so erkannte sie einen langen Streifen Strand, sandige Dünen und kleine Häuser dicht am Ufer, wo bereits die ersten Fischerboote die Segel setzten in der Hoffnung auf einen frühen Fang.
Da gerade Hochwasser herrschte, musste sich die Fähre nicht der Prozedur mit der Schleuse unterziehen und darauf warten, dass sie den entsprechenden Wasserpegel erreichte, sondern konnte direkt am Kai anlegen. Annabelle und die anderen Passagiere folgten der Anweisung, das Schiff zu verlassen, und sahen zu, wie die Erste-Klasse-Waggons vom Schiff rollten und an die wartende Lokomotive angehängt wurden. Sobald sämtliche Wagen an Ort und Stelle waren, stiegen alle ein.
Viele der Passagiere kehrten in ihre Schlafabteile zurück, doch Annabelle war viel zu aufgeregt, um zu schlafen, und außerdem entschlossen, sich keine Minute dieses außergewöhnlichen Abenteuers entgehen zu lassen. Sie ergatterte einen Fensterplatz im Salon, und als sich die großen Eisenräder zu drehen begannen und der Rauch aus dem Schornstein der Lokomotive stieg, blickte sie auf die Landschaft Frankreichs hinaus.
Die Gegend erinnerte sie an die südlichen Grafschaften Englands, denn es gab nur wenige Hügel, stattdessen vorwiegend flaches Ackerland. Ab und zu tauchte ein Dörfchen auf. Manchmal wurde sie deutlich daran erinnert, dass sie in Frankreich war, wenn sie durch Orte fuhren, in denen sich die unvermeidlichen Kirchtürme über dicht gedrängten roten Ziegeldächern erhoben. Es gab breite Streifen gepflügter Felder sowie einsame Scheunen und Bauernhäuser aus hellem Stein, Reihen hoher, schlanker Pappeln und undurchdringlich wirkende dunkle Wälder.
Annabelle fand alles hinreißend und winkte fröhlich den Kindern zu, die aus den Häusern kamen und dem Zug nachsahen. Sie sah andere Kinder auf ihrem Schulweg, Nonnen, die aus einer Kirche traten und deren Hauben wie große weiße Flügel leuchteten, und Hausfrauen auf dem Heimweg vom Bäcker, lange Baguettestangen unter dem Arm. Es war alles so typisch französisch. Mit seinem weiten Horizont und dem endlosen Himmel wirkte das Land fremd, dennoch hatte Annabelle das Gefühl, dass es ihr hier gefallen würde.
Je mehr sich der Zug Paris näherte, desto hektischer wurde die Atmosphäre, und die Leute redeten lauter, während sie nach verlorenen Handschuhen suchten und sich auf die Ankunft vorbereiteten. Annabelle kehrte in ihr Schlafwagenabteil zurück, packte Nachthemd und Waschbeutel ein und vergaß auch nicht, ein Trinkgeld für die Stewards liegen zu lassen. Da sie lediglich zwei leichte Koffer hatte, brauchte sie niemanden um Hilfe zu bitten, sondern trug sie einfach selbst in den Salonwagen und stellte sie neben sich ab.
Der Schaffner kam und verkündete, dass sie in fünf Minuten ankommen würden, und Annabelles Herz begann vor Aufregung und Angst zu klopfen. Sie hatte schon viel von Tante Aline gehört, sie aber nie kennengelernt. Nach nur drei Jahren Ehe verwitwet war sie erst vierzig Jahre alt und führte Camille zufolge ein liederliches Lotterleben als Künstlerin. War Aline wirklich eine solche Bohemienne, wie ihre Mutter behauptete? Hatte sie tatsächlich das Haus voller Schriftsteller, Dichter, Musiker und Künstler – und wäre Annabelle dort überhaupt willkommen?