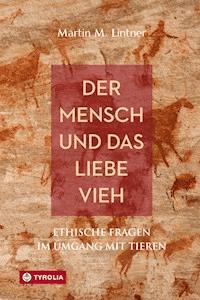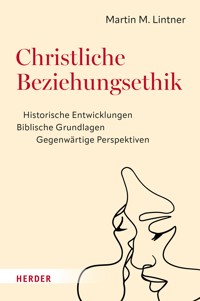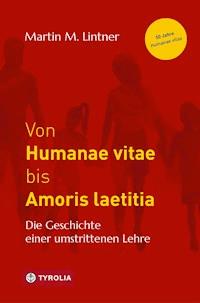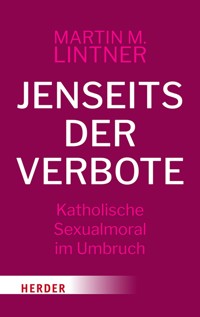
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Im Rahmen der Weltsynode forderte Papst Franziskus eine Neuausrichtung der christlichen Morallehre: »Das Zentrum der christlichen Moral ist die Liebe (...) Am Ende zählt nur die Liebe.« Der renommierte Moraltheologe Martin M. Lintner hebt auf dem Hintergrund seiner umfangreichen »Christlichen Beziehungsethik« (2023) für eine breite Leserschaft drei brisante Aspekte hervor: die Frage nach dem Umgang mit der Genderforschung, die Missbrauchskrise und den »Primat der Liebe«. Wie kann sich die Kirche dazu verhalten? Gibt es eine echte Neuausrichtung?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
Martin M. Lintner
Jenseits der Verbote
Katholische Sexualmoral im Umbruch
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025Hermann-Herder-Str. 4, 79104 FreiburgAlle Rechte vorbehaltenwww.herder.de
Die Bibel wird nach der Elberfelder Übersetzung (Edition CSV Hückeswagen) zitiert (online: www.csv-bibel.de). Die Schreibweise biblischer Personen- und Ortsnamen folgt ebenso dieser Übersetzung.
Covermotiv und -gestaltung: Verlag Herder
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster
ISBN (Print) 978-3-451-03465-7ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83466-0
Inhalt
Verlorenes Vertrauen wiedergewinnen
Die wunderbare und komplexe Wirklichkeit der Sexualität
Crashkurs – erster Teil: Hypotheken der herkömmlichen Lehre
Was sagt die Bibel über die Sexualität?
Crashkurs – zweiter Teil: Warum die Kirche seit ihren Ursprüngen die Ehe schützt
Was sagt das Neue Testament über die Ehe?
Crashkurs – dritter Teil: die Würde der Person im Mittelpunkt
Heute Mann, morgen Frau, übermorgen divers? Oder: Was die Genderstudien wirklich sagen
Jenseits der Verbote, oder: Am Ende zählt allein die Liebe
Über den Autor
Über das Buch
Verlorenes Vertrauen wiedergewinnen
Es war ein spätsommerlicher Septembermorgen. Wenige Monate nach meiner Priesterweihe im Juni 2001 trat ich in der Servitenpfarre im neunten Wiener Gemeindebezirk meine Aufgabe als Kaplan an. Nach dem Gottesdienst trat ich auf den sonnigen Platz vor der Kirche, um den Kirchenbesucherinnen und -besuchern einen schönen Tag zu wünschen. Da erblickte mich von der anderen Seite des Kirchenplatzes her eine Frau, ca. 60 bis 65 Jahre alt. Sie schoss auf mich zu und begann, mich zu beschimpfen. Es war die Zeit, als erneut schwere Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Kardinal Hans Hermann Groër, den ehemaligen Wiener Erzbischof, öffentlich bekannt geworden sind. Ich erlebte zum ersten – und nicht zum letzten – Mal, wie es sich anfühlt, als Priester bzw. Ordensmann unter den Generalverdacht gestellt zu werden, ein »Kinderschänder« zu sein. Nach einem Moment der Sprachlosigkeit versuchte ich, mit der Frau ins Gespräch zu kommen. Sie beruhigte sich. »Bitte verstehen Sie mich«, sagte sie, »ich bin von der Kirche maßlos enttäuscht.« Dann schilderte sie mir in wenigen Sätzen ihre Lebenssituation. Dass sie in Scheidung von ihrem Mann lebe, der ihr nach über 30 Ehejahren und drei gemeinsamen Kindern offenbarte, dass er homosexuell sei und sich nun an seinen Partner binden möchte. Ihr Mann habe ihr erzählt, dass er sich in seiner Jugendzeit einem Seelsorger anvertraut habe. Dieser riet ihm zu heiraten, dann würde alles gut werden. Also heiratete er, lebte aber in all den Jahren im Geheimen eine homosexuelle Beziehung. Seine Frau habe er nie begehrt, auch nicht wirklich geliebt. Die Ehe sei für ihn eine Fehlentscheidung gewesen. Die Frau fühlte sich von der Kirche betrogen. Wut und Ärger überkamen sie, als sie mich, einen jungen Priester, vor der Kirchentür stehen sah. »Einer wie Sie hat mich um mein Familienglück gebracht.« Ich habe diese Frau nie mehr gesehen, aber diese Begegnung ist mir nicht mehr aus dem Sinn gegangen.
In meinem langjährigen Wirken als Seelsorger bin ich vielen Menschen begegnet, die mir von ihrer Enttäuschung und ihrer Wut über die Kirche erzählt haben. Davon, wie sehr sie sich von der Kirche verletzt, unverstanden, diskriminiert, verurteilt fühlen. Paare, die sich wegen des kirchlichen Verbots der künstlichen Empfängnisverhütung mehr und mehr von der Kirche entfremdet haben. Wiederverheiratete Geschiedene, die als Gescheiterte angesehen wurden und vom Kommunionempfang ausgeschlossen waren. Ältere Ehegatten, die »Missbrauch der Ehe« gebeichtet haben, weil sie körperliche Zärtlichkeit und sexuelle Intimität auch nach den Wechseljahren lustvoll genossen haben. Personen, die zeit ihres Lebens damit gerungen haben, dass die Kirche Selbstbefriedigung als schwere Sünde verurteilt, und die bis ins hohe Alter unter Schuldgefühlen und Selbstwertproblemen gelitten haben, weil sie von ihr nicht losgekommen sind. Homosexuelle oder Transpersonen, die ihre sexuelle Identität verheimlichten aus Angst, abgelehnt und diskriminiert zu werden. Eltern von homosexuellen oder transidenten Kindern, die sich neben der Herausforderung, wie sie damit in der Familie und in ihrem sozialen Umfeld umgehen sollten, nicht nur fragten, wie sie ihr Kind bestmöglich unterstützen können, sondern auch die Sorge hatten: Was wird wohl der Pfarrer dazu sagen? Menschen, die nach bestem Wissen und Gewissen versucht haben, ihr Leben zu gestalten, aber – oft aus komplexen und verworrenen Gründen, wie sie das Leben kennt – nicht den Normen der Kirche entsprochen haben.
Ich habe den enormen Leidensdruck dieser Menschen gespürt. Sie haben von Angststörungen und psychosomatischen Beschwerden bis hin zu Suizidgedanken berichtet. Und bei gläubigen Personen schwang oft die Frage mit: Warum akzeptiert mich die Kirche nicht so, wie ich bin? Oder: Wird Gott unser Kind ablehnen? Um nicht missverstanden zu werden: Es geht nicht darum, jegliche Lebenssituation einfach undifferenziert gutzuheißen, sondern vielmehr darum, was Papst Franziskus in seinem Nachapostolischen Schreiben über die Liebe in der Familie Amoris laetitia (2016) treffend formuliert: »Wir tun uns […] schwer, dem Gewissen der Gläubigen Raum zu geben, die oftmals inmitten ihrer Begrenzungen, so gut es ihnen möglich ist, dem Evangelium entsprechen und ihr persönliches Unterscheidungsvermögen angesichts von Situationen entwickeln, in denen alle Schemata auseinanderbrechen. Wir sind berufen, die Gewissen zu bilden, nicht aber dazu, den Anspruch zu erheben, sie zu ersetzen« (Nr. 37).
Die Mitglieder der deutschen Sprachgruppe haben bei der Bischofssynode 2015 folgendes Schuldbekenntnis formuliert: »Im falsch verstandenen Bemühen, die kirchliche Lehre hochzuhalten, kam es in der Pastoral immer wieder zu harten und unbarmherzigen Haltungen, die Leid über Menschen gebracht haben, insbesondere über ledige Mütter und außerehelich geborene Kinder, über Menschen in vorehelichen und nicht ehelichen Lebensgemeinschaften, über homosexuell orientierte Menschen und über Geschiedene und Wiederverheiratete.« Müssen wir nur die harten und unbarmherzigen Haltungen, die Leid über Menschen gebracht haben, ändern, oder gilt es auch, die kirchliche Lehre kritisch in den Blick zu nehmen, die solche Haltungen gefördert hat?
Beispiele dafür, welchen Schwierigkeiten ledige Mütter und außerehelich geborene Kinder begegnet sind, finden sich in vielen Familiengeschichten. So auch in der von Papst Benedikt XVI. Seine Großmutter mütterlicherseits musste ihre Südtiroler Heimat verlassen, nachdem sie ledig schwanger geworden war. Dies galt gemeinhin als Schande für eine Familie und die betroffene Frau, auch wenn die Taufbücher jener Zeit zeigen, dass ledige Schwangerschaften gar nicht so selten vorkamen. Auch sie selbst, die Großmutter, war ein uneheliches Kind, wurde jedoch nach der Hochzeit ihrer Eltern, zweieinhalb Jahre nach ihrer Geburt, vom Vater legitimiert und erhielt dessen Familiennamen. Sie galt somit als eheliches Kind. Als junge Schwangere verließ sie nun ihre Familie und zog nach Bayern. Dort fand sie im Haus einer Familie Aufnahme, die ihre Türen bewusst ledigen schwangeren Frauen öffnete, und brachte ihre Tochter Maria zur Welt, die Mutter des späteren Papstes Benedikt XVI. Zwar heiratete sie einundeinhalb Jahre später – übrigens einen Mann, der auch ein uneheliches Kind war –, aber die Tochter behielt den Familiennamen ihrer Mutter, da sie vom Stiefvater nicht legitimiert bzw. als eigenes Kind anerkannt worden war. Eine »illegitime« Geburt stellte nach damaligem Kirchenrecht jedoch ein Ehehindernis dar. Deshalb wäre die Heirat von Maria mit Joseph Ratzinger, dem Vater des späteren Papstes, fast geplatzt, als der Pfarrer bei der Ehevorbereitung im Taufbuch bei der Braut entdeckte, dass kein Vater angeführt, stattdessen »illegitim« vermerkt war. Das Problem konnte nur gelöst werden, indem die Mutter kurz vor der Hochzeit ihrer Tochter erklärte, sie sei die voreheliche Tochter ihres Ehegatten. Er habe es unabsichtlich verabsäumt, sie nach der Eheschließung zu legitimieren. Da dieser bereits mehrere Jahre zuvor verstorben war, konnte er nicht mehr selbst dazu befragt werden.
Eine uneheliche und nicht legitimierte Geburt galt übrigens nicht nur als Ehehindernis, sondern bis Inkrafttreten des Codex des kanonischen Rechts von 1983 auch als Weihehindernis, und zwar »ex defectu«. Das bedeutet, dass sie als ein Mangel angesehen wurde, der den davon Betroffenen als unwürdig erscheinen lässt, die Weihe zu empfangen – und zwar ganz unabhängig davon, dass kein Kind etwas dafürkann, unter welchen Umständen es geboren wurde. Für die Priesterweihe bedurfte es einer hoheitlichen Dispens, das heißt einer Ausnahmebewilligung durch den Ortsbischof. Falls sie gewährt wurde, dann in der Regel nur mit der Auflage, dass die Primiz, das heißt die erste Eucharistiefeier des neu geweihten Priesters in seiner Heimatpfarre, die besonders festlich begangen wird, in einem schlichten Rahmen zelebriert werden musste.
Noch ein letztes Beispiel möchte ich anführen: den Ritus der Aussegnung einer Wöchnerin. In der Regel durfte eine Mutter vier bis sechs Wochen lang nach der Geburt eines Kindes weder am öffentlichen noch am kirchlichen Leben teilnehmen. Was ursprünglich wohl Wurzeln im volkstümlichen Aberglauben oder in Vorstellungen kultischer Reinheit hatte, hatte auch eine ganz praktische Bedeutung: Die Wöchnerin konnte sich schonen und war von der Sonntagspflicht ebenso wie von der häuslichen Arbeit entbunden, um sich von den körperlichen und psychischen Strapazen der Geburt zu erholen. Doch dies war nur die eine Seite der Medaille – die andere war, dass die Wöchnerin aufgrund der Empfängnis und Schwangerschaft als sittlich befleckt galt. Jedenfalls empfing sie im Ritus der Aussegnung nicht nur einen besonderen Segen, in welchem der Dank für das Geschenk des Kindes mit der Bitte um Schutz für Mutter und Kind verbunden wurde. In vielen Gebetsvorlagen wurde ausdrücklich um Vergebung gebeten für die Sünde, in welcher die Mutter ihr Kind empfangen hat. Damit war nicht nur die Erbschuld gemeint, sondern explizit auch das Empfinden sexueller Lust bei der Zeugung des Kindes. In meinem seelsorglichen Wirken bin ich älteren Frauen begegnet, die erzählt haben, wie demütigend dieser Ritus auf sie gewirkt hat. Ledigen Müttern wurde die Aussegnung übrigens verwehrt.
Kehren wir zurück in die Gegenwart. Als ich 2009 den Lehrstuhl für Moraltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen übernahm, wurde auch in Deutschland das Ausmaß des kirchlichen Missbrauchsskandals deutlich. Klaus Mertes, der damalige Rektor des Canisius-Kollegs in Berlin, eines Jesuitengymnasiums, trat nach Bekanntwerden von sexuellen Übergriffen im Kolleg an die Öffentlichkeit und rief ehemalige Schüler auf, sich zu melden, wenn sie Missbrauch erlitten hätten. Eine Eiterbeule war geplatzt. Immer dringlicher wurde die Frage gestellt: Wer trägt Verantwortung dafür, dass es zu diesem bis dahin kaum vorstellbaren und unerträglichen Ausmaß an sexuellem Missbrauch in kirchlichen Kontexten kommen konnte? An den Pranger gestellt wurde auch die katholische Sexualmoral. Auch wenn sie seit jeher sexuelle Handlungen an Kindern und Jugendlichen als schwerwiegende Verfehlungen abgelehnt und verurteilt hat, bildete sie insgesamt doch den normativen Rahmen, der für viele Menschen ganz offenkundig nicht förderlich war, einen verantwortungsvollen Umgang mit ihrer Sexualität einzuüben. Auch für jene nicht, die sie gelehrt und in der Seelsorge vertreten haben. Ein Journalist warf meiner Zunft vor: »Die Moraltheologie hat versagt, die Sexualethik zeitgemäß zu erneuern.« Ich habe mit Kolleginnen und Kollegen »älteren Semesters« darüber diskutiert. Und wieder stieß ich auf Wut und Verbitterung. »Wir hätten gerne beigetragen, die kirchliche Sexuallehre zu erneuern, aber viele von uns wurden von Rom diszipliniert und gemaßregelt, sobald sie sich zu sexualethischen Fragen geäußert und kritisch Stellung zur kirchlichen Lehre bezogen haben«, lautete der Grundtenor.
Damals habe ich die Entscheidung getroffen, mich des Themas anzunehmen. Was kann mein Beitrag sein, die Sexualmoral der Kirche zu erneuern, ohne sie besserwisserisch abzulehnen oder plattitüdenhaft als verschroben und sexualfeindlich zu kritisieren? Nicht alles muss neu erfunden, vieles aber neu justiert werden. Entwicklungen, die aus heutiger Perspektive problematisch oder falsch sind, sind zu benennen und zu überwinden. Um diese Aufgabe leisten zu können, bedarf es einer eingehenden Auseinandersetzung mit den historischen Entwicklungen und ihren oftmals in Vergessenheit geratenen soziokulturellen Hintergründen und philosophischen Vorannahmen und Denkmodellen, die heute vielfach ihre Plausibilität und Überzeugungskraft eingebüßt haben. Und schließlich gilt es, das Wissen, das wir heute im Unterschied zu früheren Generationen über den Menschen und seine Sexualität haben, in die ethische Reflexion zu integrieren.
Im Buch Christliche Beziehungsethik. Historische Entwicklungen – Biblische Grundlagen – Gegenwärtige Perspektiven (Herder 2023) konnte ich meine Forschungen und Publikationen aus über einem Jahrzehnt in einen systematischen Entwurf einer erneuerten Sexualmoral und Beziehungsethik integrieren. Es ist ein umfangreiches wissenschaftliches Werk geworden mit Hunderten Fußnoten und Dutzenden Seiten Bibliografie. Von mehreren Seiten wurde der Wunsch an mich herangetragen, einige wesentliche Inhalte in einer kürzeren Fassung für ein breiteres Publikum aufzubereiten. Das Ergebnis ist das vorliegende Buch. Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit verzichte ich auf einen wissenschaftlichen Fußnotenapparat und auf Quellen- sowie weiterführende Literaturangaben. Wer daran Interesse hat oder einzelne Themen vertiefen möchte, wird in der Christlichen Beziehungsethik fündig.
Während ich die Christliche Beziehungsethik den Kolleginnen und Kollegen gewidmet habe, die sich seit Jahrzehnten für eine Erneuerung der kirchlichen Sexualmoral und Beziehungsethik einsetzen und den Boden hierfür bereitet haben, möchte ich das vorliegende Buch den Menschen widmen, die sich mir anvertraut haben und von denen ich weiter oben geschrieben habe. Möge diese Schrift helfen, verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen.
Die wunderbare und komplexe Wirklichkeit der Sexualität
Beginnen wir mit der Frage: Wovon reden wir, wenn wir über die Sexualität sprechen?
Die Sexualität ist etwas Persönliches und Intimes. Sie berührt die tiefsten Gefühle, Bedürfnisse und Sehnsüchte eines Menschen. Leiblich wie seelisch. Sie ist in die Leiblichkeit eingeschrieben und zugleich unlösbar mit emotionalen und psychischen Empfindungen verbunden. Sie prägt das Selbstverständnis eines Menschen, sein Verhältnis zu sich selbst und zu seinem Körper. Sie prägt aber auch seine Fremdwahrnehmung, und zwar in einem zweifachen Sinn: Erstens, wie möchte jemand von den anderen wahrgenommen werden? In welcher Form betont oder verbirgt jemand die eigene Männlichkeit bzw. Weiblichkeit, beispielsweise durch Kleidung, Gestik, Körperhaltung und -bewegung usw.? Zweitens, wie wird jemand tatsächlich von den anderen wahrgenommen? Entspricht es dem Selbstkonzept der wahrgenommenen Person bzw. der Art und Weise, wie sie sich selbst präsentiert? Kommt jemand mit den Rollen und Erwartungen, die ihm bzw. ihr vom sozialen Umfeld zugeschrieben werden, zurecht? In welchem Maß kann er bzw. sie sich mit ihnen identifizieren? Die Rückmeldungen, die jemand von seinem sozialen Umfeld erhält, bzw. die Wirkung, die jemand auf die anderen hat, haben wiederum einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Selbstkonzepts eines Menschen und prägen sein Denken, Fühlen und Verhalten mit.
In den zwischenmenschlichen Beziehungen spielt Sexualität eine wesentliche Rolle. Nicht nur in den intimen und sexuellen Beziehungen. Die soziokulturellen Kontexte sind unausweichlich davon geprägt, dass das einzelne Individuum nicht unabhängig von seiner Geschlechtsidentität wahrgenommen wird. Es gibt historisch gewachsene, kulturell ausgeformte und biografisch geprägte geschlechterbezogene Rollen und Stereotype, denen sich kein Mitglied einer Gesellschaft entziehen kann, selbst wenn es versucht, sich kritisch dazu zu verhalten oder sich von ihnen zu distanzieren, weil es sich mit ihnen nicht identifizieren kann.
Weiter unten werden diese Einsichten aus den Genderstudien noch näher erläutert, an dieser Stelle sei nur das Folgende vorweggenommen: Unser Verhalten zum anderen Menschen ist davon geprägt, ob wir ihn als Mann oder Frau wahrnehmen. Dies geschieht in der Regel bereits ab dem Moment der Geburt. Wir behandeln Kinder unterschiedlich, je nachdem, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Die französische Philosophin Simone de Beauvoir hat den Satz geprägt: »Man wird nicht als Frau geboren, man wird es.« Damit brachte sie zum Ausdruck, dass Frausein – bzw. auch Mannsein – nicht nur durch das anatomische Geschlecht bestimmt wird, sondern dass die Geschlechtsidentität eines Menschen wesentlich mehr ist. Was unter Frau- bzw. Mannsein verstanden wird, hängt von gesellschaftlichen und kulturellen Faktoren ab und verändert sich im Lauf der Geschichte. Die Entwicklung des persönlichen Selbstverständnisses eines Menschen als Mann oder Frau ist unhintergehbar auch dadurch geprägt, wie ein Mensch als Kind und Jugendlicher von seinem Umfeld behandelt worden ist und welche Zuschreibungen er erfahren hat. In diesem Sinn kann vom Geschlecht als einer »sozialen Konstruktion« gesprochen werden, weil eben jede Gesellschaft und Kultur ganz bestimmte Vorstellungen davon hat, worin Frau- bzw. Mannsein idealtypischerweise besteht.
Die soziokulturellen Kontexte sind unausweichlich davon geprägt, dass das einzelne Individuum nicht unabhängig von seiner Geschlechtsidentität wahrgenommen wird.
Nicht zuletzt deshalb, weil sich rein empirisch gesehen die deutliche Mehrheit der Menschen heute wie in der Vergangenheit als Mann oder Frau identifiziert, haben sich als Fundament des gesellschaftlichen Zusammenlebens die grundlegenden Geschlechtskategorien »männlich« und »weiblich« gebildet. Erfordernisse wie jene von Geschlechtergerechtigkeit werden überhaupt erst auf diesem Hintergrund plausibel. Die Annahme der Binarität Mann – Frau, das heißt der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen, hat dazu geführt, dass die ausschließliche Zugehörigkeit eines Menschen zu einem der beiden Geschlechter als naturgegeben bzw. – religiös gedeutet – als schöpfungsgemäß vorausgesetzt worden ist. Es gibt nur wenige Kulturen, die das Vorhandensein von mehr als zwei Geschlechtern kennen. So werden bei einigen indigenen Stämmen in Kanada Menschen als Berdache bzw. als Two-Spirits bezeichnet, deren Geschlechtsidentität nicht deutlich männlich oder weiblich ist oder die als Männer weiblich konnotierte Aufgaben und umgekehrt übernehmen. In der gebirgigen Region Nordalbaniens gibt es Frauen, sogenannte Burrnesha, das heißt »Schwurjungfrauen«, die versprechen, ehelos und enthaltsam zu leben. Im Gegenzug dürfen sie in ihren Familien und Dörfern die Rollen von Männern übernehmen und genießen den sozialen Status eines Mannes, der wesentlich besser ist als jener von Frauen. Sie wirken nicht nur aufgrund ihrer Kleidung und ihres Verhaltens männlich, sondern nehmen mit der Zeit auch körperlich männliche Züge an. Auch bei indigenen Stämmen auf Hawaii sind mehrere Geschlechter bekannt. In Thailand gibt es die Bezeichnung Kathoey für Männer und Frauen, die von ihren jeweiligen geschlechtsspezifischen Normen und Rollenbildern sichtlich abweichen. Sie wird auch auf homosexuelle, intersexuelle oder transidente Personen bezogen. Diese Kulturen haben über Jahrhunderte ein Bewusstsein dafür tradiert, dass es eine Vielfalt von Geschlechtsidentitäten gibt und dass die Annahme einer ausschließlichen Binarität von Mann und Frau nicht alle Menschen einschließt. Auf diese mögliche Vielfalt an Geschlechtsidentitäten, auf die Differenzierung zwischen biologischem Geschlecht und sozialen Geschlechterrollen sowie auf die komplexe Entwicklung der individuellen Geschlechtsidentität wird weiter unten noch näher eingegangen.