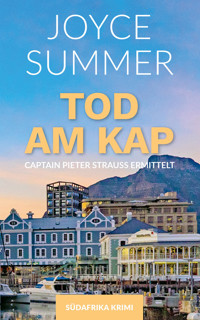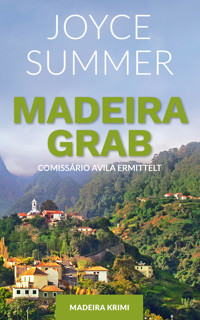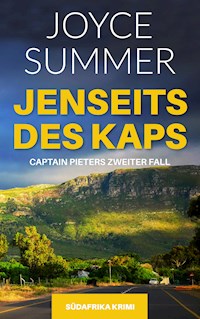
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
BLÜHENDE TÄLER, BLUTENDE ERDE Nichts zieht Captain Pieter Strauss nach Hause ins südafrikanische Elgin Tal. Seit einem Streit vor sechzehn Jahren sprechen er und sein Vater Zef kaum ein Wort mehr miteinander. Da wird die Leiche einer jungen Aktivistin, die den weißen Farmern den Kampf angesagt hat, im alten Wasserspeicher der Strauss’ Farm gefunden. Die örtliche Polizei hat bereits einen Verdächtigen inhaftiert: Zef Strauss. Pieter eilt seinem Vater aus Kapstadt zur Hilfe, auch wenn er selbst von dessen Unschuld nicht überzeugt ist. Schnell verfängt er sich in einem Netz aus alten Konflikten, verzweifelten Aufständen und blutigen Morden. Der zweite Fall für Captain Pieter am Kap der Verlorenen Hoffnung. Der Rugby spielende Captain ermittelt weiter im neuen Südafrika Krimi vom Western Cape.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
JOYCE SUMMER
JENSEITS DES KAPS
Kriminalroman
Impressum
Copyright © August 2021 Joyce Summer
2. Überarbeitete Auflage Juni 2022
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors wiedergegeben werden.
Autor
c/o autorenglück.de
Franz-Mehring-Str. 15
01237 Dresden
www.joycesummer.de
Umschlaggestaltung: © 2021 Joyce Summer
Bereits erschienen:
Mord auf der Levada – Paulines erster Fall
Malteser Morde – Paulines zweiter Fall
Paulines Weihnachtszauber – Eine weihnachtliche Kurzgeschichte
Madeiragrab – Comissário Avilas erster Fall
Madeirasturm – Comissário Avilas zweiter Fall
Madeiraschweigen – Comissário Avilas dritter Fall
Tod am Kap – Captain Pieter Strauss ermittelt
Personenverzeichnis
SAPS – South African Police Service
Captain Pieter Strauss – Chef der Mordkommission der Valke (Hawks), einer Sondereinheit der SAPS und begeisterter Rugbyspieler
Clyde de Jongh – Warrant Officer unter Pieter und sein Stellvertreter
Captain Jan (Jakkals) Mulder – Chef der Kommission zur Bekämpfung von Bandenkriminalität der Valke, Pieters bester Freund und ebenfalls Rugbyspieler
Sergeant Unathi Zama – ebenfalls Mitarbeiter von Pieter, würde gerne Profiler werden
Thomas O’Sullivan – irischer Ballistiker bei den Valke (Hawks) und Whiskeyexperte
Colonel Mandisa Dikela – neue Chefin von Pieter, vom Stamme der Xhosa
Elgin-Tal
Zef Strauss – Vater von Pieter und Eigentümer von »Groen Uitsig« im Elgin-Tal
Imke Strauss – Pieters Mutter
Andries Visser – Chef der Bürgerwehr und Jugendfreund von Pieter, ebenfalls Farmer
Conrad Januarie – Vorarbeiter in »Groen Uitsig«
Tansey Januarie – Tochter von Conrad
Lionel Ndala – Ex-Freund von Tansey
Quinton – Ziehsohn von Conrad
Sakkie van der Linden – ebenfalls Farmer, Patenonkel von Pieter
Danie Phosa – Regional Secretary in einer örtlichen Parteizentrale
Lieutenant Phosa – Polizeichef in Bekouw und Vater von James
Marcel Pienaar – Mitglied der Bürgerwehr, von besonders großer Gestalt
Robey de Beer – Mitglied der Bürgerwehr
Caroline de Beer – Tochter von Robey de Beer, Jugendfreundin von Pieter Brenda – Haushaltshilfe von Imke Strauss
Weitere Personen
Lieutenant James Selebi – Chef der SAPS in Stellenbosch
Victoria van Rensburg – Farmerin in Stellenbosch
Stephan Grünwald – Ehemann von Victoria, ehemaliger Inhaber einer Softwarefirma
Emma Kolisi – früheres Mitglied in Pieters Team, Dozentin für Waffenkunde in Paarl
Otto Bakker – Mitglied der Farmwatch in Paarl, außerdem im AfriForum organisiert
Prolog
Ein kalter Windzug schlich sich in ihre am Hals geöffnete Daunenjacke. Tansey Januarie lief ein Schauer über den Rücken und sie beeilte sich, den Reißverschluss bis unter das Kinn hochzuziehen. Der Winter schickte seine frostigen Vorboten in das Elgin-Tal. Bald würden die ersten Regenschauer kommen. Schon jetzt meinte sie, die anrückende Feuchte in der Luft zu riechen. Tansey ärgerte sich, dass sie sich nur Plakkies angezogen hatte. Die nackten Zehen in den offenen Schuhen würden heute Nacht, wenn sie zurückkam, sicher kalt wie Eis sein. Überhaupt sahen die Flipflops zu den orange-roten Hosen ihrer Parteiuniform albern aus. Feste Armeestiefel wären die passendere Wahl gewesen. Der Wind hatte mittlerweile ein anderes Opfer gefunden und spielte mit den Ästen der über ihr aufragenden Apfelbäume. Ein empörtes Knarzen des alten Holzes war die Antwort.
Aus Richtung der Farm hörte sie das kurze dumpfe Bellen einer der Hunde. Das machte ihr keine Angst. Diese Hunde kannten sie, seitdem sie klein war, und bedeuteten keine Gefahr für sie. Anders verhielt es sich mit den Tieren des Nachbarfarmers. Sie musste vorsichtig sein, dass sie im Dunkeln nicht eine falsche Abzweigung nahm. Heute hatte sie bewusst den Weg zwischen den Bäumen gewählt, anstatt die mit Kies belegte Zufahrtsstraße entlangzugehen, um möglichst unbemerkt von der Farm zu schleichen. Umso schwieriger war es, den richtigen Weg zu finden und nicht auf dem Gebiet der Nachbarfarm zu landen. Die zwei großen Boerboels von Robey de Beer würden sich darüber freuen. Tansey schüttelte sich. De Beer verkörperte alles, was sie hasste. Sie war sich sicher, dass er seine Viecher auf Schwarze abrichtete. Wie sonst ließe sich erklären, dass die mächtigen Kiefer seiner Boerboels nur schwarze Opfer fanden? Sie ballte die Fäuste und stimmte leise das verbotene Lied »Tötet die Buren« an. Wenn ihr Vater es hören würde, würde er sie aus dem Haus jagen. Der alte Januarie hielt viel von Zef Strauss, auf dessen Farm ihre Familie seit über dreißig Jahren in einem kleinen Haus lebte. Er träumte immer noch von der Regenbogennation, der alte Narr. Als sie ihn zu einer der Versammlungen ihrer Partei mitnehmen wollte, hatte er sich geweigert. Wieso wollte ihr Vater nicht verstehen, dass die Weißen kein Recht hatten, das afrikanische Land zu besetzen? Warum beharrte er darauf, dass viele Farmer seit Generationen hier lebten und daher Südafrikaner waren? Kak, nein! Den Schwarzen gehörte das Land! Das hatte der Commander-in-Chief gesagt. Aber seine Freunde beim ANC hörten nicht auf ihn. Seit Jahren blockierten sie das Gesetz zur Landreform. Heute Nachmittag hatte der Kongress endlich ein Gesetz dazu verabschiedet. Aber was war das wert? Auf den ersten Blick könnten die Enteignungen jetzt endlich vorangehen. Tansey hatte dazu eine andere Meinung: Das war nur Stimmungsmache für die Wahlen im August. Die Regierungspartei hatte Angst vor den neuen, starken Anführern der anderen und wollten sich so wieder als Vertreter der Schwarzen präsentieren.
Alles Augenwischerei. Warum schrieb das neue Gesetz vor, dass die Farmer bei der Enteignung entschädigt werden sollten? Das zeigte wieder, wie weich und korrupt die Regierung war. Schlimmer noch, sie gingen gegen ihre eigenen Leute vor. Gerade vorletzte Woche hatte die Polizei hier ganz in der Nähe eine Siedlung von Schwarzen niedergerissen. Dabei hatten die sich doch nur das genommen, was ihnen zustand: ein Stückchen Land für die Familie. Heute Abend würde Tansey mit den Kameraden darüber beraten, wie sie jetzt weiter vorgingen. Ohne darauf zu warten, dass der korrupte Präsident in ein paar Wochen vielleicht dem neuen Gesetz zustimmte.
Tansey hatte sich auf heute Abend vorbereitet. Analysiert, warum die Landnahmen in Grabouw auf so viel Widerstand durch die Regierung gestoßen waren. Wahrscheinlich war der Fehler bei der Landnahme gewesen, dass es sich um öffentliches Land handelte. Natürlich setzte die Regierung da ihre Anti-Land-Invasion Unit ein. Aber wenn es privates Land wäre? In Stellenbosch und anderen Gegenden hatten Parteifreunde ihre Anhänger ermutigt, brachliegendes Farmland für ihre Shacks zu nehmen. Die einfachen Wellblechhütten standen da mittlerweile seit Monaten und niemand machte Anstalten, die Farmer bei der Räumung zu unterstützen. Tansey hatte auch schon eine Idee, wo sie geeignetes Land finden konnten.
Der langsam anschwellende Schrei eines Kaptriels holte sie aus ihren Gedanken. Wahrscheinlich strich einer der Hunde durch das hohe Gras und hatte den kleinen braun-weißen Laufvogel aufgeschreckt.
Er weint über alles, was wir verloren haben, dachte Tansey und hielt kurz inne, um nach dem Tier zu suchen. Erneut strich ein kalter Windzug über sie. Ich sollte mich besser beeilen. Wahrscheinlich steht Danie schon an der Straße und wartet auf mich.
Es dürften nur noch ein paar Hundert Meter sein, bis der Pfad zwischen den Apfelbäumen auf die Zufahrtsstraße zu der Farm mündete. Von da waren es nur noch ein paar Meter bis zur Appletiser Road mit dem aus gelblichem Sandstein gemauerten Namensschild der Farm, welches Besuchern den Weg wies. Vor ihr tauchten die schlanken Umrisse der Zypressen auf, die schon der erste Eigentümer als elegantes Empfangskomitee für seine Gäste gepflanzt hatte und die die Zufahrtsstraße bis zum alten Farmhaus säumten. Sie hörte Kies unter Reifen spritzen. Kurz darauf wurden die Bäume durch vorbeigleitende Scheinwerfer beleuchtet. War Danie des Wartens müde und war ihr ein Stück von der Straße entgegengefahren? Normalerweise war er zurückhaltender. Für einen Regional Secretary der Partei eher ungewöhnlich, achtete er normalerweise darauf, fremdes Land nicht ohne Einladung zu befahren.
Es liegt sicher daran, dass ich heute so spät dran bin, sinnierte Tansey. Es gibt viel zu besprechen und die wenigsten von uns haben Lust, sich die ganze Nacht um die Ohren zu schlagen, da sie morgens wieder früh raus müssen. Hastig schob sie ihren schmalen Körper zwischen zwei Zypressen auf den Kiesweg. Sofort leuchteten zwei Scheinwerfer auf und blendeten sie.
»Jissis, Danie! Mach die Lichter aus, ich kann nichts sehen!« Sie kniff die Augen zusammen, um etwas zu erkennen, aber das Fahrzeug zeichnete sich nur schemenhaft ab.
Der Motor heulte laut auf und der Kies spritzte nach allen Seiten, als das Fahrzeug auf sie zuraste. Sie merkte noch, dass das Auto sie, einem wilden Stier in der Arena gleich, hochschleuderte. Ihr Bewusstsein blieb am Boden zurück und beobachtete ihren Körper, der in Zeitlupe durch die Luft flog und mit einem dumpfen Krachen auf dem Farmschild aufschlug. Die Dunkelheit umschloss ihren Geist und trug ihn fort. Sie hörte nicht mehr, dass eine Autotür zuschlug und jemand mit langen knirschenden Schritten auf sie zulief.
Im Licht der Scheinwerfer beugte sich eine Gestalt über den Körper des Mädchens. Ein Rinnsal von rotem Blut bahnte sich den Weg in Richtung der Straße. Aus der Ferne weinte der Kaptriel um die nächste verlorene Seele.
27.05.2016, 10:32, Direktorat für Kapitalverbrechen SAPS, Kapstadt
»Unathi, meinst du nicht, du hattest heute schon genug Kaffee? Mittlerweile müsste dein Blut genauso schwarz sein wie deine Haut!«, neckte Clyde de Jongh den jungen Xhosa.
Bei Pieter Strauss stellten sich bei diesen Sprüchen seines Warrant Officers die Nackenhaare auf. Zwar war sein Sergeant Unathi Zama ein Mann, der nicht auf Ärger aus war, dennoch war im Umgang in ihrem gemischten Team immer Vorsicht geboten. Vor allem, da seine Chefin, Colonel Mandisa Dikela, in diesen Dingen überkorrekt war. Sie hatte den farbigen Clyde de Jongh als kurzfristigen Ersatz für die ausgeschiedene Emma Kolisi auch nur akzeptiert, weil Clyde die Stelle des Warrant Officers schon einmal innehatte, bevor er einen kurzen Ausflug in die Wirtschaft als Sicherheitschef gemacht hatte.
»Lass mal gut sein, Clyde. Unathi kann den Kaffee vertragen. Jetzt, wo das zweite Kind da ist und sein Ältester ist noch nicht einmal ein Jahr. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Nächte im Moment kurz sind, nè?«
Unathi nickte zur Bestätigung mit dem Kopf und schlurfte in Richtung Flur, auf dem der von ihm heute bereits mehrfach frequentierte Kaffeeautomat stand.
»Broe, bringst du mir einen Becher mit?«, rief ihm Clyde hinterher. Dann drehte er seinen Bürostuhl so, dass er dem hinter ihm sitzenden Pieter in die Augen schauen konnte. »Du bist manchmal wirklich übervorsichtig, Pieter. Der Darkie kann auch mal einen Spruch vertragen. Solange er nicht zu Dikela rennt und sich über mich beschwert, ist doch alles gut.«
»Du legst es auch wirklich drauf an, Clyde! Lass es einfach mit diesen Sprüchen, vor allem möchte ich nicht das Wort ›Darkie‹ von dir hören!«
»Oukei, okay. Ich laufe dafür heute Abend eine Extrarunde übers Rugbyfeld, Captain.« Ein breites Grinsen. »Aber im Ernst, Unathi weiß, dass ich es nicht so meine.«
Wie zur Bestätigung kehrte Unathi mit zwei Pappbechern mit dampfendem Kaffee zurück und stellte Clyde einen davon auf den Schreibtisch. »Hier, Kallid.« Auf Unathis Gesicht zeigte sich ein Lächeln, als er das nicht minder abwertende Wort für »Farbiger« benutzte. »Damit du ein bisschen mehr Farbe bekommst.«
Pieter war überrascht. Selbst der zurückhaltende Unathi ließ sich inzwischen von Clydes Frotzeleien anstacheln. Dikela würde diese Art von Humor, der in das Team eingezogen war, kaum schätzen. Andererseits war es vielleicht genau die richtige Art, mit ihrer unterschiedlichen Herkunft umzugehen: Es bloß nicht zu ernst nehmen. Vor einem halben Jahr hätte das nicht funktioniert, als Bheka Dube noch Teil des Teams war. Der aufbrausende Zulu hätte Clyde die Sprüche nicht durchgehen und die Fäuste sprechen lassen. Aber Bheka war vor zwei Monaten in die Einheit von Chief Smith in Khayelitsha, einem Township von Kapstadt, gewechselt. Er hatte die gefährliche Arbeit dieser Einheit bei einem ihrer letzten Fälle zu schätzen gelernt und um die Versetzung gebeten. Dieser Wechsel und der Zugang von Clyde hatte dem Team gutgetan und manchmal schien es Pieter, dass er der Einzige war, der Emma Kolisi vermisste. Emma war nur kurz Teil seiner Mannschaft gewesen, aber Pieter hatte die groß gewachsene Xhosa mehr als schätzen gelernt. Leider hatte ihr einziger gemeinsamer Fall einen tragischen Ausgang gehabt, sodass Emma gekündigt hatte. Sie unterrichtete mittlerweile Waffenkunde in der neuen Polizeiakademie in Paarl. Eigentlich keine Entfernung von Kapstadt. Pieter hatte sich schon mehrfach vorgenommen, sich ins Auto zu setzen und sie zu besuchen.
Sein Freund Jan bedrängte ihn beinahe wöchentlich, Emma einen Besuch abzustatten: »Toe nou, broe. Mach schon. Bringt es endlich hinter euch. Nur so wisst ihr, ob es etwas Ernstes werden könnte oder nicht.«
Aber so einfach war das nicht. Zumindest nicht für Pieter. Sein Freund Jan »Jakkals« Mulder war anders als er mit Frauen. Bei ihm wechselten die »Meisies« beinahe wöchentlich. Der hochgewachsene Jan mit seinem sorgfältig gepflegten dunklen Dreitagebart und den breiten Schultern, die von einem langjährigen Rugbytraining als Außendreiviertel herrührten, ließ die Frauen reihenweise in seine Arme sinken. Dazu gab es kaum einen Moment, in dem er um Worte verlegen war. Ganz anders als Pieter, der eher ruhig war und gegenüber Frauen fast schüchtern.
Da war es auch egal, wenn Jakkals ihm zuredete: »Hast du dich mal im Spiegel angesehen? Wenn ich ein Weib wäre und dich sähe: mit diesen breiten Schultern, den blonden Haaren und den blauen Augen. Ich würde dich nicht von der Bettkante schubsen.« Vielleicht hatte Jakkals recht und er sollte bei Gelegenheit nach Paarl fahren.
Ein Räuspern durchbrach seine Gedanken. Vor ihm stand die kleine Gestalt seiner Chefin und schaute ihn mit zusammengekniffenen Augen an. Wie lange war sie schon da?
»Captain Strauss, ich hoffe, ich störe Sie nicht bei etwas Wichtigem?« Sie blickte auf einen Satz von Büroklammern, die er aufgebogen und zu einer Kette wieder zusammengefügt hatte. »Es gibt Arbeit für die Valke. Ein Mord an einem Farmer in Stellenbosch. Ich möchte, dass Sie und Ihre Leute sich das ansehen. Der Tote war ein Deutscher, der erst vor ein paar Jahren hierher gekommen ist, und die deutsche Presse hat den Fall bereits aufgegriffen. Es wurde beschlossen, dass schnell Ergebnisse erzielt werden müssen.«
Dikela drehte sich auf dem Absatz um und verließ das Büro. Für Pieter das Zeichen, ihr zu folgen.
27.05.2016, 13:51, Farm bei Stellenbosch
Weißer Kies knirschte unten den Reifen ihres Wagens, als sie in Richtung der Hauptgebäude der Farm fuhren. Vor ihnen tauchten zwei große weiße Stinkbäume auf, deren weite Kronen aus hellgrünen Blättern den Blick auf das Haupthaus versperrten. Pieter verstand nicht viel von Botanik, aber diese Bäume erkannte er überall. Als Kind hatte er sich immer gewundert, warum diese schönen Gewächse so einen Namen trugen, bis Conrad einen der alten Bäume auf der Farm seiner Eltern wegen Pilzbefall hatte fällen müssen. Der beißende Geruch, der dem frisch geschlagenen Holz entströmte, hatte ihn als kleinen Jungen mit zugehaltener Nase weglaufen lassen. Conrad hatte ihn damit über Jahre aufgezogen und ihm scherzhaft gedroht, wenn er sich schlecht benehme, in seinem Zimmer ein Stück des Holzes zu verstecken.
Als sie näher heranfuhren, zeigten sich die geschwungenen weißen Giebel des Haupthauses mit seinem reetgedeckten Dach. Vorne über dem Eingang mit der ausladenden Treppe war, ebenfalls in Weiß, das Familienwappen eingearbeitet. Geflügelte Löwen und Weintrauben zierten die große Rosette. Rechts neben dem Haus wurde eine Wassermühle durch einen kleinen Bach angetrieben. Das musste ein Ausläufer des Bergrivier sein, der sich von Norden in Richtung Meer den Weg durch das Western Cape bahnte. Pieter konnte durch das geöffnete Wagenfenster das gleichmäßige Klatschen der Mühle hören, deren Blätter durch den langsam fließenden Bach geschoben wurden. Aber etwas störte dieses idyllische Bild.
»Sieht nicht nach einem gewöhnlichen Raub aus«, kommentierte Clyde trocken. Wie eine klaffende Wunde zog sich der Schriftzug »Shot to kill« in roter Farbe quer über den weißen Giebel. Eine junge Schwarze auf einer Leiter, bewaffnet mit Eimer und Bürste, versuchte vergeblich, diesen Zeugen der vergangenen Nacht zu beseitigen. Von unten wurde sie von einer schlanken, blonden Frau auf Krücken, die Anweisungen nach oben rief, dirigiert.
Pieter wunderte sich. Wieso ließen die Kollegen der SAPS, der South African Police Service, zu, dass hier Beweismaterial vernichtet wurde? Er konnte nur hoffen, dass es Fotos vom ursprünglichen Zustand gab.
»Mevrou, ich würde Sie bitten, damit aufzuhören.« Er schälte sich aus dem kleinen Wagen und näherte sich der Leiter.
Die Blonde drehte sich um und sah ihn an. »Wer sagt das?« Ihre Stimme war belegt. Ob es vom Weinen war? Pieter sah rote, verquollene Augen, die ihn böse anstarrten.
»Entschuldigen Sie. Mein Name ist Captain Pieter Strauss von den Valke. Das hier ist mein Kollege Warrant Officer Clyde de Jongh. Wir sind aus Kapstadt gekommen, um zu helfen.«
»Helfen wollen Sie? Wo waren Sie denn die letzten Monate, als mein Mann und ich vor Angst nicht mehr aus dem Haus gingen, weil diese Darkies unser Land besetzt haben? Ja, Monate! Keiner hat etwas gemacht, nur zugesehen. Haben Sie eine Ahnung, wie das ist, jede Nacht darauf zu warten, dass wieder die Alarmanlage losgeht, nach der geladenen Waffe im Nachttisch zu greifen und sich auf das Schlimmste einzustellen?«
»Ging heute Nacht die Alarmanlage an?«
Sie rieb sich die Augen. »Ja, was denken Sie? Mein Mann hat die Waffe genommen und das Walkie-Talkie, um die Farmwatch zu benachrichtigen.«
»Sie haben eine Farmwatch? Sind dort nur die Farmer der Umgebung organisiert oder haben Sie auch Unterstützung vom AfriForum?«, wollte Clyde wissen.
»Wen interessiert das? Keiner konnte meinen Mann retten! Aber da Sie es wissen wollen: Auch die Männer vom AfriForum waren heute früh mit einem Wagen vor Ort, um mich zu unterstützen.« Sie musterte Clyde von oben bis unten. »Ich bin froh, dass es das AfriForum gibt, aber so jemand wie Sie kann das nicht verstehen. Wir Buren müssen uns organisieren. Eine verfolgte Minderheit im eigenen Land. Wenn es das AfriForum nicht gäbe, würde doch niemand über die Plaasmorde sprechen. Schauen Sie da oben auf dieses Gekritzel und erzählen Sie mir, dass es keine politisch motivierten Farmmorde gibt!«
Pieter sah, wie Clyde die Hände zu Fäusten ballte. Schnell versuchte er zu beschwichtigen.
»Mevrou van Rensburg, wir haben vollstes Verständnis für Sie. Meinem Warrant Officer ging es mit seinen Fragen nur darum, sich einen möglichst guten Überblick über die Lage zu verschaffen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würden wir uns gerne in Ruhe mit Ihnen unterhalten. Können wir dazu vielleicht ins Haus gehen? Ich denke, es ist in Ihrem Zustand nicht gut, wenn Sie lange stehen«, ergänzte er mit Blick auf ihre Krücken.
Sie atmete tief durch. »Sie haben recht. Entschuldigen Sie bitte, ich bin normalerweise ruhiger. Folgen Sie mir bitte.« Sie gingen die sechs Stufen hoch zur Eingangstür, die weit offen stand.
Das Mittagslicht stahl sich durch die Tür in die Eingangshalle. Die spitzen, gedrehten Hörner einer großen ausgestopften Elenantilope reckten sich zur hohen Decke. Traurig starrte sie die Besucher an. Vor Pieters Augen schwirrten schwarz-weiße Flächen von Zebrafellen, die über der Empore hingen und so den Zugang zum ersten Stock des Hauses säumten. Trophäen eines Großwildjägers. Pieter musste sich zusammenreißen, um sich nicht vor Abscheu zu schütteln.
Die Farmerin führte sie in einen an die Halle angrenzenden Wohnbereich. Dort ließ sie sich, die Krücken rechts und links neben sich zum Abbremsen ins Parkett gebohrt, langsam auf einen schweren Ledersessel sinken. Erleichtert stellte Pieter fest, dass es in diesem Raum keine Jagddevotionalien gab. Er trat an eines der großen, bodentiefen Fenster. Das Ausmaß der Farm konnte er nur ahnen. Bis zum Horizont sah er die Weinberge, die dunkelgrüne Streifen in die Landschaft malten. Dahinter zerschnitten die grauen, felsigen Ausläufer der Simonsberge den Himmel.
»Gehört das alles zur Farm?«, fragte Clyde, der sich neben Pieter gestellt hatte.
»Ja, das tut es. 300 Hektar bestes Weinland. Alte Reben. Meine Familie ist der Tradition und dem Wein verpflichtet. Generationen von Weinmachern, immer auf der Suche nach dem besten Wein.« Sie zeigte auf die Porträts mehrerer grauhaariger Männer, die über dem Kamin hingen. »Ich habe an der Akademie in Stellenbosch studiert, danach war ich für ein Jahr in einem Château in Bordeaux. Von da habe ich mir unseren Weinmacher mitgebracht. Er ist meine rechte Hand auf dem Gut. Zusammen haben wir hier Großes geschaffen. Unser Pinotage ist über Südafrika hinaus berühmt. Und das soll er auch noch lange bleiben.« Pieter hörte den Stolz, der in der Stimme der Frau mitschwang. Trauer um den toten Ehemann hatte er noch nicht gespürt.
»Sie wollen die Farm nicht aufgeben?«, fragte er nach.
»Oh nein, was denken Sie denn? Das ist meine Heimat. Schon meine Ururgroßeltern haben hier gelebt. Mein Mann war derjenige, der aus Deutschland eingewandert ist.«
»War Ihr Mann dort auch im Weinbau beschäftigt?«
Sie schüttelte heftig den Kopf. »Wie kommen Sie darauf? Davon hat Stephan nichts verstanden. Er hatte eine Softwarefirma, bevor es ihn nach Südafrika zog. Die Familie van Rensburg sind die Weinmacher!«
»Was ist mit der Firma geschehen?«
»Ist das jetzt von Bedeutung?« Sie runzelte die Stirn. Dann zuckte sie mit den Schultern. »Wenn Sie es unbedingt wissen wollen: Stephan hat sie verkauft.«
Das Mädchen, welches eben noch draußen versucht hatte, die rote Farbe wegzuwischen, erschien mit einem Tablett mit einer großen dampfenden Teekanne und Teegläsern.
»Danke Yara. Du kannst gehen, das Einschenken übernehme ich.« Die Farmerin drehte sich zu den beiden Polizisten um. »Sie mögen doch Bossies?«
Pieter nickte höflich, obwohl er einen guten Kaffee dem südafrikanischen Tee vorgezogen hätte. Bei ihm verursachte der Tee aus dem hier am Westkap wachsenden Rotbusch immer ein unangenehmes Kratzen im Hals.
Nachdem sie alle versorgt waren, kam Pieter vorsichtig wieder auf die gestrige Nacht zu sprechen. »Mevrou van Rensburg, bitte lassen Sie uns noch einmal von vorne anfangen. Wann genau ging gestern die Alarmanlage an?«
»Bitte nennen Sie mich Victoria«, entgegnete die Blonde und lehnte sich in das tiefe Polster zurück. Ihr Blick schweifte nach draußen über die Weinberge, als sie anfing zu erzählen.
Vierzehn Stunden zuvor, »Frey Land« bei Stellenbosch
»Die große Trommel muss immer gespannt bleiben;
denn man weiß nie, wann der Feind kommt.«
Bantu-Weisheit
»Wie kann das sein, dass das Konto diesen Monat schon wieder überzogen ist?« Stephan nahm einen der Ausdrucke, die er über das große antike Bett mit dem alten Baldachin verteilt hatte, hoch und hielt ihn seiner Frau hin.
Victoria legte mit einem Seufzer ihren Krimi beiseite. »Es gab ein Angebot von Eichenfässern aus Frankreich. In denen wurde vorher zwanzig Jahre lang Cognac gelagert. Ich musste einfach zuschlagen. Du hast ja keine Ahnung, welche Aromen unser Weinmacher damit in unseren Pinotage zaubern kann.«
»Das stimmt, davon habe ich keine Ahnung. Aber ich habe Ahnung vom Geschäft. Und ich sehe, dass du weit mehr investierst, als am Ende wieder herauskommt! Wenn ich so meine Firma in Deutschland geführt hätte, würdest du hier nicht mehr wie eine Königin leben!« Er zog seinen aufgeklappten Laptop zu sich heran und fing an, ein paar Zahlen zu tippen. »Ich habe unsere Ausgaben der letzten Monate genau verfolgt. Wir müssen sie dringend reduzieren.«
»Wenn du nicht darauf bestanden hättest, den Farmarbeitern pro Woche 700 Rand zu bezahlen, anstatt den üblichen 640, wäre das alles kein Problem!«
»Du glaubst wirklich, es liegt an den paar Rand, dass wir jeden Monat zu wenig in der Kasse haben? In Deutschland könntest du dir für das bisschen mehr Geld, was ich unseren Farmern gebe, gerade mal zwei kleine Coffee to go kaufen. Oh nein meine Liebe, das ist nicht unser Problem! Aber deine verdammten Cognac-Fässer. Für jedes Fass könnte ich einen Arbeiter einen Monat beschäftigen und hätte am Ende sogar noch Geld übrig. Und du hast fünfzig davon bestellt … Begreifst du das nicht?«
»Wie ich schon sagte, du hast keine Ahnung!« Victoria nahm ihr Buch wieder hoch.
»Für die gnädige Frau bin ich also nur gut genug, wenn ich ihre Rechnungen bezahle?«, fragte Stephan mit leiser Stimme. »Wie wäre es, wenn ich in Zukunft vor dem Einkauf deine Bestellungen kontrolliere?«
Victoria runzelte die Stirn und blickte erst die zerstreuten Papiere und dann ihren Ehemann an. Sie legte ihr Buch beiseite und strich ihm durchs Haar. »Du weißt ganz genau, dass du mir wichtig bist«, flüsterte sie. »Leg die Rechnungen und das Notebook beiseite und ich zeige es dir.« Sie zog ein nacktes Bein unter der Decke hervor und legte es um seine Hüfte.
Stephan schob ihr Bein zur Seite. »Nicht dieses Mal, Victoria! Wir reden jetzt darüber und klären das, ein für alle Mal. Ich habe einen Plan aufgestellt, der sollte dir …« In diesem Moment ging der Alarm los und das Äußere des Hauses wurde in Flutlicht getaucht. »Verdammter Mist! Was ist jetzt schon wieder los?« Er schob seine Lesebrille nach oben und versuchte, durch die bodentiefen Schlafzimmerfenster draußen etwas zu erkennen.
»Willst du nicht nachsehen? Vielleicht ist jemand im Haus?« Victorias Stimme zitterte zu Stephans Überraschung leicht. Normalerweise war sie in solchen Momenten eher ruhig, geprägt durch ihr Leben auf der Farm. Nicht so wie er, für den auch nach drei Jahren vieles noch neu war.
Zögerlich griff Stephan nach seinem Bademantel, der am Fuß des Bettes lag. »Vielleicht ist es nur wieder eine von den Maulwurfsnattern? Seit Wochen sagst du mir, dass die schwarzen Landbesetzer in unser Haus kommen. Und, was ist passiert? Außer schlaflosen Nächten auf unserer Seite gar nichts. Hör doch, sogar die Hunde verhalten sich ruhig.«
Victoria schüttelte heftig den Kopf. »Nein, nein. Ich habe ein ungutes Gefühl. Letzte Woche gab es in Grabouw Unruhen. So weit weg ist das nicht und die Stimmung ist gerade überall ziemlich aufgeheizt. Schau bitte einmal unten nach dem Rechten. Ich nehm das Walkie-Talkie und lös Alarm bei der Farmwatch in Paarl aus.«
Stephan seufzte und stand auf. Es war sicher nur wieder falscher Alarm. Nur ein einziges Mal hatte es vor ein paar Monaten einen Einbruchsversuch auf der Farm gegeben. Sie hatten die Einbrecher aufgeschreckt, als sie an einem Sonntagvormittag von der Kirche zurückkamen. Dennoch erinnerte sich Stephan an die mit schwarzen Strumpfmasken getarnten vier Männer sehr genau. Zum Glück hatten sie sich so über ihr Erscheinen erschreckt, dass sie sofort auf ihren Bakkie gesprungen und geflüchtet waren. Victoria hatte ihm seitdem in den Ohren gelegen, eine geladene Waffe in der Nachttischschublade bereitzulegen. Aber das wollte er nicht. Das einzige Zugeständnis, das er gemacht hatte, war die Schreckschusspistole, die er mit Reizgaspatronen gefüllt hatte. Ansonsten hatte er rund um das Hauptgebäude Bewegungsmelder mit Flutlicht gekoppelt, um Einbrecher möglichst sofort in die Flucht zu schlagen.
Er griff nach seinem Bademantel, der noch am Fußende des Bettes lag. Victoria hatte recht, er konnte das hier jetzt nicht ignorieren. Mit der rechten Hand zog er seine Nachttischschublade auf und griff nach der Pistole.
»Ich schau unten nach dem Rechten. Ist sicher falscher Alarm.« Er zog den Gürtel seines Bademantels fester und verließ das Schlafzimmer.
Als er in Richtung Empore ging, um über die Treppe in die große Eingangshalle zu gelangen, sah er aus dem Augenwinkel, wie Victoria nach dem Walkie-Talkie griff. Im Stillen hatte er gehofft, dass sie abwarten würde, bis er von seinem Gang durchs Haus zurückkam. Die Meldung bei der Farmwatch hieß, dass er mit den Typen über das Gelände streifen musste, bis sie sicher wären, dass wirklich kein Mensch den Alarm ausgelöst hatte. Er gähnte. Eine lange Nacht stand ihm bevor. Die letzte Stufe der Treppe knarrte leise. Es fuhr ihm durch die Glieder, als ein großer dunkler Schatten auf ihn fiel. Verdammt, das ist nur wieder diese dämliche Riesenantilope. Was für ein Idiot stopft eine ganze Elenantilope aus und stellt sie sich in die Halle, hatte er sich schon bei seinem ersten Besuch auf der Farm gefragt. Wenn es nach ihm ginge, wären sämtliche Jagdtrophäen schon lange verschwunden. Aber nach ihm ging es nicht in diesem Haus.
Ab morgen geht es nicht mehr nur um Victorias Wünsche, beschloss er und vergaß über diesen neuen Gedanken fast völlig den Grund, warum er eigentlich unten in der Halle war. Drei weitere Schatten tauchten auf. Dieses Mal waren es keine ausgestopften Tiere. Im Halbdunkeln sah er Pistolenläufe aufblitzen. Das hier hatte er schon einmal erlebt. Vermummte Gesichter, Augen, die er durch die schmalen Schlitze nur ahnen konnte. Aber diesmal machten sie nicht den Eindruck, als ob sie sich von ihm in die Flucht schlagen ließen.
27.05.2016 – 14:27, Van-Rensburg-Farm bei Stellenbosch
»Was genau ist passiert, nachdem Ihr Mann nach unten gegangen war?«
»Ich habe per Walkie-Talkie die Farmwatch kontaktiert. Sie sagten mir noch, ich solle die Gittertür zum Schlafzimmer schließen, aber es war zu spät.« Sie schluckte und fuhr sich mit der Hand durchs Gesicht. »Zwei Männer standen im Schlafzimmer, mit gezogenen Waffen. Sie wollten die Kombination zu unserem Safe.«
»Haben Sie sie ihnen gegeben?«
Victoria schüttelte den Kopf. »Nein, natürlich nicht! Ich dachte, so hätte ich etwas zum Verhandeln, ich wusste ja nicht, dass Stephan …« Sie zog ein Papiertaschentuch aus der Hosentasche und schnäuzte sich die Nase.
Pieter blickte hinüber zu Clyde und stellte fest, dass sich im Gesicht seines Stellvertreters keinerlei Mitleid mit der Witwe zeigte. Sah dieser etwas hinter der trauernden Fassade, was er bisher übersehen hatte? »Victoria, wir wissen, dass es nicht einfach für Sie ist, aber bitte schildern Sie uns alles so genau wie möglich.«
Sie räusperte sich und fuhr fort: »Die Männer warfen mich auf das Bett. Einer kniete sich auf mich und der zweite fing an, meine Füße mit etwas sehr Heißem zu bearbeiten. Erst später habe ich begriffen, dass sie unseren Kaminanzünder benutzt haben. Ein sehr langes Feuerzeug mit einer großen Flamme, das im Schlafzimmer auf dem Kaminsims lag.«
Daher also das Humpeln und Gehen an Krücken, dachte Pieter und machte sich ein paar Notizen.
»Die Schmerzen waren furchtbar, aber ich habe denen nicht den Gefallen getan und habe geschrien.«
»Das muss hart gewesen sein. Konnten Sie einen Ihrer Angreifer erkennen?«
Abermaliges Kopfschütteln. »Nein, das habe ich auch schon dem Polizeichef aus Stellenbosch gesagt. Die Männer hatten Kapuzen über dem Kopf, ich konnte nur die Augen erahnen. Sie hatten militärische Kleidung an und Handschuhe. Mehr weiß ich nicht. Ich habe nur den Schmerz gespürt, alles war wie hinter einem Schleier.«
»Wurden Ihre Wunden schon ärztlich behandelt?«, wollte Clyde wissen.
»Nein, ich bin nicht wichtig«, winkte Victoria ab. »Yara hat die Brandwunden gesäubert und verbunden, das reicht.«
»Haben die Männer etwas stehlen können?«
»Sie haben ein paar der Jagdwaffen mitgenommen und etwas Bargeld aus meiner Handtasche, die auf dem Nachttisch lag.«
»Haben sie auch Kreditkarten mitgenommen?«
»Nein«, kam die kurze, aber bestimmte Antwort.
»Sie sprachen von dem Safe. Hatten Sie den Eindruck, dass die Männer wussten, dass Sie einen Safe im Haus haben? Oder war es nur eine Annahme?«
»Sie meinen, sie könnten einen Tipp bekommen haben? Nein, das glaube ich nicht. Außerdem hätte ihnen ihr Tippgeber dann auch sagen können, dass Stephan immer darauf geachtet hat, dass kaum Geld im Safe war. Er hat immer alles gleich zur Bank gebracht, war kein großer Fan von Bargeld.« Sie nahm ein Taschentuch und tupfte ihre Augen. »Bestimmt hat ihn das sein Leben gekostet. Wenn er den Eindringlingen Geld hätte geben können, würde er bestimmt noch leben!«
»Sie haben vorhin gesagt, dass Sie an einen politisch motivierten Mord glauben? Dann hätte ihm auch das Bargeld nicht geholfen«, unterbrach Clyde sie.
Das Tupfen hörte auf. »Ich habe doch nur überlegt, warum mein armer Mann sterben musste!«
»Entschuldigen Sie, Mevrou«, griff Pieter beschwichtigend ein. »Mein Warrant Officer versucht nur, genau wie ich, sich ein möglichst klares Bild der letzten Nacht zu machen.«
»Wie lange haben die Männer versucht, den Code des Safes zu bekommen?«
»Nicht lange. Das Walkie-Talkie ging an. Der Einsatzleiter von der Farmwatch meldete, dass sie unterwegs seien. Da haben diese Darkies Angst bekommen.«
Clyde zog hinter Victorias Rücken die Augenbrauen hoch.
»Konnten Sie die Hautfarbe der Angreifer erkennen?«, setzte Pieter nach.
»Was sollen sie denn sonst gewesen sein als schwarz?« Victoria spie die Worte fast aus. »Aber wenn Sie es so genau wissen wollen: Sie waren komplett maskiert, trugen Handschuhe. Ich konnte es nicht erkennen. Aber ich spüre so etwas, schließlich lebe ich seit Geburt hier. Es war ihre Sprache, die sie verraten hat.«
»Dann nehmen wir im ersten Schritt an, dass es sich bei den Angreifern nicht um Weiße gehandelt hat.« Es hatte keinen Sinn, mit Victoria über das Thema weiter zu diskutieren. Zu tief verwurzelt schienen ihre Vorbehalte zu sein. »Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen?«
»Nein, tut mir leid. Sie waren alle sehr schlank, nicht besonders groß. Der Angriff dauerte nur ein paar Minuten. Dann sind sie nach unten gelaufen und haben mich auf dem Bett liegen lassen. Ich konnte ein lautes metallisches Geräusch hören. Das war die Tür des Waffenschrankes, die sie gewaltsam mit einem Kuhfuß aufgebogen haben, fand ich später heraus.«
Was ist das für ein Waffenschrank, den man mit einem Kuhfuß öffnen konnte, dachte Pieter. Aber darum sollte sich die örtliche Polizei kümmern. Laut sagte er:
»Gibt es eine Aufstellung, welche Waffen gestohlen wurden?«
»Das habe ich bereist der SAPS gesagt. Jagdwaffen meines Vaters. Ein Jagdgewehr aus Deutschland, eine Burenmauser und eine Glock 20.« Die langen Finger ihrer Gastgeberin fingen an, auf dem Beistelltisch zu klopfen.
»Eine Glock? Seit wann ist das eine Jagdwaffe?« Clyde blickte Victoria mit weit aufgerissenen Augen an.
»Das ist Standard«, belehrte ihn Victoria. »Sie sind kein Jäger, nehme ich an? Mein Vater hat sie zum Nachsuchen für Wild verwendet. Die meisten Jäger haben eine Pistole als zusätzliche Fangschusswaffe. Im Unterholz oder Dickicht kann es lebensnotwendig sein, eine kurze Waffe dabei zu haben. Ein verwundetes Warzenschwein könnte auf einen losgehen und mit einem Gewehr ist der Jäger nicht beweglich genug.«
»Was ist dann passiert?«
»Ich habe oben gewartet, bis ich die Autos der Männer von der Farmwatch durchs Fenster gesehen habe. Dann bin ich runter gelaufen, weil ich gehofft habe, dass Stephan noch unten im Haus ist. Aber dort war er nicht.« Sie knüllte das benutzte Taschentuch in ihrer rechten Hand zusammen und warf es in den Papierkorb unter dem Tisch. Dann holte sie ein frisches Taschentuch aus der Hosentasche.
»Die Einbrecher haben also Ihren Mann mitgenommen?«
»Das haben sie. Die Farmwatch hat ihn eine Stunde später gefunden. Nur etwa fünfhundert Meter vom Haus entfernt. Er wurde mit einem Kopfschuss getötet.« Ein weiteres ausgiebiges Tupfen der Augen.
»Wieso denken Sie, haben die Männer Ihren Mann überhaupt mitgenommen? Normalerweise nutzen Einbrecher eine Geisel, wenn sie mit deren Geldkarten Bargeld abholen wollen. Sie sagten aber doch, Ihr Mann wäre nur mit einem Bademantel bekleidet gewesen, richtig?«
»Das stimmt auch! Aber möglicherweise dachten sie, dass ihnen eine Geisel nützlich sein könnte.«
»Aber sie haben ihn doch ein paar Minuten später allem Anschein nach getötet. Das passt doch nicht?«, warf Clyde ein.
»Vielleicht hat er sich gewehrt und wurde ihnen lästig auf der Flucht. Stephan war ein großer, schwerer Mann. Was weiß denn ich. Sind Sie die Polizei oder ich?« Victoria zog die Krücken zu sich heran und stemmte sich mit deren Hilfe langsam aus dem Sessel hoch. »Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Außerdem habe ich schon eine Aussage bei der örtlichen Polizei gemacht. Bitte haben Sie Verständnis, wenn ich jetzt erst einmal meine Ruhe brauche, um ein paar Dinge zu regeln.« Sie humpelte in Richtung Eingangshalle.
»Eine Frage noch. Warum hat Ihr Mann nicht die Glock, sondern eine Schreckschusspistole verwendet?«
»Weil der Idiot Waffen abgelehnt hat. Und sehen Sie, wohin es ihn gebracht hat.«
27.05.2016 – 15:13, Straße nach Stellenbosch
»Was hältst du von der Witwe?«, wollte Pieter wissen. Sie hatten vor ein paar Minuten die Farm verlassen und waren jetzt auf dem Weg in die örtliche Polizeistation in Stellenbosch, um mit dem ermittelnden Officer der SAPS zu sprechen.
»Für das, was sie uns geschildert hat, wirkt sie sehr gefasst. Ich könnte mir viele Frauen vorstellen, die nach so einem Erlebnis es nicht eine Minute länger auf der Farm aushalten würden.«
Clyde blätterte durch den kurzen Bericht, den ihnen Dikela in die Hand gedrückt hatte.
»Hier steht, dass der Notruf gegen ein Uhr nachts eintraf. Sie hat uns doch erzählt, sie seien noch wach gewesen und hätten gelesen? Die Farmer, die ich kenne, gehen meistens sehr viel früher ins Bett, da sie am nächsten Tag früh raus müssen.«
»Ich habe vorhin schon an deinem Gesicht gesehen, dass du ihr die trauernde Witwe nicht abnimmst. Was genau stört dich?«, wollte Pieter wissen, während sie die R304 in Richtung Stellenbosch fuhren. Rechts und links der Straße wurden die für Touristen und Feinschmecker interessanten Weingüter ausgeschildert. Vor Jahren hatte sich Pieter vorgenommen, irgendwann auch einmal eine sogenannte Weintour zu machen, aber bisher war es dann doch immer nur bei dem Gang zum gut gefüllten Weinregal seines Supermarktes in Observatory geblieben. Oder er war gleich in seine Lieblingsbar in dem Kapstädter Vorort gegangen. Auf den erlesenen Weingeschmack von Ernie, dem Barkeeper, konnte er sich verlassen. Außerdem war es viel praktischer, nach dem Genuss von ein paar Gläsern Wein nur noch bildlich zweimal lang hinschlagen zu müssen, bis er sein kleines Haus in der Low Street erreichte.
»Ich kann es gar nicht genau festmachen. Es ist mehr so ein Gefühl«, antwortete sein Warrant Officer ausweichend. »Als Erstes empfängt sie uns mit Vorwürfen, erzählt von dem besetzten Land und den Ängsten, die sie und ihr Mann die letzten Monate ausstehen mussten. Dann aber stellt sich heraus, dass ihr Mann nur mit einem Bademantel bekleidet und einer Schreckschusspistole nach unten ging. Wenn die Angst wirklich so groß war, wie sie erzählt, müssten dann die Vorsichtsmaßnahmen nicht größer gewesen sein? Wieso hatte die Frau die Glock nicht bei sich im Nachttisch? Ihr traue ich durchaus zu, dass sie weiß, wie sie eine Waffe benutzt. So, wie sie vom Jagen gesprochen hat. Die ist doch bestimmt mit ihrem Vater zur Jagd gegangen.«
»Nach den Erzählungen seiner Frau war dieser Stephan aber kein Fan scharfer Waffen. Deswegen die Schreckschusspistole«, gab Pieter zu bedenken.
»Ein Pazifist, meinst du? Wie konnte sich so einer in einem Haus voller Jagdtrophäen wohlfühlen?«
»Das würde erklären, warum sie die Waffen in einem Waffenschrank aufbewahrt haben. Kein geladenes Gewehr unterm Bett oder die Glock in der Nachttischschublade, wie ich es bei anderen Farmern erlebt habe.«
Clyde nickte langsam. »Da könntest du recht haben, Captain! Also nehmen wir an, dieser Deutsche hatte keine andere Waffe da oben. Dennoch finde ich sein Verhalten seltsam. Wenn er wirklich Angst hatte, warum hat er nicht die Gittertür auf dem Flur zum Schlafzimmer hinter sich geschlossen, als er runter ging, um seine Frau zu schützen? Oder noch besser: Warum hat er die Tür nicht einfach nur geschlossen und zusammen mit seiner Frau im Schlafzimmer auf Hilfe gewartet? War es vielleicht falsch verstandener Stolz?«
»Du meinst, er wollte nicht als Feigling dastehen?« Pieter grübelte. »Oder er hat es für einen Fehlalarm gehalten. Wir sollten uns von der Farmwatch die Daten geben lassen, wie oft in den letzten Wochen auf der Farm Alarm ausgelöst wurde und inwieweit es falscher Alarm oder etwas Ernstes war. Außerdem möchte ich wissen, wie das Verhältnis von Victoria zu ihrem Mann war. Möglich, dass sie ihn gereizt hat und er so bereit war, ein größeres Wagnis einzugehen. Laut unseren Informationen war sie mindestens fünfzehn Jahre jünger als er. Jüngere Frau und älterer Mann, das kann durchaus eine fatale Mischung sein.«
»›Letal‹ beschreibt es in diesem Fall besser«, kam die trockene Reaktion von Clyde. »Schade, dass der Italiener nicht da ist. Nick würde bestimmt wieder in einen seiner imaginären Dialoge mit dem Opfer oder den Tätern verfallen und könnte uns so bei der Psychologie auf die Sprünge helfen.«
Pieter konnte Clyde nur zustimmen. Es war wieder einer dieser Fälle, bei denen er Nick Aquilina, den erfahrenen Profiler des Teams und guten Freund, vermisste. Aber Nick würde nicht vor einem Monat wieder nach Kapstadt kommen. Im Moment war er in Deutschland, um die Behörden bei der Aufklärung eines möglicherweise jahrzehntealten Serienmordes zu unterstützen.
Auf der rechten Seite passierten sie geschwungene weiße Mauern, die den Eingang zu einem weiteren Weingut säumten.
»Wusstest du, dass Josephine mich vor ein paar Jahren überredet hat, hier mit ihr zu ›dinieren‹, wie sie es nannte?«
Pieter sah Clyde überrascht an. »Dinieren« passte nun wirklich nicht zu seinem bulligen Warrant Officer, dem das sonntägliche Braai mit der Familie heilig war. Viel Fleisch, guter Cider und gutes Bier, das war das, was Clyde bevorzugte.
»Wir hatten zehnjährigen Hochzeitstag und ich Idiot hatte es mal wieder vergessen. Zur Strafe hat meine Frau das Essen ausgesucht. ›Asiatische Fusionsküche‹, das weiß ich noch bis heute. War im Prinzip nicht schlecht, aber die Portionen waren viel zu klein. Und richtig trinken konnte ich auch nicht, weil die gnädige Frau an ihrem Hochzeitstag gefahren werden wollte. Zu Haus hat mich Josephine noch nachts am Kühlschrank erwischt, weil ich wirklich Hunger hatte.«
Das klang tatsächlich nach Clyde. Pieter musste lachen.
»Du hast Glück, dass Josephine dir diesen Fauxpas verziehen hat.«
»In ihren Augen ist es einer von vielen. Eine Aneinanderreihung ständiger Enttäuschungen, wie sie gerne sagt. Weißt du noch, wie sie mich vor einem halben Jahr rausgeschmissen hat? Nur, weil ich bei Chopine gekündigt habe. Die Frau traut sich was!«
Pieter konnte sich nur zu gut daran erinnern. Clyde hatte Ende letzten Jahres von einem auf den anderen Tag seinen gut bezahlten Job als Sicherheitsberater bei dem französischen Unternehmen aufgegeben. Ohne sich vorher mit Josephine abzusprechen.
»Natürlich erinnere ich mich daran. Das war die Zeit, als du auf meinem Sofa geschlafen hast und mein Kühlschrank ständig leer war.«
»Du musst zugeben, wir hatten unseren Spaß! Jakkals war fast jeden Abend da und Rugby trainiert haben wir auch viel. Fast hätten wir die Klubmeisterschaften gegen die Hammies gewonnen. Zwei Punkte haben nur gefehlt!«
»Für meine Leber war es auf jeden Fall gut, dass Josephine dich nach zwei Wochen zurückgenommen hat.« Pieter hatte zwar auch nichts gegen ein Glas Cider oder Gin Tonic einzuwenden, aber die Trinkgelage von Clyde und Jakkals waren auf die Dauer nichts für ihn gewesen.
»Ja, vielleicht ist es für unsere Gesundheit wirklich besser. Immerhin bleibt uns unser sonntägliches Braai, wo Josephine mich auch mal ein bisschen mehr trinken lässt. Für nächsten Sonntag habe ich übrigens fünf Kilo Boerewors bestellt und zwei Kisten Cider besorgt. Ein paar Flaschen Gin habe ich auch schon in die Kühlung gelegt. Dich und Jakkals habe ich fest eingeplant!«
»Demnächst müssen wir uns aber auch mal wieder bei mir treffen. Ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen.«
»Lass mal, Captain. Du weißt doch, wie sehr Josephine es eigentlich liebt, Gäste zu haben. Selbst wenn es meine dummen Maats sind.«
»Das heißt wirklich was. Schließlich sind deine Kumpel entweder Polizisten oder Kleinkriminelle.« Pieter musste lachen. »Wie läuft denn Josephines Geschäft mit dem ›Bed and Breakfast‹?«
»Die Frau hat es einfach drauf!« Clydes Stimme war getränkt mit Stolz auf seine Josephine. »›Dom ding‹ habe ich zu ihr gesagt, als sie Jules’ ehemaliges Zimmer zu einem Fremdenzimmer ausbauen wollte. Von wegen ›dumm‹! Sie bietet jetzt ›Übernachtungen im Turm‹ an. Durch den neuen großen Alkoven und die Holzterrasse ist das wie ein kleines Haus im Haus. Die Gäste lieben es.«
»Observatory ist ja auch eine nette Ecke und für Kapstädter Verhältnisse wirklich sicher«, pries Pieter den Stadtteil, in dem sowohl Clyde als auch er wohnten, an.
»Absolut. Habe ich dir von ihrer neuesten Idee erzählt? Sie ist eine Kooperation mit der Universität Kapstadt eingegangen. In den Wintermonaten, wenn die Buchungslage nicht so gut ist, bringt die Uni jetzt bei uns Gastdozenten unter. Wenn ich nicht aufpasse, kommt Josephine noch auf die Idee, auch aus unserem Schlafzimmer ein Gästezimmer zu machen. Ich warte auf den Tag, an dem sie mir verkündet, dass wir beide ab jetzt im Gartenhaus wohnen.«
»Josephine ist wirklich sehr geschäftstüchtig«, stimmte ihm Pieter zu. Im Stillen dachte er, dass das auch gut für Clyde war, denn der Job als Warrant Officer könnte sonst kaum das Haus in Observatory und die Ausbildung der vier Kinder finanzieren. »Wie gefällt es deiner Tochter eigentlich in Stellenbosch? Ich habe Jules seit Dezember nicht mehr gesehen. Hast du ihr Bescheid gesagt, dass wir heute hier sind?«
»Jules ist genau wie ihre Mutter, sie hat immer etwas zu tun. Im Moment lernt sie für irgendwelche Prüfungen. Aber wir sollen uns melden, wenn wir bei der SAPS durch sind. Die Polizei ist ja ziemlich zentral gelegen. Vielleicht reicht ihre Zeit noch für einen Kaffee mit ihrem alten Herrn und dir.«
Links neben ihnen tauchte die Stellenbosch Rugby Academy auf. Clydes Blick fiel auf die hinter einer Mauer hockenden Reihe von einstöckigen Häusern mit ihren blauen Dächern. Er seufzte leise.
»Manchmal frage ich mich, was aus mir geworden wäre, wenn es diese Akademie in meiner Jugend gegeben hätte. Vielleicht hätte ich es zu den Springboks geschafft.«
»Das Talent hättest du gehabt«, meinte Pieter gutmütig. Als Kapitän der Rugbymannschaft, in der Clyde als einer der zwei »Centres« in der Hintermannschaft spielte, wusste er ganz genau, wo die Stärken, aber auch die Schwächen seines Kollegen lagen. Vor allem das Temperament war ein Problem für Clyde de Jongh. Immer wieder missachtete er die eiserne Rugbyregel, dass nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter zu sprechen hatte.
»Du bist derjenige von uns, der als Jugendlicher beinahe ein Testspiel für die Nationalmannschaft hatte. Dein alter Herr hatte damals was dagegen, stimmt’s? Hoekom? Warum eigentlich?«, fragte Clyde nach.
Pieter zuckte mit den Schultern. »Dinge gebeur. So etwas passiert. Lass uns nicht die alten Geschichten aufwärmen, broe.« Pieter hatte in seiner Jugend genug Zeit damit verbracht, dieser verpassten Chance nachzutrauern. Mittlerweile reichte ihm sein Training für den Durbanville Rugby Club und die Spiele am Wochenende. Die Arbeit für die Valke hatte ihn in den letzten Jahren ausgefüllt und Rugby war nur noch ein willkommener Ausgleich zum täglichen Stress. »Sag mir lieber, wie ich jetzt zur Polizeistation komme. Lieutenant Selebi erwartet uns bestimmt schon.«
27.05.2016 – 15:30, SAPS-Station in Stellenbosch
»Hier, direkt beim Supermarkt müssen wir rechts ab!« Clyde deutete auf das gelb-blaue Zeichen einer örtlichen Supermarktkette, welches an einem modernen weißen Gebäude prangte.
»Warum wolltest du nur direkt durch Stellenbosch fahren?«, stöhnte Pieter, der die letzte halbe Stunde im gefühlten Schritttempo hinter zahlreichen mit Touristen gefüllten Bussen und Pkws hergefahren war.