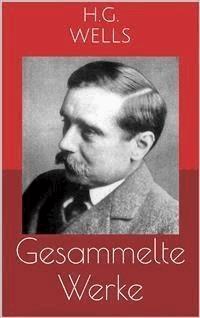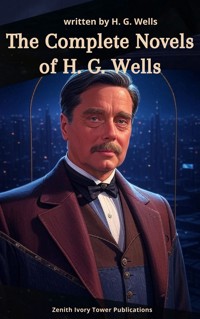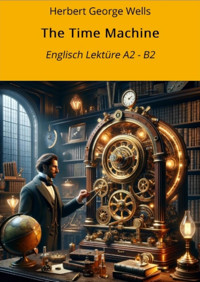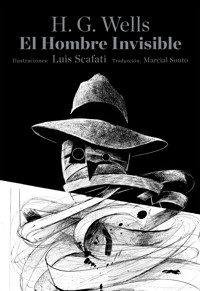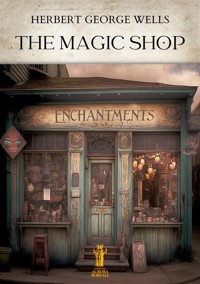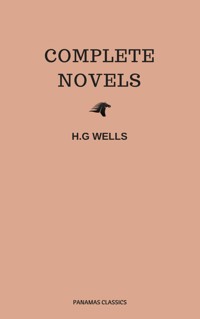0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Science Fiction & Fantasy bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Irgendwo im All, irgendwo "jenseits des Sirius", liegt ein ferner, aber weit entwickelter Planet, der der Erde äußerlich ähnelt. Auf diesen Planeten wird der Ich-Erzähler dieser Geschichte mitsamt seinem Freund, dem Botaniker, versetzt – "Und siehe! in einem Nu sind wir in jener andern Welt!" – Ist es real? Ist es ein Traum? Wells lässt uns darüber im Unklaren. Statt dessen entführt er uns in ein modernes Utopia, in eine bessere Welt, wo nur ein Gesetz herrscht, nur eine Sprache gesprochen wird und es keine Kriege mehr gibt. Eine Welt im Frieden, ein Paradis. Aber Wells zaubert nicht nur seinen Erzähler, sondern (auch) den Leser in eine bessere Welt, eine Welt, wie auch die unsere sein könnte. Er verpackt seine Traumvorstellungen, die wie eine Auffrischung von Morus' Utopia wirken, in eine Entdeckungsreise, die uns vor Augen führt, wie die Welt – unsere Welt – sein sollte. Mit seinem radikalen Utopieentwurf ist "jenseits des Sirius" mit Sicherheit das komplexeste Buch Wells'. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
H. G. Wells
Jenseits des Sirius
Ein utopistischer Roman
H. G. Wells
Jenseits des Sirius
Ein utopistischer Roman
(A Modern Utopia)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954189-35-9
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Ein Wort an die Leser
Der Sprecher
Erstes Kapitel: Topographie
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
Zweites Kapitel: Von der Freiheit
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
Drittes Kapitel: Utopische Volkswirtschaft
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
Viertes Kapitel: Die Stimme der Natur
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
Fünftes Kapitel: Mißerfolg im modernen Utopien
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
Sechstes Kapitel: Die Frauen im modernen Utopien
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
Siebentes Kapitel: Einige Eindrücke aus Utopien
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
Achtes Kapitel: Mein utopisches Ich
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
Neuntes Kapitel: Die Samurai
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
Zehntes Kapitel: Die Rasse in Utopien
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
Elftes Kapitel: Die Blase platzt
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
Anhang: Skepsis gegen das Werkzeug des Denkens.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Science Fiction & Fantasy bei Null Papier
Auf zwei Planeten
Der Herr der Welt
Der Brand der Cheopspyramide
Die Macht der Drei
Befehl aus dem Dunkel
Die Spur des Dschingis-Khan
Der gestohlene Bazillus
Der Krieg der Welten
Der Unsichtbare
Die ersten Menschen auf dem Mond
und weitere …
Ein Wort an die Leser
Dieses Buch ist voraussichtlich das letzte einer Reihe von Schriften, die – abgesehen von früheren einzelnen Aufsätzen – mit meinen »Ausblicken« begann. Ursprünglich sollten die »Ausblicke« das einzige Werk bleiben, in dem ich der Kunst oder dem Beruf (oder wie man es heißen mag) des Dichters untreu wurde. Ich schrieb es, um mir selbst klar zu werden über die zahllosen sozialen und politischen Fragen, die mir im Kopfe umgingen, Fragen, über die ich in meinem Buche weder ganz noch auch mit unklarem, verwegenem Gerede weggehen konnte, und die, soviel ich weiß, noch keiner so behandelt hatte, wie es meinem Bedürfnisse genügt hätte. Aber dieses Ziel erreichte ich in den »Ausblicken« nicht. Mein Kopf arbeitet langsam, vorsichtig aufbauend, und als ich jene Arbeit hinter mir hatte, sah ich, daß der größte Teil meiner Fragen noch nicht gelöst, nicht einmal scharf gefaßt war. Daher versuchte ich in dem Buche »Die Menschheit im Werden« die soziale Organisation auf einem andern Wege zu übersehen, sie als Erziehungsprozeß zu betrachten, nicht als etwas, das erst die Zukunft uns bringen sollte, und wenn mein zweites Buch vom literarischen Standpunkt aus noch weniger befriedigend ausfiel als das erste (und dies fürcht’ ich), so glaube ich doch, meine Fehler waren belehrender – wenigstens für mein eigenes Wissen. Offener als in den »Ausblicken« wagte ich mich an diesen und jenen Gegenstand heran und schloß meinen zweiten Versuch mit dem Bewußtsein ab, manches noch flüchtig hingeschrieben, in vielem aber mir eine feste Ansicht gebildet zu haben. Denn über zahlreiche der behandelten Gegenstände habe ich mir schließlich eine persönliche Sicherheit errungen, auf der ich mein Leben lang beharren werde. In dem vorliegenden Buche habe ich versucht, Rechenschaft abzulegen über eine Reihe von Fragen, die ich im vorhergehenden fort- oder doch offen lassen mußte, manche Einzelheiten umzugestalten und das Bild einer Utopie zu geben, wie es im Laufe dieser Betrachtungen in meinem Geiste entstanden ist als ein Zustand der Dinge, der durchaus möglich und dem bestehenden vorzuziehen wäre. Aber dieses Buch hat mich zur dichterischen Schreibweise zurückgeführt. In den beiden vorhergehenden habe ich die Einrichtung der menschlichen Gesellschaft rein objektiv behandelt, in diesem ging meine Absicht weiter und tiefer: ich wollte ein Ideal, aber nicht nur für sich, sondern in der Rückwirkung auf zwei Persönlichkeiten aufstellen. Und da das vorliegende Buch vielleicht das letzte dieser Art ist, das ich veröffentlichen werde, so schrieb ich in dasselbe so gut als möglich die Ketzerei meines metaphysischen Skeptizismus hinein, auf dem mein ganzes Denken ruht, und schaltete gewisse Abschnitte ein, die sich mit den bestehenden Methoden der Soziologie und der Volkswirtschaftslehre beschäftigen.
Was ich da zuletzt sagte, wird freilich die Schmetterlingsleser nicht anlocken. Ich habe jedoch mein Bestes getan, um das Buch als Ganzes so klar und unterhaltend zu machen, als der Stoff es erlaubt, weil ich möchte, daß so viele als nur möglich es läsen. Aber allen jenen, die meine Seiten nur mit flüchtigen Blicken durchstreifen wollen, um schnell zu sehen, ob ich ihrer Meinung bin, die in der Mitte anfangen, oder ohne treue und lebhafte Aufmerksamkeit zu lesen pflegen, verspreche ich nichts als Ärger und Verwirrung. Wer nicht ein wenig Sinn und Verständnis für politische und soziale Fragen und etwas Übung in der Prüfung des eigenen Selbst mitbringt, kann hier weder Anregung noch Vergnügen finden. Wer über solche Dinge schon »seine Meinung hat«, dessen Zeit würde an dieses Buch verschwendet sein. Auch der willigste Leser jedoch wird für die besondere Methode, die ich diesmal gewählt habe, einiger Geduld bedürfen.
Diese Methode mag etwas Zufälliges an sich haben, ist aber nicht so leichtfertig, als sie aussieht. Ich glaube – sogar jetzt, da ich mit dem Buche fertig bin – sie führt am besten zu einer Art von durchsichtiger Unbestimmtheit, die ich für einen solchen Gegenstand stets angestrebt habe. Bevor ich sie auswählte, habe ich mehrere Anfänge zu einer Utopie durchversucht. Von allem Anfang an verwarf ich die Form strenger Begründung, die sich an den sogenannten »ernsthaften« Leser wendet (der oft genug nur an großen Fragen mit wichtiger Miene herumnascht). Er möchte alles in festen, kräftigen Linien sehen, in Schwarz oder Weiß, mit Ja oder Nein, denn er versteht nicht, daß hier so vieles gar nicht auf diese Weise dargestellt werden kann; wo etwas schief oder unbestimmt erscheint, wo er den nötigen Ernst vermißt oder gar Stimmung entdeckt, oder auch die Schwierigkeiten einer vielseitigen Darstellung, da folgt er nicht mehr. Für ihn ist es typisch, daß er auf der unüberwindlichen Ansicht stehen bleibt, der Geist der Schöpfung könne nicht über zwei hinaus zählen: er hat es nur mit Alternativen zu tun. Solchen Lesern will ich hier nicht gefallen. Selbst wenn ich alle meine triklinischen Kristalle als Würfelsystem darstellte – –! Ich sah ein, es wäre nicht der Mühe wert, dies zu tun. Als ich nun die begründende Form abgelehnt hatte, arbeitete ich fleißig weiter und suchte monatelang nach einem Plan für das vorliegende Buch. Zuerst versuchte ich jene erprobte Methode, die Fragen von einem verschiedenen Standpunkt aus zu übersehen, denn diese hatte mich immer angezogen, ohne daß ich sie noch gemeistert hätte, also den erörternden Roman in der Art wie Peacock (und Mallock) ihn aus dem Dialog der Alten entwickelt haben; aber hierzu Charaktere und die notwendige Intrige zu erfinden, war mir lästig, und so gab ich dies auf. Dann machte ich den Versuch, meinem Gegenstand eine Form zu geben, die der doppelten Persönlichkeit in Boswells Johnson ungefähr ähnlich gewesen wäre, eine Art Wechselspiel zwischen Monolog und Kommentar; obgleich dies dem, was ich suchte, näherkam, schlug es zuletzt doch fehl. Hierauf überlegte ich mir etwas, das man eine »einfache Erzählung« nennen könnte. Der erfahrene Leser wird erkennen, daß dieses Buch zu einer fließenden Erzählung geworden wäre, wenn ich gewisse spekulative und metaphysische Stoffe fortgelassen, die Geschehnisse aber breiter ausgemalt hätte. Aber gerade auf jene Stoffe wollte ich diesmal nicht verzichten. Ich sehe nicht ein, warum ich dem gemeinen Geschmack nach bloßen Erzählungen Vorschub leisten sollte. Kurzum, ich schuf, was hier vorliegt. Dies alles muß ich dem Leser eingehend sagen, damit er wohl wisse, daß dieses Buch das Ergebnis von Überlegungen und Prüfungen und genau so ist, wie ich es haben wollte, wie sonderbar es auch beim ersten Lesen erscheinen mag. Ich habe durchweg eine Art halbseidenen Gewebes aus philosophischer Unterredung und dichterischer Erzählung im Auge.
H. G. WELLS.
Der Sprecher
Es gibt Werke, und das vorliegende gehört zu ihnen, die man am besten mit einem Porträt des Verfassers beginnt. Und das ist in unserem Fall, um einem sehr natürlichen Mißverständnis vorzubeugen, sogar der einzig mögliche Weg. Es klingt ein Ton durch diese Blätter, ein deutlicher und persönlicher Ton, der zuweilen scharf und schneidend wird, und alles, was nicht wie die vorhergehende Einführung mit andern Typen gedruckt ist, wird von der einen Stimme gesprochen. Nun darf man – und dies ist das Besondere an der Sache – diese Stimme nicht für die des Verfassers halten, der für das Buch zeichnet. Jede Voreingenommenheit dieser Art muß verbannt werden. Den Sprecher stelle man sich vor als einen weißblonden, rundlichen Mann, nicht ganz mittelgroß, im jüngeren Mannesalter, mit blauen Augen, beweglichen Manieren und einer kleinen kahlen Stelle auf dem Scheitel – nicht größer als ein Taler. Seine Stirne ist gewölbt. Zuweilen sinkt er in sich zusammen, wie die meisten von uns, aber gewöhnlich trägt er sich stolz wie ein Spatz. Er macht gelegentlich eine elegante, erklärende Handbewegung. Und seine Stimme (die nun unser Medium sein wird) ist ein reizloser Tenor, der manchmal durchdringend wird. Man stelle sich vor, er sitze an einem Tisch, lese in einem Manuskript über Utopien und halte dieses Manuskript in seinen beiden, am Gelenk starken Händen. So hebt sich der Vorhang über ihm. Sobald jedoch die vorzüglichen Mittel dieser wenig mehr geübten literarischen Kunst recht in Wirkung treten, wird man seltsame und interessante Dinge mit ihm erleben. Aber er kehrt immer wieder an den kleinen Tisch zurück, um uns, das Manuskript in der Hand, seine Schlußfolgerungen gewissenhaft darzulegen. Womit der Leser unterhalten werden soll, das ist weder eine gut erfundene Handlung, wie er sie in Romanen so gerne liest, noch auch eine streng aufgebaute Abhandlung, denen er so gerne ausweicht, sondern ein Mittelding zwischen beiden. Stelle dir nun vor, der Sprecher sitze auf einer Bühne, ein bißchen aufgeregt und doch zurückhaltend, er habe seinen Tisch, sein Glas Wasser und alles, was zu ihm gehört, ich selbst sei der aufdringliche Vorsitzende, der erbarmungslos auf »einigen Worten« der Einführung besteht, ehe er sich auf die Seite schlägt, stelle dir ferner hinter unserm Freund einen Lichtschirm vor, worauf von Zeit zu Zeit bewegliche Bilder erscheinen, und bedenke schließlich, daß er dir von dem erzählen will, was seine Seele auf ihren Forschungen in Utopia erlebt hat: so wirst du wenigstens auf einige der Schwierigkeiten meines Werkes vorbereitet sein.
Diesem hier vorgestellten Schriftsteller steht eine zweite irdische Person gegenüber, die sich aber erst dann zu einer deutlichen Persönlichkeit verdichtet, wenn wir sie zuvor mit dem Leser in Beziehung gesetzt haben. Sie heißt der Botaniker und ist schlanker, ziemlich größer, ernster und viel weniger redselig. Sein Gesicht ist leidlich hübsch und von grauem Teint; er ist blond, hat graue Augen und macht den Eindruck, als wäre er magenleidend. Dieser Verdacht ist nicht unbegründet. »Leute dieses Schlags« – mit dieser Erklärung drängt sich plötzlich der Vorsitzende ein – sind romantisch mit einem Schatten von Niedrigkeit, sie suchen Begierden zu verbergen und zu schärfen, sie geraten mit den unter einer außerordentlichen Empfindsamkeit ihre sinnlichen Frauen in gewaltige Konflikte und Nöte, und auch der Botaniker hat seine Widerwärtigkeiten gehabt. Man wird von ihnen hören, denn auch dies ist eine Eigenschaft seines Typus. Er kommt in diesem Buch selbst nicht zu Wort, es spricht immer der andere, aber vieles von dem Was und einiges von dem Wie seiner Einwürfe kann man aus den Nebenbemerkungen und aus der Stimme des Sprechers entnehmen.
So weit mußten die Helden der modernen Utopie, die sich als Hintergrund der beiden Forscher entrollen wird, porträtiert werden. Das Bild einer kinematographischen Vorstellung drängt sich auf. Man wird den Eindruck haben, als gingen die beiden vor dem Lichtkreis einer ziemlich schadhaften Laterne hin und her, die bisweilen aussetzt, dann wieder das Bild verzerrt, der es gelegentlich aber auch gelingt, ein bewegliches Momentbild utopistischer Verhältnisse auf den Lichtschirm zu werfen. Manchmal erlischt auch das Bild vollständig, die Stimme aber redet und redet, die Rampenlichter leuchten wieder auf, und ihr sitzt da und lauscht von neuem dem etwas zu rundlichen, kleinen Mann, der an seinem Tisch eine Behauptung nach der andern ausspricht, und vor dem sich jetzt der Vorhang hebt.
Erstes Kapitel: Topographie
§ 1
Eine moderne Utopie muß sich notwendigerweise in einem wesentlichen Punkte von den Nirgendwos unterscheiden, die erträumt wurden, ehe Darwin das Denken der Welt neu belebte. Sie alle waren feste und vollkommene Staatswesen und gewährten ein für allemal ein sicheres Glück gegen alle Unruhe und Unordnung, die in der Welt selbst liegt. Da sah man ein gesundes, einfaches Geschlecht, das in lauter Tugend und Glück die Früchte der Erde genoß. Ihm folgten andere tugendhafte, glückliche und diesem ganz ähnliche Geschlechter, bis die Götter es genug hatten. Veränderung und Entwicklung wurden von ewig festen Dämmen für immer zurückgehalten. Eine moderne Utopie aber darf nicht im Gleichgewicht, sie muß in Bewegung erscheinen, nicht als bleibender Zustand, sondern als eine aussichtsvolle Stufe, die zu einer langen Reihe von Stufen emporführt. Heutzutage stemmen wir uns dem Strom der Dinge nicht entgegen, wir schwimmen mit ihm. Wir bauen unsere Staatswesen nicht als Burgen, sondern als Schiffe. An Stelle eines einmal geordneten Gemeinwesens, das für jetzt und immer ein gleiches Glück fest und sicher verbürgt, müssen wir »einen dehnbaren, allgemeinen Kompromiß« entwerfen, »in welchem eine beständig neue Folge von Individualitäten am wirksamsten auf eine umfassende Vorwärtsbewegung hindrängt«. Dies ist der erste, allgemeinste Unterschied zwischen einer Utopie nach modernen Begriffen und all den Utopien, die früher geschrieben wurden.
Wir haben uns hier mit einer Utopie zu beschäftigen, sie zuerst im kleinen deutlich und wahrscheinlich zu machen, dann die Welt als Ganzes uns in einem solch glücklichen Zustand vorzustellen. Wir haben dabei etwas im Auge, das zwar gewiß nicht unmöglich, jedenfalls aber von heute auf morgen nicht durchführbar ist. Dazu müssen wir uns von der beharrlichen Betrachtung der Gegenwart eine Zeitlang ganz abwenden, um unsern Blick zu richten in die freieren und weiteren Gebiete des in der Zukunft noch Möglichen, auf den Entwurf eines beachtenswerten Gemeinwesens, auf die Gestaltung eines Bildes, das unsere Phantasie von jenem Leben vorzeichnet, das nach der Vorstellung wohl möglich und des Lebens mehr wert wäre als unser jetziges. Hierzu wollen wir zunächst einige Richtpunkte festlegen und dann uns in jene Welt selbst vertiefen.
Gewiß ist dies ein optimistisches Unternehmen. Aber es ist ganz gut, den kritischen Ton auf eine Weile fortzulassen, der sich immer einmischt, wenn man von der Unvollkommenheit des Bestehenden spricht, uns auch von den praktischen Schwierigkeiten zu erleichtern, die sich erheben, wenn man nach Mitteln und Wegen fragt. Es empfiehlt sich, unterwegs einmal anzuhalten, den Rucksack abzulegen, sich die Stirne zu wischen und ein wenig von den obern Hängen des Berges zu plaudern, den wir offenbar besteigen, wenn wir ihn auch der Bäume wegen nicht sehen können.
Nach der besten Politik und Methode fragen wir gar nicht. Wir wollen einmal ganz Ruhe haben vor all dem. Gerade deswegen müssen wir aber gewisse Grenzen abstecken. Könnten wir unserer freien Neigung folgen, so würden wir wahrscheinlich mit Morris in sein Nirgendwo gehen, wir würden die Natur der Menschen und der Dinge zugleich ändern, das ganze Geschlecht weise, duldsam, edel, vollkommen machen – eine glänzende Anarchie willkommen heißen, wo jeder tut, wie es ihm gefällt, und wo es keinem gefällt, Böses zu tun, da er ja in einer Welt lebt, die im Kern ihres Wesens so gut, so vollkommen und strahlend ist, wie die Welt vor dem Sündenfall. Aber das goldene Zeitalter, die vollkommene Welt muß sich in das finden, was Raum und Zeit möglich machen. In Raum und Zeit unterhält der Wille zum Leben ewige Kämpfe. Also muß unser Unternehmen auf eine Grundlage kommen, die wenigstens praktischer ist als die erwähnte. Wir müssen uns zunächst auf das beschränken, was unter solchen Menschen möglich ist, wie sie heutzutage um uns leben, dann auch die Feindseligkeit und den Widerstand der Natur in Rechnung ziehen. Unser Staat soll geschaffen werden für eine Welt, wo es unbeständige Jahreszeiten, plötzliche Katastrophen, tückische Krankheiten, gefährliche Tiere und Gift gibt, und er soll aus Menschen bestehen, die ähnliche Leidenschaften, Launen und Begierden haben wie wir. Und diese Welt des Kampfes nehmen wir an, wir entsagen ihr nicht und schließen uns nicht asketisch ab gegen sie, sondern wollen sie, wie die Menschen des Okzidents, aushalten und überwinden. Insoweit entfernen wir uns nicht von denen, die sich nicht mit Utopien, sondern mit der Welt von heute beschäftigen.
Gewisse Freiheiten werden wir uns mit dem jetzt Bestehenden freilich erlauben, und hierin folgen wir unsern besten Vorgängern. Wir setzen voraus, daß die öffentliche Meinung etwas ganz anderes bedeuten kann als gegenwärtig. Wir gestatten uns freie Hand in Beziehung auf die geistigen Lebenskämpfe, natürlich innerhalb dessen, was für den menschlichen Geist nach unseren Kenntnissen möglich ist. Ebenso wollen wir frei umgehen dürfen mit dem, was wir die Lebensausstattung heißen möchten, die sich der Mensch zurechtgemacht hat, mit Häusern, Straßen, Kleidern, Kanälen, Werkzeugen, mit Gesetzen, Grenzen, Konventionen und Überlieferungen, mit Schulen, mit Literatur und religiösen Einrichtungen, mit Glauben und Sitten, kurz mit allem, was zu ändern in der Macht des Menschen liegt. Dies ist denn auch die erste Voraussetzung aller älteren und neueren utopistischen Spekulationen: Platos Republik und seine Gesetze, Mores Utopia, Howells Altruria und Bellamys zukünftiges Boston, Comtes Große Westliche Republik, Hertzkas Freiland, Cabets Ikaria und Campanellas Sonnenstadt, sie alle sind auf die Annahme gestellt, daß ein menschliches Gemeinwesen sich gänzlich lossagen kann von Überlieferungen, Gewohnheiten, Gesetzen und jener feineren Knechtschaft, die der Besitz mit sich bringt. Und ein großer Teil des wahren Wertes solcher Spekulationen liegt in der Annahme der Emanzipation, in dem Aufblick zu einer menschenwürdigen Freiheit, in dem nie erlöschenden Interesse für die Möglichkeit, den eigenen Fesseln zu entrinnen, dem Kausalzwang der Vergangenheit zu widerstehen, dem Alten zu entfliehen, neue Ziele aufzustellen, zu erstreben und zu erreichen.
§ 2
Auch sehr bestimmte künstlerische Grenzen finden wir vor. Utopistische Spekulationen müssen immer etwas Trockenes und Lebloses an sich haben. Die Nüchternheit des Stoffes zeigt sich immer und überall an ihnen. Das Blut, die Wärme, die lebendige Wirklichkeit fehlt ganz, wir sehen keine Individualitäten, sondern nur Leute im allgemeinen. Fast in jeder Utopie – die »Nachrichten von Nirgendwo« von Morris vielleicht ausgenommen – sieht man hübsche, aber stillose Gebäude, regelmäßige, reinliche Feldanlagen und eine Menge von Einwohnern, die alle gesund, glücklich, wohlgekleidet, aber ohne jede persönliche Eigenart sind. Nur zu oft ist die Szene einem großen Gemälde ähnlich, wie sie vor bald fünfzig Jahren so beliebt waren, wo man Krönungsfeierlichkeiten, königliche Hochzeiten, Parlamentssitzungen, Konferenzen und Versammlungen sieht, jede Gestalt aber an der Stelle des Gesichtes ein reinliches Oval trägt, worauf ihre Nummer fein leserlich geschrieben ist. Dies macht den unverbesserlichen Eindruck der Nichtwirklichkeit, und ich weiß nicht, wie dem auszuweichen wäre. Es ist ein Nachteil, den man eben hinnehmen muß. Was einmal dagewesen ist oder da ist, das hat, wäre es auch noch so verkehrt und widersinnig, durch seine Berührung mit Individualitäten etwas Wirkliches und Festes in sich, das dem Nieerprobten ganz fehlt. Es ist gewachsen und geworden, es ist durch Gebrauch und Zeit befleckt und schadhaft, es ist abgerundet und abgerieben, vielleicht in einer Flut von Blut und Tränen getauft worden. Was aber nur gedacht und eingebildet ist, das muß, wäre es noch so vernünftig und selbst notwendig, sonderbar und unmenschlich erscheinen mit seinen deutlichen, scharfen, rücksichtslosen Linien, seinen unsanften Ecken und Flächen. –
Das läßt sich nicht ändern – da liegt’s. Und der Meister leidet darunter mit dem letzten und geringsten seiner Nachfolger: Plato mag die ganze Menschheit gewonnen haben mit der dramatischen Erfindung seines Dialogs, aber ich zweifle, ob er je einen einzigen zu dem Wunsche begeistert hat, ein Bürger seiner Republik zu sein, und ich zweifle, ob jemand einen Monat der allgemeinen Tugend aushalten könnte, von der More träumte. Niemand will wirklich in einer Verkehrsgemeinschaft leben, wenn er nicht Individualitäten dort antreffen kann. Der befruchtende Kampf unter den einzelnen ist der letzte Sinn des persönlichen Lebens, und alle Utopien können nicht mehr tun, als Verbesserungen dieses Gegenspiels vorschlagen. Nach dieser Richtung entspricht die Umgestaltung des Lebens modernen Anschauungen. Bevor wir nicht Individualitäten beibringen, kann nichts in die Entstehung treten, und ein Weltall verschwindet, wenn wir den Spiegel zerbrechen, in welchem es selbst in dem geringsten individuellen Geiste erscheint.
§ 3
Eine moderne Utopie beansprucht für ihre Darstellung nicht weniger als einen ganzen Planeten. Es gab eine Zeit, da ein Gebirgstal oder eine Insel einem Gemeinwesen genügenden Abschluß boten, um gegen jede Beunruhigung von außen geschützt zu sein. Platos Republik war beständig in Waffen für einen Verteidigungskrieg, und die Neue Atlantis und Mores Utopie erhielten sich in der Theorie – wie China und Japan viele Jahrhunderte lang in Wirklichkeit – abgeschlossen gegen alle Eindringlinge. Neuere Bücher dieser Art, wie Butlers satirisches Erewhon und Steads Königintum der umgekehrten Sexualverhältnisse in Zentralafrika hielten das tibetanische Verfahren, den forschenden Besucher zu erschlagen, für ein einfaches und ausreichendes Mittel. Aber die ganze Richtung modernen Denkens ist jeder beständigen Abschließung entgegen. Heutzutage sind wir uns wohl bewußt, daß jenseits der Grenzen auch des noch so fein ausgedachten Staates die Macht ansteckender Krankheiten, lauernder Barbaren oder fremder Wirtschaftsverhältnisse jederzeit ihre Kräfte sammeln kann, uns niederzuringen. Der Eindringling kann sich den raschen Gang der Erfindungen zunutze machen. Nun kannst du vielleicht noch eine felsige Küste oder einen Paß halten, was aber dann, wenn schon morgen das Luftschiff über dir erscheint und sich niedersenken kann, wo es ihm beliebt? Wäre ein Staat mächtig genug, sich unter modernen Verhältnissen abgeschlossen zu halten, so müßte er auch mächtig genug sein, die Welt zu beherrschen, und wenn er sie nicht selbst beherrschte, so müßte er doch alle andern menschlichen Gemeinwesen ruhig dulden und für sie die Verantwortung tragen. Es müßte also ein Weltstaat sein.
So kann ein modernes Utopien nicht in Zentralafrika oder in Südamerika oder um den Pol herum liegen, wo die letzten Zufluchtsstätten aller Ideale sind. Auch die schwimmende Insel der Cité Morellyste ist nicht mehr brauchbar. Wir brauchen einen Planeten. Lord Erskine, der Verfasser einer Utopie (der »Armata«), die von Hewins inspiriert sein könnte, erkannte dies zuerst von allen Utopisten – er verband seine Zwillingsplaneten von Pol zu Pol durch eine Art Nabelschnur. Aber die Phantasie des Modernen, die sich an die Naturwissenschaften zu halten hat, darf sich damit nicht begnügen.
Jenseits des Sirius, verloren im Raum, weiter entfernt als der Flug einer Kanonenkugel, die eine Billion Jahre unterwegs ist, außerhalb des Bereichs unserer schwachen Einbildungskraft, flammt der Stern, der unseres Utopiens Sonne ist. Wer weiß, wohin er seine guten Augen durch ein gutes Fernrohr richten muß, der sieht diesen Stern mit drei Genossen, die sich eng um ihn zu stellen scheinen – obgleich sie uns unglaublich viele Billionen Meilen näher sind – gerade noch als einen ganz schwachen Lichtfleck. Planeten umwandeln ihn, genau wie unsere Planeten, aber an einem andern Schicksal webend, und unter ihnen steht Utopien an seiner Stelle, mit seinem brüderlichen Gefährten, dem Mond. Ein Planet wie der unsere: dieselben Kontinente, Inseln, Meere und Seen, ein zweiter Fuji-Yama ragt prächtig empor über ein zweites Yokohama, und ein Matterhorn schaut über das eisige Labyrinth eines Theodule hinweg. Er ist unserm Planeten so ähnlich, daß ein Botaniker der Erde dort jede seiner Pflanzenarten finden könnte bis zur gemeinsten Teichalge oder der seltensten Alpenblume.
Wenn er aber die letztere gepflückt hätte und sich nach seinem Gasthaus umsehen wollte … er fände dies sein Gasthaus vielleicht nicht!
Denke dir nun, es stehen wirklich zwei Menschen da und sehen sich genau in dieser Weise um. Ich sage zwei, denn einem fremden Planeten – und wäre es auch ein ganz zivilisierter – ohne den Rückhalt eines Freundes entgegenzugehen, das wäre zu viel für den Mut eines einzelnen. Denke dir also, wir wären, wie wir gehen und stehen, dorthin entrückt. Du magst dir vorstellen, wir befänden uns auf einem hohen Paß in den Alpen, und obgleich ich selbst kein Botaniker bin – ich bekomme nämlich leicht Schwindel vom Bücken –, so würde ich doch nicht Streit anfangen, wenn mein Begleiter eine Botanisierbüchse am Arm trüge, nur dürfte sie nicht mit dem so beliebten, unausstehlichen Schweizer Apfelgrün lackiert sein. Wir sind umhergewandert, haben botanisiert, uns dann zum Ausruhen niedergelassen und, zwischen den Felsen sitzend, unsern Imbiß verzehrt, eine Flasche Yvorne getrunken, ein Gespräch über Utopien angefangen, und ungefähr das gesagt, was ich soeben vorgetragen habe. Ich selbst könnte mir dies auf dem kleinen Joch des Lucendropasses vorstellen, auf dem Rücken des Piz Lucendro, denn da habe ich einmal sehr angenehm gefrühstückt und geplaudert. Wir sehen hinunter ins Val Bedretto, und Villa, Fontana und Airolo wollen sich vor uns verstecken unter dem Berghang – dreiviertel Meilen entfernt liegen sie senkrecht in der Tiefe (Laterne). Mit der absurden Scheinwirkung der Nähe, wie man sie in den Alpen erlebt, sehen wir den kleinen, zwölf Meilen entfernten Eisenbahnzug die Biaschina entlang nach Italien hinunterfahren, und der Lukmanier Paß hinter Piora, links von uns, und der San Giacomo rechts liegen wie Fußpfade unter uns …
Und siehe! in einem Nu sind wir in jener andern Welt!
Kaum würden wir die Verwandlung bemerken. Keine Wolke weniger am Himmel. Vielleicht würde die ferne Stadt da unten ein wenig anders aussehen, und mein Gefährte, der Botaniker, könnte mit seiner geübten Beobachtungsgabe auch gerade soviel entdecken. Der Zug wäre vielleicht von dem Bilde verschwunden, ebenso die gerade Linie des in den Ambri-Piotta-Wiesen regulierten Tessin – dies wäre etwa die Veränderung, aber auch die einzige wahrnehmbare. Es fällt mir jedoch ein, wie wir uns des Unterschieds der Dinge plötzlich dunkel bewußt werden könnten.
Der Botaniker würde sich leise versucht fühlen, mit seinen Blicken Airolo wieder zu suchen. »Sonderbar«, würde er in aller Ruhe sagen, »dies Gebäude da rechts habe ich noch nie bemerkt.«
»Welches Gebäude?«
»Das da rechts – mit dem sonderbaren …«
»Jetzt seh’ ich’s. Ja, ja, das sieht wahrhaftig komisch aus. Und groß, sag’ ich Ihnen! Und hübsch! Ich möchte wissen – –«
Dies unterbräche unsere utopistischen Spekulationen. Zwar würden wir beide entdecken, daß die kleinen Städte unten verwandelt wären, aber wir hätten sie vorher nicht genau genug beobachtet, um zu wissen, wie. Man könnte nicht näher beschreiben, ob es eine Veränderung ihrer Gruppierung oder eine solche ihrer fernen, kleinen Umrisse sei.
Dann schnelle ich wohl einige Krümchen vom Knie und sage: »Sonderbar« zum zehnten oder elften Male, indem ich mich zum Aufstehen anschicke. Wir stünden wieder da, streckten uns und lenkten unsere Blicke, immer noch ein wenig verwundert, auf den Pfad, der über gestürzte Felsen hinabklettert, den stillen, klaren See umkreist und sich zum Hospiz des St. Gotthard niederwendet – wenn wir diesen Pfad eben noch finden könnten. Lange bevor wir ihn oder auch nur die große Straße erreicht hätten, müßte die Steinhütte in der Kehle des Passes – die verschwunden oder merkwürdig verändert wäre – müßten die Ziegen auf den Felsen und der kleine Schuppen bei der rohen steinernen Brücke uns darauf hingewiesen haben, daß eine große Wandlung über die Welt der Menschen gekommen sei.
Und gleich darauf träfen wir unter gegenseitigem Erstaunen auf einen Menschen – keinen Schweizer – in ungewohnter Kleidung und mit einer nie gehörten Sprache.
§ 4
Vor Einbruch der Nacht wären wir gesättigt mit Wunderdingen, aber immer noch bliebe uns ein Staunen übrig für etwas, das mein Begleiter mit seiner wissenschaftlichen Ausbildung ohne Zweifel als erster sähe. Er schaut empor mit dem Kennerblick eines Mannes, der seine Sternbilder bis auf die kleinen griechischen Buchstaben beherrscht. Ich kann mir seinen Ausruf vorstellen. Zuerst traut er seinen Augen kaum. Ich erkundige mich nach dem Grund seiner Bestürzung – sie wäre gewiß schwer zu erklären. Er fragt mich etwas sonderbar nach dem Orion, aber ich finde ihn nicht, dann nach dem Großen Bären: er ist verschwunden. »Wo?«, frage ich, »wo denn?«, und suche in dem zerstreuten Gewimmel der Sterne … und langsam beschleicht auch mich die Verwunderung, die ihn erfüllt.
Da müßte uns an diesem unbekannten Sternenhimmel vielleicht zum erstenmal klar werden, daß nicht die Welt sich geändert hätte, sondern daß wir selbst in die tiefsten Tiefen des Raumes versetzt worden wären.
§ 5
Wir brauchen für den Verkehr keine sprachlichen Hindernisse anzunehmen. Die ganze Welt wird sicherlich eine gemeinsame Sprache besitzen, das gehört zu den ersten Voraussetzungen einer Utopie. Da wir nicht so gebunden sind, wie jener, der eine Erzählung glaubhaft machen muß, so können wir annehmen, diese Sprache komme der unsrigen nahe genug, um verständlich zu sein. Wären wir überhaupt in Utopien, wenn wir nicht mit jedermann sprechen könnten? Jene fluchbeladene Sprachenschranke, jene feindliche Inschrift in des Ausländers Auge »taub und stumm für Sie, mein Herr, und also – Ihr Feind«, ist der allererste von den Mängeln und Mißständen, denen man durch die Flucht von der Erde entrinnen wollte.
Doch, welche Sprache müßte nach unserm Wunsche die Welt sprechen, wenn es hieße, das Wunder von Babel solle sich alsbald umkehren?
Wenn ich ein kühnes Bild gebrauchen, mir eine mittelalterliche Freiheit erlauben darf, so nehme ich an, der Geist der Schöpfung spreche in dieser Einsamkeit mit uns über jenen Gegenstand. »Ihr seid kluge Leute«, möchte der Geist etwa sagen – und da ich trotz meiner Anlage zur Beleibtheit ein argwöhnischer, empfindlicher, überernster Mensch bin, so würde ich den Spott sofort wittern (mein Gefährte aber würde sich wahrscheinlich sogar noch geschmeichelt fühlen) – »und eure Weisheit zu erzeugen, wurde die Welt in erster Linie geschaffen. Ihr seid so freundlich, ein beschleunigtes Tempo in der langweiligen, vielfältigen Entwicklung zu wünschen, mit der ich mich abgebe. Dazu, merke ich, wäre euch eine Weltsprache von Nutzen. Während ich hier in diesen Bergen sitze – ich feile etwa seit diesem Äon an ihnen herum, einzig, um eure Hotels anzulocken – ihr versteht mich – wollt ihr so freundlich sein …? Ein paar Fingerzeige …?«
Dann würde der Geist der Schöpfung flüchtig lächeln, und sein Lächeln wäre, als ziehe eine Wolke dahin. Die ganze Bergwildnis um uns her stünde in strahlender Beleuchtung da. (Man kennt jene flüchtigen Augenblicke in der einsamen Wildnis, da Wärme und Glanz über sie hinhuschen.)
Sollten jedoch zwei Menschen ihr Streben aufgeben, weil der Unendliche sie belächelt? Da stehen wir mit den knorrigen, kleinen Köpfen, den Augen, Händen, Füßen und starken Herzen, und wenn nicht wir noch die Unseren, so sollen doch die endlosen Scharen, die aus uns oder andern hervorgehen, zuletzt zum Weltstaat, zu einer größeren Gemeinschaft und einer Einheitssprache gelangen. Wir wollen mit allen Kräften, wenn auch nicht die Frage beantworten, so doch ihre beste Lösung im Geiste voraussehen. Dies ist unsere Absicht: uns das Beste auszudenken und danach zu streben. Eine schlimmere Sünde und eine größere Torheit als die Anmaßung ist der Kleinmut, wenn auch der Größte unserer Großen gering erscheint unter den Sonnen des Weltalls.
Nun möchte man, denke ich mir, vielleicht eine Vorliebe für etwas haben, das man »wissenschaftlich« nennt. Wer aber bei diesem überaus beleidigenden Wort zusammenzuckt, der darf meines verständnisvollen Mitgefühls versichert sein – obgleich »pseudowissenschaftlich« und »quasiwissenschaftlich« noch eine viel schlimmere Wirkung haben. Und man finge wahrscheinlich an, von wissenschaftlichen Sprachen zu reden, vom Esperanto, von der »Langue bleue«, dem Neulatein, dem Volapük und ähnlichem. Einer würde auch behaupten, die chemische Terminologie sei von wunderbarer Genauigkeit und allumfassender Verwendbarkeit, und bei dem Worte Terminologie würde ich eine Bemerkung einflechten über jenen hervorragenden amerikanischen Biologen, Professor Mark Baldwin, der die biologische Sprache auf eine solche Höhe ausdrucksvoller Klarheit gehoben hat, daß sie mit ihrer Unlesbarkeit Triumphe feiern konnte. (Darin liegt meine Verteidigungslinie angedeutet.)
Man erläutert dieses Ideal so: es soll eine wissenschaftliche Sprache sein, ohne Zweideutigkeit, so scharf wie mathematische Formeln, und jede Bezeichnung soll mit jeder andern in genauem logischem Zusammenhang stehen. Diese Sprache wird nur regelmäßige Flexionen des Verbs und Substantivs und feste Konstruktionen haben, jedes Wort wird in Schreibung und Aussprache von jedem andern deutlich unterschieden sein.
Jedenfalls sind dies die Forderungen, die man gewöhnlich hört, und sie sind es wert, hier betrachtet zu werden, wäre es auch nur, weil ihre Zusammenhänge weit über das Gebiet der Sprache hinausreichen. Sie schließen in der Tat fast alles ein, was wir in diesem Buch zurückzuweisen bemüht sind. Zunächst dies: daß die ganze geistige Grundlage des Menschengeschlechts feststeht, daß die Regeln der Logik, die Systeme des Zählens und Messens, die allgemeinen Kategorien und Schemen der Ähnlichkeit und Verschiedenheit für den menschlichen Geist auf immer begründet sind: die reine Lehre Comtes, wie sie geschrieben steht. Es hat aber die Wissenschaft der Logik und das ganze Gerüste philosophischen Denkens, das die Menschen seit Plato und Aristoteles aufrecht erhalten haben, als endgültiger Ausdruck des menschlichen Geistes nicht mehr Dauer als der große schottische Katechismus. Aus dem Chaos des modernen Denkens erhebt sich wieder eine Philosophie, die lange vergessen war, wie ein blinder und gestaltloser Embryo, der jetzt Gesicht und Form und Kraft entwickelt, eine Philosophie, die jene Anmaßung verwirft. 1
Ich will gleich bemerken, daß man im ganzen Verlauf unseres Ausflugs ins Utopische diese neu auftauchende Bewegung lebhaft spüren wird. In dem wiederholten Gebrauch des Wortes »Einzig« wird man gleichsam den Schimmer ihres Äußeren, in der steten Betonung der Individualität und der persönlichen Verschiedenheit als der Bedeutung des Lebens aber das Gewebe ihrer sich bildenden Gestalt erkennen. Nichts dauert, nichts ist scharf und sicher (als der Geist eines Pedanten), und Vollkommenheit ist bloße Leugnung jener unvermeidlichen Verschwommenheit der Umrisse, die das innerste Geheimnis alles Seins ist. Des Seins! … es gibt kein Sein, nur ein allgemeines Werden des einzelnen, und Plato kehrte der Wahrheit den Rücken, als er sich seinem Museum der einzelnen Ideale zuwandte. Heraklit, der einsame und mißdeutete Riese, kommt vielleicht zu seinem Recht …
In unserm Wissen ist nichts Bleibendes. So wie unsere Erkenntnis deutlicher wird, hellt sie einen bisher dunkeln Hintergrund auf, und gleich erscheint hinter diesem wieder ein neuer und verschiedener. Wir können nie vorhersagen, ob nicht ein anscheinend sicherer Boden bei der nächsten Veränderung weicht. Wie töricht also, unser Denken in feste, wenn auch noch so weite Grenzen einschließen, den unendlichen Geheimnissen der Zukunft Bezeichnung und Ausdruck vorschreiben zu wollen! Wir verfolgen die Ader, bauen sie ab und häufen unsern Schatz auf; wer aber kann sagen, wohin die Ader verläuft? Die Sprache ist der Nährstoff unseres Denkens und schlägt nur an, wenn sie sich umsetzen kann in Denken, wenn sie lebt und im Leben sich verzehrt. O ihr Wissenschaftler mit eurem Hirngespinst einer Sprache von unausstehlicher Genauigkeit und unveränderlichem Bestand, euch fehlt es gar sehr an jeder Einbildungskraft!
Die Sprache Utopiens wird ohne Zweifel einheitlich sein und sich nicht mehr spalten. Die ganze Menschheit wird sich nach dem Maße der einzelnen Verschiedenheiten einen einheitlichen Resonanzboden des Denkens zu schaffen wissen, aber ihre Sprache wird immer noch eine lebende Sprache sein, ein seelenvolles Ganze aus unvollkommenen Einzelheiten, an denen jeder im kleinsten fortwährend umgestaltet. Da ein allgemeiner Austausch und Verkehr besteht, wird sich der Gesamtgeist dieser Sprache so fortentwickeln, daß seine Veränderungen immer durch die ganze Welt gehen: darin liegt eben ihre Eigenschaft als Weltsprache. Ich stelle sie mir als eine aus verschiedenen Säften genährte, als eine aus vielen einzelnen entstandene Sprache vor. Das Englische ist eine Sprache dieser Art, entstanden aus dem Angelsächsischen, dem Normannisch-Französischen und dem Gelehrtenlatein und in eine einheitliche Sprache verschmolzen, die umfassender, kräftiger und schöner ist als jede andere. Das Utopische müßte aus noch zahlreicheren Nährflüssen gebildet sein und im Rahmen einer beinahe flexionslosen Sprache, wie es das Englische ist, einen verschwenderischen Wortreichtum enthalten. Dieser wäre aus vielen früher selbständigen Sprachen zusammengeflossen, die allmählich ineinander übergingen. 2 Früher gaben sich geistreiche Männer mit der Frage ab: welche Sprache wird die andern überdauern? Diese Frage war falsch gestellt. Es scheint mir heute viel wahrscheinlicher zu sein, daß mehrere Sprachen sich vereinigen und in einem gemeinsamen Strome fortfließen.
Der vorstehende Abschnitt über die Sprachen bedeutet jedoch eine Abschweifung. Wir waren auf dem Pfad, der den Lucendrosee umkreist und eben im Begriff, dem ersten Utopier zu begegnen. Ich sagte schon, er war kein Schweizer. Und doch wäre er auf unserer alten Erde ein Schweizer gewesen und hätte auch hier dasselbe Gesicht, vielleicht mit einer kleinen Verschiedenheit im Ausdruck, denselben Körperbau, wenn auch ein wenig besser entwickelt, dieselbe Gesichtsfarbe. Er hätte andere Gewohnheiten, Überlieferungen, Kleider, Geräte, ein anderes Wissen und Vorstellen, aber davon abgesehen wäre es derselbe Mensch. Schon im Anfange faßten wir scharf ins Auge, daß ein modernes Utopien von den gleichen Menschen bewohnt sein müsse wie unsere Welt.
Darin liegt vielleicht mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. Denn diese Voraussetzung bedeutet einen charakteristischen Unterschied gegen fast alle früheren Utopien. Die unsere darf, wie wir schon betont haben, nichts Geringeres sein, als eine Weltutopie, und so müssen wir notwendig mit der Verschiedenheit der Rassen rechnen. Selbst die untere Klasse in Platos Republik war von keiner spezifisch verschiedenen Rasse. Unser Utopien soll alles umfassen, wie die christliche Barmherzigkeit: Weiße und Schwarze, Braune, Rote und Gelbe, alle Hautfarben, Körperformen und Anlagen. Wie wir ihre Verschiedenheiten in Einklang bringen, ist eine Hauptfrage und nicht geeignet, in diesem Kapitel angeschnitten zu werden. Es wird eines eigenen Kapitels bedürfen, ihre Lösung auch nur zu überblicken. Hier unterstreichen wir noch einmal die Forderung, daß die Rassen der Erde in gleicher Zahl und Art auch dort zu finden sein müssen – nur, wie gesagt, mit gänzlich verschiedenen Überlieferungen, Idealen, Vorstellungen und Zielen, und so unter jenem andern Himmel auch einem andern Geschick entgegengehend. Daraus ergibt sich eine sonderbare Folgerung für jeden, der von der Einzigkeit und der einzigen Bedeutung des Individuums durchdrungen ist. Eine Rasse ist nicht etwas Festes, Geschlossenes, keine Schar von völlig gleichen Menschen, sondern eine Häufung von Unterrassen, Stämmen und Sippen, jede einzig in ihrer Art, und wieder aus kleineren Einzelbildungen bestehend, bis hinunter auf jede einzelne Person. Wir wollen also zuerst dahin übereinkommen, daß nicht nur jeder Berg und Fluß, jede Pflanze und jedes Tier der Erde auch auf jenem Planeten jenseits des Sirius zu finden ist, sondern auch jeder lebende Mann, jede Frau, jedes Kind dort einen Doppelgänger hat. Von jetzt an werden die Schicksale dieser beiden Planeten natürlich auseinanderlaufen: hier werden Menschen sterben, die dort eine verbesserte Einsicht retten kann, vielleicht können wir auch umgekehrt Leute bei uns retten; ihnen werden Kinder geboren und uns nicht, aber auch uns und ihnen nicht. Wir stehen hier am Ausgangspunkt und sehen zum ersten- und letztenmal die Bevölkerung unserer Planeten auf gleicher Linie stehen.
In unserer Zeit ist eine andere Voraussetzung nicht mehr möglich. Sonst bliebe uns einzig ein Utopien aus engelgleichen Puppen – ein Hirngespinst von Gesetzen für undenkbare Menschen – wahrhaftig eine reizlose Aufgabe.
Zum Beispiel müssen wir dort einen Menschen annehmen, wie ich einer hätte sein können: besser gebildet und geordneter, brauchbarer, schlanker und beweglicher – und ich möchte sehen, was er umtreibt! – auch Sie, lieber Leser, liebe Leserin, haben Ihr Duplikat, und alle Männer und Frauen, die wir beide kennen. Es wäre zweifelhaft, ob wir unsere Doppelgänger träfen, oder ob dies für uns ein Vergnügen wäre; aber je mehr wir aus den einsamen Bergen hinabsteigen zu den Straßen und Häusern und bewohnten Orten des utopistischen Weltreichs, desto sicherer werden wir hin und wieder auf Gesichter stoßen, die uns ausgesprochen an jene erinnern, die unter unsern Augen gewandelt sind.
Manchem, sagen Sie, möchten Sie nicht mehr begegnen, und manchem, denke ich mir, doch. »Und gar einem …!«
Es ist merkwürdig, aber diese Gestalt des Botanikers will durchaus nicht an ihrer Stelle bleiben. Sie erhob sich zwischen uns, lieber Leser, als eine flüchtige Erfindung zu besserem Verständnis. Ich weiß nicht, wie ich auf ihn kam, es gefiel meiner Laune sogar, ihn an die Stelle Ihrer werten Person zu setzen und Sie wissenschaftlich zu nennen – was ja sehr beleidigend ist. Aber da steht er nun unstreitig neben mir in Utopien und gleitet von der Höhe unserer Spekulationen herab zu zögernden, aber recht vertraulichen Mitteilungen. Er erklärt, er sei nicht nach Utopien gekommen, um seinen Sorgen wieder zu begegnen.
Welchen Sorgen?
Ich beteure, aufs wärmste sogar, daß es weder auf ihn, noch auf seine Sorgen abgesehen war.
Er ist ein Mann von etwa neununddreißig, dessen Leben weder eine Tragödie noch ein fröhliches Abenteuer war, ein Mann mit einem Gesichtsausdruck, den das Leben eher interessant als kräftig oder edel gestaltet hat. Er hat ein etwas verfeinertes, empfindsames Wesen und eine gebildete Selbstbeherrschung; er hat mehr gelesen als gelitten und mehr gelitten als gehandelt. Er sieht mich an mit den blaugrauen Augen, aus denen alles Interesse an diesem Utopien verschwunden ist.
»Es ist dies eine Unruhe«, antwortet er, »die erst seit ungefähr einem Monat in mein Leben gekommen ist – wenigstens wieder recht fühlbar. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Es war eine …«
Die Geschichte hört sich sonderbar an auf einem Gebirgskamm in Utopien: diese Angelegenheit aus Hampstead, diese Geschichte eines Herzens aus Frognal. »Frognal«, sagt er, ist der Ort, wo sie sich begegnet sind, und ich erinnere mich, das Wort auf einem Schilde gelesen zu haben an der Ecke einer neuen, kieselgepflasterten Straße, die zur Erschließung eines Gutes angelegt war und über welcher zerstreute Villen am Hang eines Hügels stehen. Er hatte sie gekannt, ehe er seine Professur erhielt und weder ihre »Angehörigen«, noch die seinen – er spricht in jenem unausstehlichen Stil des Mittelstandes, in dem Tanten und Dinger mit Geld und mit dem Recht, sich in alles zu mischen, »Angehörige« heißen – billigten die Sache. »Sie ließ sich, wie mir scheint, etwas leicht davon abbringen«, sagt er. »Aber das ist vielleicht nicht gerecht gegen sie. Sie sah zu sehr auf die andern. Wenn sie betrübt schienen, oder wenn sie etwas für richtig hielten …«
Bin ich nach Utopien gekommen, um solche Dinge zu hören?
Der ernstere Leser mag darüber nachlesen in Sidgwicks »Logik«; der flüchtigere lese Professor Cases Artikel »Logik« im 30. Band der Britischen Enzyklopädie und beachte seine Gereiztheit. Ich habe diesem Buch eine flüchtige Skizze einer Philosophie auf dieser neuen Grundlage angefügt; sie wurde ursprünglich, 1903, der Oxforder Phil. Soc. vorgetragen. <<<
Vgl. einen ausgezeichneten Aufsatz: Die französische Sprache im Jahre 2003, von Leon Bollack, in der Revue vom 15. Juni 1903. <<<
§ 6
Ich muß die Gedanken des Botanikers auf würdigere Bahnen lenken. Es gilt, diese armselige Sehnsucht, diese aufdringliche kleine Liebesgeschichte zu überwinden. Ist er sich klar darüber, daß dies hier wirklich Utopien ist? Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit meinem Utopien hier zu, und überlassen Sie diese irdischen Nöte ihrem eigenen Planeten. Können Sie sich genau vorstellen, wohin die für eine moderne Utopie nötigen Voraussetzungen uns führen? Ein jeder von der Erde muß hier sein – als er selbst, nur mit einer gewissen Veränderung. Irgendwo ist zum Beispiel Herr Chamberlain in dieser Welt, auch der König von England ist da (ohne Zweifel inkognito) und die ganze Königliche Akademie.
Aber diese berühmten Namen machen keinen Eindruck auf ihn.
Mein Geist geht von einer hervorragenden und bedeutsamen Persönlichkeit zur andern, und ich vergesse meine Gefährten für einige Zeit. Die seltsamen Nebenschlüsse, die sich aus unserer allgemeinen Annahme ergeben, lenken mich ab. Name und Gestalt des Herrn Roosevelt treten in den Brennpunkt meiner Vorstellung, und ich vergesse darüber einen Versuch, den deutschen Kaiser zu akklimatisieren. Was soll Utopien zum Beispiel mit Herrn Roosevelt beginnen? Über mein inneres Gesichtsfeld gleitet das Bild eines heftigen Kampfes mit utopischen Konstablern, die Stimme erklingt, die auf der Erde Millionen in beredtem Protest durchschauert hat. Der Haftbefehl, der im Kampf lose umherfliegt, fällt mir zu Füßen. Ich fange das Blatt auf und lese – ist’s möglich? – »Versuch der Auflösung? … Aufreizung zu Unruhen? … Gleichgewicht der Gesellschaft?«
Die Richtung meines Denkens hat uns auf einmal in eine heitere Gasse geführt. Man könnte auch bei dieser Tonart bleiben und eine hübsche, kleine Utopie verfassen, die wie die heiligen Familien mittelalterlicher Künstler (oder Michelangelos Jüngstes Gericht) unsern Freunden in verschiedener Weise schmeicheln müßte. Oder man ließe sich auf eine spekulative Behandlung des ganzen Gothaischen Almanachs ein, etwa in der Art von Epistemons Vision der verdammten Großen, wo es heißt:
»Xerxes war ein Senfausrufer, Romulus war Salzer und Holzschuhflicker …«
Ein unvergleichlicher Katalog! ein unvergleichlicher Katalog! Von der Muße der Parodie erleuchtet, könnten wir die Seiten des Almanachs vornehmen und, mit einem Blick auf die überzeugteste Republik, auch einen »Adelsalmanach von Amerika« und die köstlichsten und ausgedehntesten Verbindungen anordnen. Wohin nun mit diesem ganz ausgezeichneten Mann? Und mit diesem hier? …
Aber es ist ja zweifelhaft, ob wir auf unserer Reise in Utopien einen von diesen Doppelgängern treffen oder erkennen, wenn wir ihn treffen. Ich glaube nicht, daß irgend jemand es in beiden Welten zu etwas bringt. Die größten Männer in diesem noch unerforschten Utopien sind vielleicht bei uns nur Dorfhelden, während die Ziegenhirten und der unwissende Pöbel der Erde dort auf den Sesseln der Macht sitzen.
Dies öffnet wiederum angenehme Ausblicke nach allen Seiten hin.
Aber von neuem drängt mein Botaniker seine Persönlichkeit dazwischen. Seine Gedanken sind eine andere Straße gewandelt.
»Ich weiß«, sagt er, »sie wird hier glücklicher sein, und man wird sie besser würdigen als auf der Erde.«
Seine Unterbrechung bringt mich wieder zurück von der Betrachtung jener populären Götzenbilder, die von alten Zeitungen und leerem Gerede aufgeblasen werden, den Großen der Erde. Ich muß an die persönlichen und vertrauten Beziehungen denken, die uns mit jenen Leuten verbinden, welche man mit einer gewissen Annäherung an wirkliche Kenntnis kennt, an die gewöhnliche Wirklichkeit des täglichen Lebens. Er bringt mich auf Gedanken an Eifersüchteleien und Zärtlichkeiten, Streitigkeiten und Enttäuschungen. Ich denke plötzlich mit einer gewissen Wehmut daran, wie die Dinge sich hätten zutragen können. Wie, wenn wir hier anstatt nichtssagender Nummern verlassene Geliebte, versäumte Gelegenheiten und die Gesichter so träfen, wie sie für uns hätten aussehen können? Ich wende mich fast tadelnd an meinen Botaniker. »Sie wissen, hier wird sie nicht ganz dieselbe Dame sein, die Ihnen in Frognal bekannt war«, sage ich und reiße mich von einem Thema los, das mir nicht länger angenehm ist, wobei ich aufspringe.
»Und überdies«, fahre ich, zu ihm niedersehend, fort, »ist die Wahrscheinlichkeit, daß wir ihr begegnen, eins zu einer Million … und wir trödeln! Dies war nicht die Sache, um die es sich handelte, sondern eine gelegentliche Abschweifung von unserm weiteren Plan. Es bleibt die Tatsache: diese Menschen, die wir hier sehen wollen, sind Menschen mit der gleichen Schwäche wie wir – nur die Verhältnisse sind andere. Lassen Sie uns den Gang unserer Forschung weiter verfolgen.«
Damit gehe ich voran, rund ums Ufer des Lucendrosees unserer utopischen Welt entgegen.
(Stellt euch vor, wie er es tut.)
Den Berg hinab werden wir gehen und die Pässe hinab, und so wie die Täler sich öffnen, wird auch die Welt sich auftun, Utopien, wo die Männer und Frauen glücklich sind, und die Gesetze weise, und wo alles Verschlungene und Verwirrte in den Dingen der Menschen entwirrt und geordnet ist.
Zweites Kapitel: Von der Freiheit
§ 1
Auf was für eine Frage müßten zwei Menschen, die auf den Planeten der modernen Utopie versetzt worden sind, wohl zuerst stoßen? Wahrscheinlich wären sie in ernster Sorge um ihre persönliche Freiheit. Ich habe schon bemerkt, daß die früheren Utopien gegen den Fremden ihre unliebenswürdigste Seite kehrten. Würde unsere neue Art eines utopischen Staates, der sich über eine ganze Welt erstreckt, weniger abschließend sein?
Wir könnten uns trösten mit dem Gedanken, daß allgemeine Duldung gewiß zu den modernen Ideen gehört, und auf solchen ruht doch dieser Weltstaat. Angenommen, wir würden also geduldet und wie jeder als Bürger zugelassen, so bliebe doch noch ein weiter Bereich der Möglichkeiten … Ich glaube, dem Problem wäre beizukommen, wenn wir nach seinen ersten Grundsätzen suchen und dabei der Richtung unserer Zeit folgen, indem wir die Frage als die des Verhältnisses des Menschen zum Staat auffassen und die der Freiheit zu machenden Zugeständnisse erörtern.
Die Idee der persönlichen Freiheit gehört zu jenen, die mit der Entwicklung des modernen Denkens an Bedeutung fortwährend zunehmen. Den klassischen Utopisten war die Freiheit verhältnismäßig unbedeutend. Sie sahen Tugend und Glück als unabhängig an von der Freiheit und als weit bedeutendere Dinge. Unsere heutige Ansicht aber mit ihrer starken Betonung der Individualität erhöht beständig den Wert der Freiheit, bis diese schließlich als der eigentliche Sinn des Lebens, ja als das Leben selbst erscheint, und ein unweigerlicher Gehorsam gegen das Gesetz nur noch den toten Dingen zukommt, die keine Selbstbestimmung haben. Spielraum für die eigene Individualität zu haben, ist nach modernen Begriffen der subjektive Triumph des Daseins, wie das Fortleben in einem schöpferischen Werk oder in der Nachkommenschaft dessen objektiver Triumph ist. Da aber der Mensch ein geselliges Wesen ist, so muß für jeden der freie Spielraum des Willens weit hinter einer absoluten Freiheit zurückbleiben. Eine solche ist nur einem Despoten möglich, dem alles unbedingt gehorcht. Wollen hieße dann auch Befehlen und Ausführen, und wir könnten innerhalb der Grenzen der Naturgesetze jederzeit so handeln, wie es uns beliebte. Jede andere Freiheit ist ein Übereinkommen zwischen unserer eigenen und der Willensfreiheit aller Mitmenschen, mit denen wir in Berührung kommen. In einem geordneten Staate handelt ein jeder von uns gegen sich selbst und gegen die andern nach einem mehr oder weniger ausführlichen Gesetz. Er schränkt andre ein durch seine Rechte und wird durch die der andern und durch Rücksichten auf die allgemeine Wohlfahrt selbst eingeengt.
In einem Gemeinwesen hat die persönliche Freiheit, um mit dem Mathematiker zu reden, nicht immer das gleiche Vorzeichen. Dies zu übersehen ist der Hauptirrtum der übertriebenen Betonung des Individualismus. Tatsächlich kann ein allgemeines Verbot in einem Staate die Summe der Freiheiten vergrößern, eine allgemeine Erlaubnis sie verkleinern. Es ergibt sich nicht, daß, wie jene Leute uns einreden wollen, ein Mensch da am freiesten ist, wo am wenigsten Gesetz, und am unfreiesten, wo das meiste Gesetz herrscht. Ein sozialistischer oder kommunistischer Staat braucht noch keine Sklaverei zu bedeuten, und in einer Anarchie gibt es eine Freiheit überhaupt nicht. Man bedenke, welche Freiheit wir gewinnen durch den Verlust der allgemeinen Freiheit des Tötens. So können wir in allen geordneten Ländern der Welt verkehren, brauchen weder Waffen noch Rüstung zu schleppen, weder tückisches Gift noch launische Barbiere, noch Falltüren in Gasthäusern zu fürchten. Dies bedeutet tatsächlich eine Freiheit von tausend Ängsten und Vorkehrungen. Wenn auch nur die Freiheit bestünde, Blutrache zu üben, was trüge sich dann alles zu in unsern Vorstädten! Man stelle sich vor, in welch gefährlicher Lage sich zwei Hauswesen einer modernen Vorstadt befänden, die in Streit geraten und mit modernen Waffen versehen wären, gefährlich nicht bloß für einander, sondern auch für den neutralen Fußgänger. Es würde dies den tatsächlichen Verlust jeder Freiheit bedeuten für alle um sie her. Der Fleischer müßte, wenn er überhaupt noch käme, seine Runde in einem gepanzerten Wagen ausführen …
Daher muß in einem modernen Utopien, das als Endziel eine freie Entwicklung der Individualitäten aufstellt, der Staat alle Auswüchse der Freiheit, wodurch die wahre Freiheit erstickt wird, aber auch nur diese, beschnitten, und so die größte allgemeine Freiheit erreicht haben.
Es gibt zwei deutliche, einander entgegengesetzte Arten, die Freiheit zu beschränken: die erste ist das Verbot »du sollst nicht«, die zweite das Gebot »du sollst«. Das Verbot kann aber auch die Form eines bedingenden Gebotes annehmen, darauf muß man besonders achten. Es sagt dann: wie du das und das erreichen willst, mußt du so und so handeln, zum Beispiel: wenn du mit deinen Angestellten aufs Meer gehst, so mußt du ein seetüchtiges Schiff haben. Das reine Gebot aber ist unbedingt; es sagt: dies mußt du tun, ohne Rücksicht auf das, was du ausgeführt hast, eben tust oder zu tun beabsichtigst, so wenn die sozialen Verhältnisse durch den gemeinen Zwang gemeiner Eltern und schlechter Gesetze ein Kind mit dreizehn Jahren in die Fabrik schicken. Das Verbot nimmt aus der unbegrenzten Freiheit eines Menschen ein begrenztes Ding heraus, überläßt aber seiner freien Wahl noch eine unendliche Zahl von Handlungen. Er bleibt frei, und es ist ihm aus dem Meer seiner Freiheit nur ein Eimer voll genommen worden. Der Zwang aber zerstört die Selbstbestimmung gänzlich. In unseren Utopien mag es viele Verbote geben, aber keinen mittelbaren Zwang – wenn sich Mittel und Wege finden lassen – und wenige oder keine Gebote. Soweit die vorliegende Untersuchung es mich erkennen läßt, glaube ich, man wird in Utopien überhaupt keinen Zwang brauchen, wenigstens nicht für die Erwachsenen – abgesehen davon, daß er als verdiente Strafe auferlegt werden kann.
§ 2
Unter was für Verboten stünden wir beiden Ausländer wohl in dieser utopischen Welt? Gewiß dürften wir nicht jeden beliebigen, dem wir begegnen, töten, anfallen oder bedrohen, und so etwas ließen sich auf der Erde erzogene Menschen kaum zuschulden kommen. Bis wir den in Utopia geltenden Begriff von Eigentum genauer kännten, wären wir sehr behutsam, etwas anzurühren, das vielleicht jemand gehört. Wenn es nicht Privateigentum wäre, möchte es ja Eigentum des Staates sein. Aber noch andre Zweifel hätten wir. Sind wir befugt, solch fremdartige Kleider zu tragen, unsern Weg quer über die Felsen und Rasen nach Gefallen einzuschlagen, hineinzuschreiten mit nicht desinfizierten Rucksäcken und schneefeuchten Gebirgschuhen in eine augenscheinlich äußerst saubere und geordnete Welt? Wir sind am ersten Utopier vorbeigekommen mit einem flüchtigen gegenseitigen Gruß und haben mit einer heimlichen Befriedigung bemerkt, daß er keinen Anfall des Entsetzens bekam, und jetzt, da wir um eine Krümmung gekommen sind, sehen wir etwas fern unten im Tal, das wie eine außerordentlich wohl gepflegte Straße aussieht …