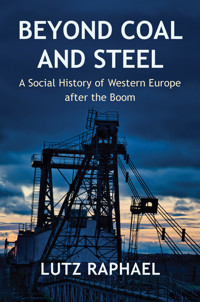21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
In den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde Westeuropa von einem beispiellosen Strukturwandel erfasst: Die Fabriken der alten Industrien verschwanden und vormals boomende Städte gerieten in die Krise. Was aber ist aus dem stolzen Industriebürger geworden? Welche Ideen und Ideologien begleiteten den Wandel? Am Beispiel der Industriearbeit in Großbritannien, Frankreich und der Bundesrepublik erzählt Lutz Raphael die außerordentlich vielschichtige und spannende Geschichte der westeuropäischen Deindustrialisierung, die bis heute fortwirkt – als Vorgeschichte unserer postindustriellen Gegenwart. Dieses vieldiskutierte Buch hilft, sie zu verstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 711
Ähnliche
3Lutz Raphael
Jenseits von Kohle und Stahl
Eine Gesellschaftsgeschichte Westeuropas nach dem Boom
Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2018
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Einleitung:. Perspektiven einer Gesellschaftsgeschichte Westeuropas nach dem Boom
Eine Geschichte »von unten«
Eine Geschichte »von gestern aus«
Bezugspunkte einer Gesellschaftsgeschichte der Deindustrialisierung
Gesellschaftsgeschichte: Tragweite eines Konzepts
Methodische Komplikationen: Nah- und Fernsichten, Theorieeffekte und Quellenauswahl
I
. Die Vogelperspektive. Drei nationale Arbeitsordnungen im Umbruch
1. Industriearbeit in Westeuropa nach dem Boom: Die politökonomische Perspektive
Deindustrialisierung in Westeuropa
Neue Technologien industrieller Produktion
Geldwertstabilität, Industriesubventionen und Privatisierungen
Auf dem Weg in den Finanzmarktkapitalismus
Arbeiterinnen und Arbeiter in Zeiten der Deindustrialisierung
Kumulative Dynamiken des wirtschaftlichen Strukturwandels
2. Der Abschied von Klassenkämpfen und festen Sozialstrukturen
Eine Wissensgeschichte der Umbrüche
Neoliberale Krisendiskurse und Trenddeutungen
Drei nationale Perspektiven auf den demokratischen Klassenkonflikt
Von Amts wegen: Soziale Klassifizierungen
Neue Grenzlinien
Neue politische Mobilisierungssprachen
Kulturelle Repräsentationen industrieller Arbeitswelten im Umbruch
Zwischen Sprachlosigkeit und Verschwinden: Unschärfen in der sozialen Wahrnehmung industrieller Wirklichkeiten
3. Politikgeschichte von »unten«: Arbeitskämpfe und neue soziale Bewegungen
Nationalspezifische Rahmenbedingungen von Sozialprotesten und Arbeitskonflikten
Militanz und neue soziale Bewegungen (1968-1979)
Mobilisierung und Protest in der Krise (1979-1990)
Die Rückkehr der Rebellion (1990-2005)
Der Abschied der Industriearbeiter von der politischen Bühne
4. Von Industriebürgern und Lohnarbeitern: Arbeitsbeziehungen, Sozialleistungen und Löhne
Industrielle Lohnarbeit und soziale Sicherheit Anfang der 1970er Jahre
Die Erosion des kollektiven Tarifrechts
Löhne und Entgeltsysteme im Umbruch
Individuelle Schutzrechte im Zeichen der Verrechtlichung
Der Abschied vom Sozialpaket
Krise der Sozialbürgerschaft
5. Facharbeit, Produktionswissen und Bildungskapital: Deutungskämpfe und Neuarrangements
Produktionswissen und Bildungskapital: Eine Geschichte langer Dauer
Postindustrielle Bildungsideologien
Die vielen Leben des deutschen Berufsbildungssystems
Kompetenzerwerb, Wissensverlust und Dequalifizierung: Britische Wege in die Wissensgesellschaft
Traditionelle Distanz und neue Hierarchien: Bildungstitel und Produktionswissen in Frankreich
Wissensordnungen und neue Produktionsregime
Gewinner und Verlierer
II
. Nahaufnahmen. Erfahrungsräume und Erwartungshorizonte im Wandel
6. Lebensläufe, Berufskarrieren und Jobsuche in Umbruchzeiten
Arbeitsbiographien und Lebenslaufforschung
Wege in die Industriearbeit in den 1950er und 1960er Jahren
Kontinuität und Wandel: Berufskarrieren und Arbeitsbiographien nach dem Boom in Frankreich
Großbritannien: Arbeiterbiographien zwischen Katastrophe und Umbruch
Westdeutsche Industriearbeit zwischen Aufstieg und prekärer Stabilität
Heirat, Hausstand, familiäre Solidarität
Blicke zurück, Blicke nach vorn
7. Betriebliche Sozialordnungen im Umbruch
Die Fabrik als »soziales Handlungsfeld«
Das Unternehmen als Kreuzungspunkt von Solidaritäten und Bindungen
Institutionelle Rahmenbedingungen und langfristige Prägungen im Drei-Länder-Vergleich
Betriebliche Sozialordnungen in der Automobilindustrie 1970-2000
Das außergewöhnlich Normale: Notgemeinschaften, Befreiungen und Auflösungen
Der Industriebetrieb als Sicherheitsinsel
8. Industriedistrikte, »Problemviertel« und Eigenheimquartiere: Sozialräume der Deindustrialisierung
Neue regionale Disparitäten
Industriedistrikte im Strukturwandel
Von der Trabantenstadt zum »Problemviertel« und zur Reihenhaussiedlung
Doppelte Abwesenheit: Transiträume
Das Ende der sozialmoralischen Milieus und die Krise lokaler Arbeiterkulturen
Schluss: Die Gesellschaftsgeschichte der Deindustrialisierung als Problemgeschichte unserer Gegenwart?
Dank
Literatur und Quellen
Register
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58
57
60
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
99
98
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
114
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
124
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
138
137
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
156
154
157
158
159
160
161
162
163
164
166
165
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
181
182
180
184
185
183
186
187
189
190
188
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
213
214
212
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
242
241
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
258
257
259
260
261
262
264
263
265
266
267
268
269
270
271
272
274
275
273
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
293
292
294
295
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
323
322
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
336
335
337
339
338
340
341
342
343
344
345
347
348
346
349
350
351
352
353
354
355
356
358
357
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
392
391
393
394
396
395
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
422
421
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
437
436
438
439
440
441
443
442
444
445
446
447
448
450
449
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
89Einleitung:
Perspektiven einer Gesellschaftsgeschichte Westeuropas nach dem Boom
Dieses Buch beschäftigt sich mit den Umständen und Folgen eines tiefgreifenden und krisenbeschleunigten Strukturwandels, der alle westeuropäischen Länder zwischen 1970 und 2000 erfasst hat. Hauptcharakteristikum dieses Wandels ist der vielgestaltige Rückgang des industriellen Sektors der jeweiligen Volkswirtschaften beziehungsweise Wirtschaftsräume, weshalb er gern als »Deindustrialisierung« bezeichnet und als Übergang von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft beschrieben wird. Vor allem die Fabriken der »alten« Industrien – Stahlwerke, Kohlezechen, Schiffswerften und Textilfabriken –, die in den Boom-Jahren des Wirtschaftswunders das Rückgrat dieser Volkswirtschaften gebildet hatten, verschwanden im Zuge dieses Transformationsprozesses und mit ihnen Millionen von Arbeitsplätzen; zugleich und mit der Schrumpfung industrieller Beschäftigung aufs Engste verknüpft kam es zu einer signifikanten Steigerung der Arbeitsproduktivität in diesem Sektor. Technologisch waren diese Jahrzehnte geprägt durch die Ausbreitung der elektronischen, das heißt computergestützten Datenverarbeitung in allen Bereichen der Industrieunternehmen, von der Produktion bis hin zum Kundenkontakt, was weitreichende Veränderungen nach sich zog. Insgesamt handelt es sich bei dem in diesem Buch beschriebenen Strukturwandel um einen langfristigen Trend, an den wir uns in Westeuropa wie an ein Naturgeschehen gewöhnt haben. Aus der Sicht des Historikers ist er einer jener Basisprozesse, vergleichbar mit der Zunahme der Lebenserwartung oder der Pluralisierung von Lebensformen.
Die sozialen Folgen dieses Prozesses waren zahlreich und gravierend. Mitte der 1970er Jahre bildeten Industriearbeiterinnen und 10Industriearbeiter in den meisten Ländern Westeuropas die mit Abstand größte Berufs- beziehungsweise Statusgruppe, während heute die meisten Menschen in den verschiedensten Dienstleistungsberufen arbeiten. Dies hat die westeuropäischen Gesellschaften tiefgreifend verändert, und die Turbulenzen dieser Umbrüche, die sich in den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts vollzogen haben, hallen bis heute nach. In allen drei Ländern, die ich in diesem Buch einer vergleichenden Untersuchung unterziehe – Großbritannien, Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland –, begann der bis Anfang der 1970er Jahre rundlaufende Motor industriebasierter Vollbeschäftigung zu stottern und es kam zu einer Rückkehr von Massen-, insbesondere von Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit. Darüber hinaus wurde Fachwissen entwertet oder ganz neu definiert, mussten Berufskarrieren neu erfunden und Lebenspläne revidiert werden. Flexibilität wurde zum Zauberwort der Epoche.
Der »Abschied vom Malocher« war zugleich ein Abschied von jenen industriellen Zukünften, die noch um 1970 die kollektiven Fantasien in den westeuropäischen Gesellschaften beflügelt hatten. Diese entwarfen sich nun neu als »postindustrielle« oder »Dienstleistungsgesellschaften«, und zwar unter kräftiger Mitwirkung von Sozialwissenschaftlern, Politikberatern und Journalisten. Prompt setzte eine Selbsthistorisierung der Industriegesellschaft als eine abgeschlossene Phase der westeuropäischen Moderne ein: Die Einrichtung oder der Ausbau von Museen und Denkmälern der ersten Industrialisierung, ja mitunter die Musealisierung ganzer Regionen begleiteten den Strukturwandel.
11Eine Geschichte »von unten«
Wenn man den Spuren eines solchen langfristigen und umfassenden wirtschaftlichen Basisprozesses folgt, besteht die Gefahr, in ein Erzählmuster zu geraten, das sich der Rhetorik vom quasi naturhaften Sachzwang bedient, die Politiker und Zeitdiagnostiker – damals wie heute – bevorzugt verwenden, um ihre aktuellen pragmatischen Ziele mit geschichtsphilosophischem Blattgold zu ummanteln. Um dieser Gefahr zu entgehen, wähle ich in diesem Buch eine andere Erzählperspektive, die die Lebenslagen und Erfahrungswelten von Industriearbeiterinnen und -arbeitern in den Mittelpunkt stellt. Die Protagonisten meiner Gesellschaftsgeschichte industrieller Arbeit sind die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Meister und die Vorarbeiter, die sich in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr an den Rand gedrängt sahen und gewissermaßen aus dem Blickfeld gerieten, wenn über Zukunftschancen und Zukunftsrisiken diskutiert wurde. Der Vorteil einer solchen Perspektive für eine kritische Geschichtsschreibung liegt auf der Hand: Die »Kosten des Fortschritts«, also Prozesse sozialen Abstiegs, wachsende soziale Ungleichheit und Marginalisierung, kommen auf diese Weise leichter in den Blick, als wenn man die Perspektive derjenigen einnimmt, die als »Gewinner« aus dieser Umbruchphase hervorgegangen sind, beispielweise die Unternehmer und Beschäftigten in der IT-Branche und im Finanzsektor, in den Bereichen Marketing und Beratung sowie in Forschung und Entwicklung. Eine Sozialgeschichte aus der Perspektive dieser Gruppen würde zweifellos stärker, als dies hier geschieht, die durchaus eindrucksvollen Chancen und Potentiale einer neuen »postindustriellen« Ordnung Westeuropas herausstellen, böte aber wenig Einsichten in die Dynamik wachsender gesellschaftlicher Ungleichheit, die mit den Umbrüchen verbunden waren und die seit der Jahrtausendwende immer deutlicher sichtbar geworden sind.
War das Thema der sozialen Ungleichheit Mitte der 1990er Jahre 12noch weitgehend aus den gesellschaftspolitischen Debatten in Westeuropa verschwunden, so kehrte es knapp 20 Jahre später und nicht zuletzt aufgrund der vielbeachteten Studien von Thomas Piketty mit Macht zurück[1] – und mit ihm die allgemeine Aufmerksamkeit für die negativen sozialen Begleiterscheinungen der postindustriellen Ordnung. Plötzlich wurde sichtbar, wie gering die Teilhabechancen der vielen Vermögenslosen und Einkommensschwachen waren (und sind) und wie schlecht es um die soziale Anerkennung in ihren Berufen und Jobs, in der medialen Öffentlichkeit und im alltäglichen gesellschaftlichen Umgang stand (und steht). Nachzuzeichnen, wie sich dieser Aufwuchs an ökonomischer, politischer und sozialer Ungleichheit aus Sicht der »kleinen Leute« und ihrer Lebenswirklichkeit darstellte, ohne dabei die Gegenkräfte und institutionellen Schranken zu vernachlässigen, die mobilisiert und errichtet wurden, um den sozialen Folgen dieser Tendenz entgegenzuwirken, ist ein Ziel dieses Buches. Ein weiteres besteht darin, zum Verständnis der aktuellen Krise der liberalen Demokratie beizutragen. Heute sehen wir klarer, dass die Vorgeschichte dieser Krise in die Jahrzehnte jenes Umbruchs der westlichen Industriegesellschaften zurückführt, der mein Thema ist. Mit dem Strukturwandel veränderten sich auch die konkreten gesellschaftlichen Bedingungen der westlichen Demokratien,[2] und ich werde – wiederum aus der Perspektive »von unten« – untersuchen, ob sich diese Rahmenbedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter in einer Weise gewandelt haben, dass elementare Formen sozialer »Beziehungsgleichheit«[3] erodierten.
13Eine Geschichte »von gestern aus«
Als die 1948 beginnenden »fetten Jahre« des Booms ein Vierteljahrhundert später in ganz Westeuropa endgültig vorbei waren, ereilte Teile der Industriearbeiterschaft dasselbe Schicksal wie einige Jahrzehnte zuvor die Handwerker und Bauern: Sie wurden noch zu ihren Lebzeiten Bestandteil einer zukünftigen Vergangenheit, ohne Perspektiven in der Gegenwart, geschweige denn in der Zukunft. Nur selten nehmen wir Historiker die Sichtweise solcher Akteure, die gewissermaßen von den Ereignissen überrollt wurden, ernst, wenn wir strukturelle Veränderungsprozesse verstehen wollen. Ich werde in diesem Buch die zuvor beschriebene Perspektive »von unten« mit einer weniger vertrauten Perspektive »von gestern aus« verknüpfen und in diesem Sinne versuchen, gegen eine Berufskrankheit anzuschreiben, welche insbesondere die gegenwartsnahe Sozialgeschichte immer wieder befällt: dem soziologischen Blick auf zukunftsweisende Trends zu folgen und auf diese Weise vor allem die Anfänge des Neuen in den sozialen Phänomenen der jüngsten Vergangenheit zu entdecken. Dahinter steht letztlich eine Obsession für Fortschritts- beziehungsweise Wachstumserzählungen, während Prozesse des Schrumpfens, gar Verschwindens sozialer Gruppen oder Gebilde tendenziell mit Schweigen oder Desinteresse belegt werden.[4] Demgegenüber werde ich in den nachfolgenden Kapiteln die Veränderungen in den Arbeits- und Lebensbedingungen einer schrumpfenden industriellen Arbeiterschaft untersuchen, um einen vernachlässigten Ausschnitt auch gegenwärtiger Arbeits- und Lebens14welten sichtbar zu machen. Dabei werden je nach Land und/oder Region verschiedene Kontinuitätslinien und Beharrungskräfte zum Vorschein kommen, die zusammengenommen ganz erheblich dazu beigetragen haben, den drei Gesellschaften Westeuropas, auf die ich mich hier konzentriere, ihr spezifisches Profil zu verleihen, das im Übrigen in einigen Hinsichten so gar nicht den Erwartungen an eine postindustrielle Ordnung entsprach.
Die Umbrüche in den westeuropäischen Gesellschaften – so meine Arbeitshypothese – lassen sich also nur verstehen, wenn man das ab Mitte der 1970er Jahre wachsende Spannungsverhältnis zwischen den Erfahrungsräumen der Industriegesellschaft und den Erwartungshorizonten der heraufziehenden »Dienstleistungsgesellschaft« ernst nimmt. Anhand der zahlreichen Proteste, Streiks und Konflikte, die mit der Deindustrialisierung einhergingen, lässt sich beispielsweise erkennen, dass diese eben auch eine Politisierungsgeschichte hat, die bis heute nachwirkt. Und ein Blick in konkrete Berufsbiographien wird zeigen, wie kontrastreich und vielschichtig die Lebenswirklichkeit derjenigen war, die von dem Strukturwandel direkt betroffen waren: Ultrastabile und prekäre Lebenswelten, alte und neue Ordnungsmuster sowie generations- und gruppenspezifische Erwartungshorizonte existierten nebeneinander; es gab kontinuierliche Aufstiege und lange Betriebszugehörigkeiten, Arbeitslosigkeit und Existenzgefährdung, Arbeitsmigration und lokale Verankerung. Entsprechend divers waren auch die Deutungsmuster, die Politik und Gesellschaft aller drei hier untersuchten Länder prägten.
15Bezugspunkte einer Gesellschaftsgeschichte der Deindustrialisierung
Vor mehr als zehn Jahren haben mein Kollege Anselm Doering-Manteuffel und ich im Rahmen eines damals beginnenden größeren zeitgeschichtlichen Forschungszusammenhangs erste Leitideen und Forschungsperspektiven für eine Geschichte Westeuropas der drei Jahrzehnte zwischen 1970 und 2000 formuliert.[5] In dieser Zeit – so unsere damalige These – kam es in Westeuropa zu Strukturbrüchen und gleichzeitig fand ein sozialer Wandel von revolutionärer Qualität statt. Mit »Strukturbrüchen« sind die eklatanten, bereits für die Zeitgenossen gut sichtbaren Diskontinuitäten gemeint, wozu das Ende alter Industriebranchen und die Krise alter Industrieregionen ebenso zählen wie der Aufstieg der Computertechnologien und des Finanzmarktkapitalismus. Dagegen zielt »sozialer Wandel von revolutionärer Qualität« auf die Umschlagpunkte, die sich aus der Kumulation von Veränderungen ergaben, welche sich über größere Zeiträume und hinter dem Rücken der Zeitgenossen kontinuierlich herausgebildet haben. Das gilt zum Beispiel für die wachsende Berufstätigkeit von Frauen, die Zunahme des Konsums sowie die Öffnung und Expansion der Bildungssysteme. Strukturbrüche und die Umschlagpunkte des sozialen Wandels haben zusammengenommen die Konturen der westeuropäischen Gesellschaften tiefgreifend verändert und ihre Spuren in ganz verschiedenen Sphären und Handlungsfeldern hinterlassen. Aus diesem Grund ist eine umfassende Geschichte dieser Jahrzehnte nach dem Boom nur als Synthese sowohl methodisch als auch thematisch unterschiedlicher Zugangsweisen denkbar – und entsprechend breit sind die bislang vorliegenden Studien gestreut, die 16in unserem Forschungsverbund entstanden sind und von denen ich in diesem Buch zehre.[6]
Mit den beiden Kategorien »Strukturbrüche« und »sozialer Wandel revolutionärer Qualität« geht außerdem die Mahnung einher, die Offenheit für unterschiedliche Entwicklungswege in dieser Übergangsphase zu beachten. Dies ist auch der tiefere Grund, warum ich in diesem Buch eine vergleichende Perspektive wähle und die Transformation der industriellen Arbeitswelten in Großbritannien, Frankreich und der alten Bundesrepublik in den Blick nehme. Auf diese Weise lassen sich nämlich die Handlungsspielräume der Akteure und die regional beziehungsweise national eigensinnigen Koppelungseffekte zwischen Ökonomie, Politik, Kultur und Gesellschaft besser erkennen und beschreiben, als wenn man sich auf einen Wirtschaftsraum beschränkt. Und so wird sich auf den folgenden Seiten auch immer wieder zeigen, dass der Basisprozess der Deindustrialisierung selbst in Zeiten von Internationalisierung und Globalisierung keineswegs zu einer Abschleifung der spezifischen Profile der drei westeuropäischen Länder und ihrer Regionen führte, sondern ganz im Gegenteil: Nationale, regionale und lokale Differenzen in Westeuropa haben im Untersuchungszeitraum eher zugenommen. Zudem erscheint mir eine vergleichende Perspektive auch deshalb aussichtsreich, weil seit den 1980er Jahren unter den politischen und wirtschaftlichen Eliten Westeuropas eine weitgehende Übereinstimmung über Mittel und Ziele der Wirtschafts- und 17Sozialpolitik herrschte. Dieser Konsens hat dafür gesorgt, dass auf der Ebene der Ideengeschichte von einer (neo)liberalen Ära gesprochen wird und dass den entsprechenden programmatischen Verlautbarungen zuweilen eine geradezu bergeversetzende Wirkungsmacht zugeschrieben worden ist. Richtig ist, dass der neue Geist des (westlichen) Kapitalismus nicht zuletzt in den 1990er Jahren den europäischen Einigungsprozess maßgeblich geprägt hat und dass es zahlreiche Gemeinsamkeiten seitens der regierungspolitischen Agenda in den drei Ländern zwischen 1983 und 2008 gab, von der Privatisierung über die Öffnung für die internationalen Finanzmärkte und die Erweiterung und Harmonisierung der Bildungssysteme bis hin zu kostensenkenden Umbauten der öffentlichen sozialen Sicherungssysteme.[7] Dennoch ist größte methodische Aufmerksamkeit angebracht, denn einerseits hat eine Reihe von zumeist historisch gewachsenen nationalen Besonderheiten dafür gesorgt, dass sich der »neue Geist« nicht auf homogene Weise in den drei Ländern »materialisiert« hat, andererseits bringt es der Bedeutungsverlust nationaler Grenzen für die Wirkmacht ökonomischer Trends, rechtlicher Normen und kultureller Praktiken mit sich, dass der alleinige Blick auf die nationale Ebene nicht ausreicht, ja partiell ganz unergiebig ist, weil die interessante »Musik«, was sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede angeht, auf der regionalen oder lokalen Ebene »spielt«.
Warum nun aber habe ich ausgerechnet die drei genannten Länder, also Großbritannien, Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland für meine Studie gewählt – und nicht zum Beispiel Spanien, Italien oder die Niederlande? Neben rein idiosynkratischen Gründen, die mit meinen Vorkenntnissen und Sprachkompetenzen zu tun haben, gibt es eine Reihe von sachlichen Gründen für diese Wahl. Es handelt sich um die drei größten Volkswirtschaften Westeuropas, die auf sehr auf unterschiedlichen Wegen zu In18dustriegesellschaften geworden waren; sie waren im Untersuchungszeitraum Mitgliedsländer der Europäischen Union und integrierten ihre Volkswirtschaften in den europäischen Binnenmarkt; außerdem bieten sie ein breites Spektrum einerseits nationalspezifischer Eigenheiten, andererseits typischer Optionen in der politischen und sozialen Ausgestaltung der Umbruchphase, so dass ich auf eine Fülle empirischen Materials zurückgreifen konnte, um das Wechselspiel zwischen nationalen Pfadabhängigkeiten und Prozessen der Europäisierung und der Internationalisierung zu analysieren. Eine wichtige Einschränkung muss allerdings genannt werden: Mein westeuropäischer Vergleich stößt im Fall der Bundesrepublik für die Zeit nach 1990 auf erhebliche Schwierigkeiten, denn erst dann brach – allerdings in geradezu revolutionärer Radikalität und Geschwindigkeit – in den Regionen, die auf dem Staatsgebiet der ehemaligen DDR lagen, die industriebasierte Gesellschaft sozialistischer Prägung zusammen. Diesem dramatischen Strukturbruch lagen ganz andere Voraussetzungen zugrunde als den in diesem Buch untersuchten Transformationen Westeuropas seit den 1970er Jahren, die sich über einen Zeitraum von mindestens drei Jahrzehnten hinweg erstreckten. Daher ist es in einigen Vergleichsfällen nötig gewesen, Datenreihen zu nutzen oder zu generieren, die sich bis zum Ende des Untersuchungszeitraums um das Jahr 2000 auf das Gebiet der alten Bundesrepublik beziehen. Festzuhalten ist, dass die Besonderheiten der Umbrüche in den damals neuen Bundesländern in diesem Buch nicht behandelt werden können, auch wenn vieles darauf hindeutet, dass ein zeitversetzter Vergleich mit den britischen Entwicklungen vor allem der 1980er Jahre viele neue Einsichten in den Transformationsprozess der ehemaligen DDR bieten könnte.[8]
19Gesellschaftsgeschichte: Tragweite eines Konzepts
Dieses Buch ist auch ein Versuch, den Begriff der Gesellschaftsgeschichte zu erneuern beziehungsweise zu aktualisieren, der in Auseinandersetzung mit der Geschichte der modernen Industriegesellschaften Europas entwickelt worden ist. In dem ursprünglichen Vorschlag des britischen Historikers Eric Hobsbawm von 1971 war »Geschichte der Gesellschaft« ein Konzept, um die historische Untersuchung von Bevölkerungsentwicklung, von Sozialstrukturen, von Klassen oder sozialen Gruppen, aber auch von Mentalitäten mit der Geschichte übergreifender sozialer Systeme oder Räume zu verknüpfen, was gegenüber der klassischen sozialhistorischen Forschung eine Erweiterung der Erklärungsansprüche bedeutete, aber auch eine Erweiterung ihres Gegenstandsbereichs und ihrer Methodik verlangte. Hobsbawm akzeptierte ganz unterschiedliche Zugänge und Ausgangspunkte für eine solche Gesellschaftsgeschichte, hielt aber an der Einbettung der konkreten historischen Analyse eines distinkten Phänomens in einen größeren Bezugsrahmen sozialer Strukturbildung fest, für den die Kategorie »Gesellschaft« stand. Theoretische Orientierung lieferten entweder an Marx anknüpfende Typologien von Gesellschaftsformationen, also epochenspezifische transnationale oder globale Strukturmerkmale, oder aber enger gefasste Typologien – wie zum Beispiel das Konzept der moralischen Ökonomie für die Epoche der Frühen Neuzeit. Das Konzept war ebenso offen wie sein Autor skeptisch angesichts der erheblichen Schwierigkeiten bei der konkreten empirischen Umsetzung.[9]
Die westdeutsche Gesellschaftsgeschichte, wie sie federführend von Hans-Ulrich Wehler vorangetrieben wurde, konkretisierte diesen Ansatz und führte ihn zugleich in eine entschieden national20geschichtliche Richtung: »Moderne Gesellschaftsgeschichte versteht ihren Gegenstand als Gesamtgesellschaft, im Sinne von ›society‹ und ›société‹, sie versucht mithin, möglichst viel von den Basisprozessen zu erfassen, welche die historische Entwicklung eines gewöhnlich innerhalb staatlich-politischer Grenzen liegenden Großsystems bestimmt haben und vielleicht immer noch bestimmen.«[10] Damit war sie allerdings dazu verdammt, eine Syntheseleistung zu erbringen, die nur auf der Makroebene machbar schien. So ambitioniert die Idee einer Gesamt- oder Totalgeschichte der politisch als Nation verfassten europäischen Gesellschaften war, so schwer ist sie methodisch gegen die präzisen Angriffe einer strukturanalytischen Mikrogeschichte oder einer anthropologisch informierten Kulturgeschichte zu verteidigen. Entsprechend dominiert gut 10 Jahre nach Erscheinen des letzten Bandes von Wehlers Deutscher Gesellschaftsgeschichte die Skepsis gegenüber derartigen Versuchen zur historiographischen Gesamterfassung und Erklärung nationaler Gesellschaftskörper. Und auch für mein Vorhaben ist eine solche Perspektive nicht geeignet, denn im Zuge des europäischen Einigungsprozesses verloren die nationalstaatlichen Grenzziehungen mit Blick auf die Zirkulation von Waren, Kapital, Menschen und Ideen zunehmend an Bedeutung. Welche Herausforderung dies für die Gesellschaftsgeschichtsschreibung darstellt, lässt sich mittels eines einfachen Beispiels veranschaulichen: In der Industrieproduktion Frankreichs und der BRD waren in den 1970er und 1980er Jahren zwischen 15 und 20 Prozent der Arbeiterinnen und Arbeiter »Ausländer« beziehungsweise Arbeitsmigranten, die in mindestens zwei sozialen, ökonomischen und kulturellen Bezugsräumen lebten. Ihre Sozialräume waren völlig andere als die ihrer einheimischen Kollegen, werden aber in einer nationalzentrierten Gesellschaftsgeschichte allein einem nationalen Gesellschaftscontainer zugeordnet. Gleichzeitig nahm der Anteil grenzüberschreitender Produktionsprozesse an der industriellen Produktion aller drei Länder stetig zu und mit ihm der An21teil der Beschäftigten, die grenzüberschreitend tätig waren. Auch diesem Faktum muss eine Gesellschaftsgeschichte der jüngsten Epoche Rechnung tragen können – indem sie »Gesellschaft« als Wirkungs- und Handlungszusammenhang, als Relationsbegriff im Kontext der konkreten Forschungsfragen jeweils neu bestimmt.[11]
Ein Schlüsselproblem bleibt die geläufige Gleichsetzung von Nationalstaat und Gesellschaft. Ich werde versuchen, den Fallstricken eines methodischen Nationalismus aus dem Weg zu gehen, ohne jedoch die Nationalisierungseffekte zu ignorieren, welche mehr als 200 Jahre nation building in den europäischen Gesellschaften hinterlassen haben; auch wenn Kapital und Arbeit keineswegs ihren Charakter an den Landesgrenzen änderten, so prägten doch national regulierte Bildungssysteme, nationale soziale Sicherungssysteme und vor allem die national verfassten Arenen politischer Kommunikation mit ihren spezifischen politischen Sprachen die Lebensverhältnisse und Kommunikationsmuster von Briten, Franzosen und Deutschen am Ende des 20. Jahrhunderts. An verschiedenen Stellen tritt also auch in meiner Studie der »Nationalcontainer« mehr oder weniger deutlich und mit Erklärungsanspruch hervor. Zugleich müssen die vielfältigen grenzüberschreitenden Transfers und wechselseitigen Beobachtungen Berücksichtigung finden. Deutsche, französische und britische Unternehmen und Kapitalanleger investierten in den jeweiligen Nachbarländern und versuchten bewährte Verfahren und Lösungen dort zu implementieren; Politiker aller drei Länder hofften, aus den Fehlern und Erfolgen der Nachbarn zu lernen. Schließlich befanden sich alle drei Länder mitten im Prozess der Harmonisierung ihrer rechtlichen Regulierungen sowie der Öffnung ihrer nationalen Märkte in allen Bereichen der Wirtschaft.
An dieser Stelle könnte man meinen, dass die Lösung für das erwähnte Schlüsselproblem der Gesellschaftsgeschichte darin besteht, 22Europa als Bezugsgröße zu wählen, um der nationalstaatlichen Falle zu entgehen. Die vorliegenden Sozialgeschichten Europas zeigen allerdings, dass die Problematik damit lediglich auf eine höhere Ebene verschoben wird und sich in einer Hinsicht sogar noch verschärft, denn sie sind noch viel stärker als ihre nationalstaatlichen Pendants dazu verdammt, auf der Makroebene großer Trends und hochaggregierter Sozialstatistiken zu bleiben. Wiederum unterbelichtet bleibt auf diese Weise die regionale Dimension, und es ist in einem solchen Rahmen äußerst mühsam und nur mit Abstrichen möglich, der politischen und kulturellen Dimension, ohne die eine Gesellschaftsgeschichte nicht auskommt, gerecht zu werden.[12] Jedoch wäre es angesichts des Fortgangs der europäischen Integration hin zum europäischen Binnenmarkt und zur Währungsunion verfehlt, die europäische Dimension als bloß wirtschaftliche Realität, administrativen Überbau oder politische Idee auszuklammern, denn natürlich hat sie tiefe Spuren in den sozialen Realitäten der Mitgliedsländer hinterlassen. Diesem Tatbestand trage ich dadurch Rechnung, dass ich die westeuropäischen Industrieregionen zum größeren Bezugsrahmen meiner vergleichenden Untersuchung mache. Weitere Studien müssen erweisen, ob das passt, ob also die hier gewonnenen Erkenntnisse auch auf Länder wie Luxemburg, Belgien oder Schweden übertragen werden können oder vielmehr revidiert werden müssen.
Dieses Buch arbeitet also mit einem offenen Konzept von »Gesellschaft« und nutzt fünf ganz unterschiedliche wissenschaftliche Beobachtungsformate, ohne diese als solche gegeneinander zu gewichten. Das erste Beobachtungsformat ist die politische Ökonomie. Sie erlaubt es, in interdisziplinärer Perspektive transnationale Wirtschaftsprozesse zu den Versuchen ihrer politischen Steuerung in Beziehung zu setzen. Dies scheint mir ein vielversprechender Ansatz zu sein, um den Basisprozess der Deindustrialisierung präziser 23in seinen konkreten Ausgestaltungen erfassen zu können. Er wird in Kapitel 1 zur Geltung kommen. Ein zweites Beobachtungsformat, das ich vor allem in Kapitel 4 zur Anwendung bringen werde, nimmt die rechtlichen Regulierungen in den Blick und interessiert sich für das Gewicht und die Spezifik arbeits-, sozial- und tarifrechtlicher Ordnungsmuster für die gesellschaftlichen Dynamiken in der Umbruchszeit. Das dritte Format, das gleich zwei Kapitel bestimmen wird, ist das der Wissensgeschichte. Dabei geht es zum einen um die Veränderungen in den Deutungsmustern oder Repräsentationen der sozialen Welt, die den zeitgenössischen Akteuren Orientierung gaben, und zwar sowohl bei ihren arbeitsweltlichen Entscheidungen und den entsprechenden Konflikten als auch in Bezug auf die alltäglichen Handlungsroutinen (Kapitel 2); zum anderen generiert dieses Format die Frage nach den Umbrüchen in den Wissensordnungen, die in direkter Verbindung mit den Transformationsprozessen in den industriellen Arbeitswelten der Zeit standen, lenkt den Blick auf die veränderliche Wertigkeit von Bildungstiteln und Berufsqualifikationen sowie auf die Entstehung neuer Wissensbestände und neuer Verteilungen von Wissen und Kompetenzen in einer Zeit, die durch den Aufstieg der neuen digitalen Leittechnologie geprägt wurde (Kapitel 5).
Das vierte Beobachtungsformat ist das von Ereignissen. Gesellschaftsgeschichte hat es nicht nur mit Trends und anonymem sozialen Wandel zu tun, sondern ist gut beraten, Ereignissen Relevanz und Aussagekraft zuzugestehen. Dies gilt sowohl im Großen wie auch im Kleinen. Als medial inszenierte Formate kollektiven Geschehens stellen Ereignisse bis heute die Sphäre des Politischen par excellence dar. Zwar sind ihre genauen Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft alles andere als klar, aber dass solche Ereignisse wirkmächtig sind, scheint mir auf der Hand zu liegen. Neben diesen »lauten« Ereignissen gibt es medienferne Mikroereignisse, die individuelle und kollektive Biographien takten: Berufswahl, Pensionierung oder Auszug sind wichtig als Wegmarken, sie prägen Erfahrungen und Lebensverläufe. Ich werde eine ereigniszentrierte Per24spektive in Kapitel 3 in Anschlag bringen, um die Geschichte politischer Protestbewegungen zu untersuchen, sowie in Kapitel 6, wo ich mich mit Arbeitsbiographien und Lebensläufen beschäftigen werde. Das fünfte Beobachtungsformat, das in dieser Gesellschaftsgeschichte der Deindustrialisierung zur Anwendung kommt, ist die sozialräumliche Dimension. Dabei interessiere ich mich (vor allem in Kapitel 7 und 8) besonders für die raumgebundenen Beharrungskräfte und Dramatisierungseffekte, welche dazu geführt haben, dass heute alle drei hier untersuchten Länder größere Unterschiede und markantere Ungleichheitsverteilungen in ihren Sozialräumen kennen als noch vor 50 Jahren.
Methodische Komplikationen: Nah- und Fernsichten, Theorieeffekte und Quellenauswahl
»Gesellschaftsgeschichte« ist also eine Perspektive beziehungsweise ein Bezugsrahmen, der die Aufmerksamkeit des Historikers steuert, ohne dass der Begriff der Gesellschaft selbst noch die zu untersuchenden Gegenstände und Räume bestimmen würde. Eine weitere methodische Einsicht hat den alten Erkenntnisoptimismus der Sozialgeschichte zerstört: Befunde der Makro- und der Mikroebene lassen sich nicht einfach ineinander überführen, die dort gewonnenen verallgemeinerungsfähigen Erkenntnisse sind nicht immer deckungsgleich. Das »Niveau-Gesetz«, wie dies Siegfried Kracauer genannt hat, der sich als einer der ersten Geschichtstheoretiker systematisch mit diesem Faktum auseinandersetzte, erzeugt insofern gravierende Probleme bei der Darstellung, als aus jeder Untersuchungsebene Vergangenheitskonstruktionen entstehen, die am Ende nicht (immer) zueinander passen.[13] Aus dieser Not versuche ich in diesem Buch 25eine Tugend zu machen, indem ich das »Niveau-Gesetz« um des Sichtbarmachens von Komplexitäten und Handlungsoptionen willen souverän ignoriere und immer wieder zwischen Mikro- und Makroebenen hin und her wechsle, also etwa gleichermaßen den Wandel individueller Arbeitsbiographien und die Verschiebungen, die der Aufstieg internationaler Finanzmärkte für britische, französische und westdeutsche Industrieunternehmen hatte, untersuche. Diesen Wechsel von Nah- und Fernsichten verbinde ich mit einem ständigen Wechsel bei den Vergleichskategorien, schaue also mal auf Länder, mal auf Regionen, mal auf Betriebe, mal auf Haushalte oder Individuen.
Naturgemäß kommt der Historiker später als beispielsweise der Sozialwissenschaftler in Kontakt mit den zum Teil irritierenden Spuren komplexer Sozialwelten, was ihm in einer Hinsicht zum Vorteil gereicht. Der längere Vorlauf der großen wie der kleinen Ereignisketten ermöglicht ihm nämlich bereits einen Überblick, zu dem der gegenwartsorientierte Sozialwissenschaftler in der Regel nur durch den Einsatz starker theoriegestützter Konstruktionen und Abstraktionen sowie präziser Methoden gelangen kann. Mittels solcher sozialwissenschaftlicher Erklärungsmodelle, Theorien und Diagnosen haben die historischen Akteure in unserem Untersuchungszeitraum bereits selbst den Lauf der Dinge und ihrer Geschäfte, Karrieren oder Nationen zu bewerten, zu korrigieren und zu steuern versucht. Als Gesellschaftshistoriker der jüngsten Vergangenheit stolpert man ständig über solche »Theorieeffekte«, das heißt über praxiswirksame Handlungsmaximen oder Legitimationsfiguren aus sozialwissenschaftlicher Wissensproduktion, die einen zu theoretischer Wachsamkeit zwingen. Strenggenommen kommt eine Gesellschaftsgeschichte nicht ohne eine detaillierte wissensgeschichtliche Historisierung zumindest all jener sozialwissenschaftlichen »Sozialdaten« und Denkfiguren aus, denen Handlungsrelevanz und Breitenwirkung zuzuschreiben sind, die also über die soziale Welt in Umlauf waren und den esoterischen Kreis professioneller Sozialdeuter und Sozialforscher verlassen hatten. Daher werde ich mich in diesem 26Buch immer wieder mit solchem »Meinungswissen« beschäftigen müssen, wenn es um die Analyse der sozialen »Realitäten« von Betrieben, Arbeitsverhältnissen, Berufsordnungen oder Wohnquartieren geht. Immer wieder werde ich dabei symbolische und soziale Strukturen aufeinander beziehen, aber diese beiden Ebenen in den beiden Eingangskapiteln aus Darstellungsgründen analytisch voneinander getrennt halten, um die ökonomischen Prozesse und die gesellschaftlichen Imaginationen in den drei westeuropäischen Gesellschaften zunächst einmal in ihren Grundzügen darzustellen.
Theoretische Wachsamkeit heißt in diesem Zusammenhang aber auch, die zeitgenössischen sozialwissenschaftlichen Forschungsergebnisse und deren Erklärungsmodelle und Theorien als mögliche Hilfsmittel für die eigene Analyse ernst zu nehmen, sie bei aller Konstruiertheit nicht einfach als historische Artefakte ohne jeden heutigen Gebrauchswert zur Seite zu legen, nachdem ihre Entstehungszusammenhänge historisch-kritisch rekonstruiert wurden. Eine quasi naive Erzählung würde schlicht zurückfallen hinter den Erkenntnisstand der Sozialwissenschaften und stünde immer in der Gefahr, dem unhinterfragten Meinungswissen der eigenen Zeit als den am nächsten liegenden, sozusagen naturwüchsigen Erklärungsangeboten zum Opfer zu fallen. Der eigenen Konstruktionsarbeit entkommt auch der Gesellschaftshistoriker nicht. Wachsamkeit heißt in diesem Fall, sich stets Rechenschaft ablegen darüber, welche theoretisch fundierten Einsichten Inspirationsquelle oder Wegweiser für die eigene Konstruktionsarbeit geworden sind. Der Gesellschaftshistoriker bewegt sich in diesem Fall in ständigem Zwiegespräch mit seinen sozialwissenschaftlichen Kollegen, ihren Forschungsideen und Erklärungsmodellen. Als »Forschungsideen« betrachte ich anknüpfend an Kracauers Konzept der »historischen Idee« diejenigen Hypothesen beziehungsweise Thesen, welche neue Forschungsperspektiven eröffnen, auf neue Untersuchungsgegenstände aufmerksam machen und uns mögliche, bislang übersehene Zusammenhänge erschließen. »Sie führen ein neues Erklärungsprinzip ein; sie enthüllen – wie auf einen Schlag – bislang unvermutete Zusam27menhänge und Beziehungen von relativ großem Ausmaß.«[14] Konkret sind für dieses Buch vor allem sechs solcher Forschungsideen wichtig geworden.
Die erste Idee stammt von den amerikanischen Industriesoziologen Michael Piore und Charles Sabel, die bereits Anfang der 1980er Jahre prognostizierten, dass es im Zuge der dritten industriellen Revolution zu massiven Strukturveränderungen in den Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit kommen werde.[15] Sie sahen eine Wende zur flexiblen Qualitätsproduktion voraus, die mit neuen Optionen bei der Verteilung von Arbeit und Wissen in der Produktion, mit der Verlagerung der industriellen Produktion in kleinere Produktionseinheiten und schließlich mit der Aufwertung regionaler Lösungen für neue wettbewerbsfähige Industrieproduktion einhergehen werde. Diese Hypothese hat mir enorm dabei geholfen, trotz der so heterogenen Befunde und Forschungsthesen im Feld der Industriesoziologie und Unternehmensforschung die großen Linien nicht aus den Augen zu verlieren. Die zweite Idee stammt von den französischen Soziologen Stéphane Beaud und Michel Pialoux. Sie haben angesichts der dramatischen Umbrüche in Frankreich auf die gern übersehene Verbindung zwischen den sozialen Verwerfungen in den »demokratisierten« Bildungssystemen und den Transformationen in der industriellen Arbeitswelt hingewiesen und damit den Weg gewiesen, eines der wirkmächtigsten Ideologeme dieser Epoche kritisch zu hinterfragen: die Beseitigung aller Probleme von Ungleichheit und Diskriminierung durch die Ausweitung allgemeiner Bildungspatente.[16] Die dritte Forschungsidee lieferte der deutsche Industriesoziologie Hermann Kotthoff. Seine Annahme, dass Kooperation und Konflikt in der Arbeitswelt, konkret in Betrieben, neben institutionellen und ökonomischen Aspekten auch eine genuin 28sozial-kulturelle Dimension haben, war ein Schlüssel, um die entsprechenden Dynamiken in Zeiten großer Veränderungen und ständiger Unsicherheit besser zu verstehen.[17]
Diese Idee wiederum verweist auf zwei weitere grundlegende theoretische Annahmen, denen meine Studie verpflichtet ist. Mit den Konzepten »soziale Anerkennung« und »Beziehungsgleichheit« haben Axel Honneth und Pierre Rosanvallon grundlegende Überlegungen zur Reziprozität sozialer Beziehungen geliefert, denen ich in diesem Buch folge.[18] Die Norm personaler Anerkennung und Gleichbehandlung ist die vierte Forschungsidee und markiert eine grundlegende Dimension sozialer Beziehungen in den durch kollektive (Klassen-)Strukturen und sozioökonomische Ungleichheit geprägten Industriegesellschaften Westeuropas. Bei vielen Auseinandersetzungen in der Arbeitswelt ging und geht es auch, mitunter sogar hauptsächlich, um soziale Anerkennung, auch wenn das gern übersehen wird. Ich nutze diese Idee, um besser zu verstehen, wie sich die Beziehungsverhältnisse zwischen sozialen Gruppen im Zuge der hier untersuchten Umbrüche entwickelt haben. Schließlich möchte ich Pierre Bourdieus Hinweis auf die effets de lieu, Ortseffekte, als fünfte Forschungsidee nennen, die mir den Weg gewiesen hat. Die Aufmerksamkeit für die Veränderungen der Sozialräume, ihre symbolische Bewertung und die in ihnen realisierten Ungleichheitsstrukturen hat meinen Blick von den Arbeitsplätzen auf Wohnquartiere und Siedlungsformen gelenkt und aufschlussreiche Beobachtungen ermöglicht.[19]
Die sechste Idee stammt von dem französischen Ethnologen Oli29vier Schwartz. In seinen Untersuchungen zu Privatleben und kulturellen Praktiken von Arbeitern und Angestellten in Frankreich benutzt er den Begriff der classes populaires,[20] um zwei Dimensionen zusammenzubringen, die häufig getrennt voneinander und aus völlig unterschiedlichen Perspektiven sowie mit ganz anderen Kategorien analysiert werden: sozioökonomische Ungleichheit und kulturelle Distanz beziehungsweise Differenz. Was sie aus seiner Sicht verbindet, ist die Beziehung von Herrschenden und Beherrschten (dominants–dominés), welche sowohl den sozioökonomischen als auch den kulturellen Unterschieden erst soziale Relevanz und Sinn verleihen. Die Idee, eine ursprünglich soziologische mit einer kulturalistischen Perspektive auf Ungleichheit zu kombinieren, erscheint mir besonders gut geeignet, um den Veränderungen gerecht zu werden, welche im Untersuchungszeitraum in den drei Ländern zu beobachten waren. Der Begriff der classes populaires erlaubt uns, ökonomisch fundierte Klassen- und Schichtenbildung mit kulturellen Dynamiken und Neubewertungen kulturellen Kapitals zusammenzudenken sowie die Defizite der traditionellen Klassenanalyse zu erkennen, die nicht imstande ist, die doppelte Logik kultureller und sozioökonomischer Prägungen zu erfassen. Für mein Vorhaben einer vergleichenden Gesellschaftsgeschichte bietet dieser – im Übrigen nicht verlustfrei ins Deutsche zu bringende – Begriff gleich mehrere Vorteile: Zum Ersten lassen sich mit seiner Hilfe die ganz unterschiedlichen nationalen Traditionen von Klassenbildung (siehe Kapitel 2) als Variationen einer Grundkonstellation denken, zum Zweiten hilft er dabei, kulturellen und ökonomischen Faktoren gleichumfänglich Rechnung zu tragen, und zum Dritten ermöglicht er es, die soziale und kulturelle Annäherung zwischen früher getrennten Berufs- beziehungsweise Statusgruppen begrifflich zu fassen.
Neben diesen sechs Forschungsideen greife ich in diesem Buch 30auf eine Vielzahl theoretischer Einsichten unterschiedlichster Provenienz zurück, gehe also, nicht unüblich für einen Historiker, eklektisch oder – vornehmer formuliert – pluralistisch vor. Meine Vorliebe, Handlungen, Ereignisse und Prozesse auf die spezifische Logik sozialer Handlungsfelder zurückzuführen, wird den Leserinnen und Lesern dieses Buches alsbald auffallen. Tatsächlich schreibe ich der Einbettung individueller Akteure in solche sozialen Konfigurationen große Relevanz zu, gebe dem »Sozialen« und seiner Eigenlogik immer wieder mehr explanatorischen Kredit als abstrakten, zweckrationalen Handlungslogiken, wie sie der methodische Individualismus bevorzugt. Ob eine solche holistische Sichtweise besser geeignet ist, der Komplexität der hier untersuchten Umbrüche gerecht zu werden, mögen andere entscheiden.
Schließlich halte ich es in diesem Buch mit noch einer weiteren sozialtheoretischen Grundannahme, die sich längst nicht mehr von selbst versteht: Ich betrachte Arbeit nach wie vor als einen Knotenpunkt sozialer Strukturbildungen, und zwar sowohl im Untersuchungszeitraum als auch in der Gegenwart. Sozioökonomische Lagen, aber auch soziale Inklusion und Teilhabe waren und sind über Arbeit als Erwerbstätigkeit und als Beruf bestimmt, kulturelle und politische Gruppenbildungen und Positionen wurden von Arbeitserfahrungen geprägt beziehungsweise sind durch sie beeinflusst. Anders als viele sozialwissenschaftliche und geschichtswissenschaftliche Positionen, denen zufolge Arbeit schon im Untersuchungszeitraum, also in den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, ihre gesellschaftliche Prägekraft an Konsum und Freizeit verloren habe,[21] beharre ich auf der Zentralität von Arbeit für eine gesellschaftsgeschichtliche Perspektive. Ob man damit noch weit genug kommt, wird sich zeigen.
Zum Schluss noch einige Bemerkungen zu Quellen, Daten und 31Dokumenten. Gesellschaftsgeschichte, wie sie hier erprobt wird, kennt keine bevorzugte Art von »Quellen«, auch keinen Primat staatlicher Archive oder amtlicher Statistik. Sie kennt nur Spuren von Ereignissen, Prozessen oder Vorstellungen, die sie aufnimmt, und zwar ganz gleichgültig, wie sie überliefert worden sind und von wem sie aufbewahrt wurden. Vielfach nutzt sie die Beobachtungsergebnisse zeitgenössischer empirischer Sozialforschung für eine kritische Sekundäranalyse. In diesem Sinne habe ich in diesem Buch zum Beispiel soziologische Forschungsdokumente immer wieder auch als historische Quellen neu interpretiert und überhaupt Befunde aus ganz unterschiedlichen Quellen im vollen Bewusstsein der damit verbundenen Gefahren methodischer Art miteinander kombiniert. Meines Erachtens gereicht eine solche Erweiterung der Quellengrundlage der gesellschaftsgeschichtlichen Forschung zum Vorteil, die sich damit der geläufigen Forderung nach methodischer Monogamie als Ausweis sogenannter fachlicher Strenge faktisch entzieht. Ich bin mir aber natürlich auch darüber im Klaren, dass die quantitative Auswertung von Sozialdaten sowohl amtlicher als sozialforscherischer Herkunft eine andere Verfahrensweise ist als das historisch-kritische Lesen und Deuten von Lebenszeugnissen, politischen Dokumenten, wissenschaftlichen Publikationen und Gesetzestexten.
Faktisch ist das für die Themen meiner Studie zur Verfügung stehende Material so umfangreich, dass ein einzelner Forscher nicht imstande ist, es vollständig zu sichten und auszuwerten. Der kritischen Auswahl von Daten und Dokumenten kommt also erhebliche Bedeutung zu, und sie hätte es verdient, jeweils ausführlich vorgestellt und erläutert zu werden. Darauf habe ich aus Platzgründen weitgehend verzichtet, hoffe jedoch darauf, dass die Fachdebatten die gewiss vorhandenen Fehler und Fehldeutungen aufdecken und neue, bessere Dokumente in die Debatte einbringen werden. Die wichtigsten Datenserien und Archivmaterialien, die neben den amtlichen Statistiken und publizierten Dokumenten benutzt worden sind, sind zur leichteren Orientierung zu Beginn des Literaturver32zeichnisses aufgelistet. Ein Hinweis dazu ist allerdings schon an dieser Stelle nötig: Der Anspruch dieses Buches, einer Perspektive »von unten« zu folgen, wäre leichter umzusetzen gewesen, wenn für alle drei Länder durchweg vergleichbare Sozialdaten zu den Sozialräumen der classes populaires vorgelegen hätten. Dies war jedoch nicht der Fall. So konnte nur für die Bundesrepublik Deutschland dank des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) systematisch ein Set von Daten generiert werden, das den Sozialraum, den Industriearbeiter und -arbeiterinnen zusammen mit ihren Partnern, Eltern und Kindern zwischen 1984 und 2001 gebildet haben, relativ umfassend abbildet.[22] Solche Datensätze standen für Frankreich und Großbritannien entweder nicht für einen ähnlich langen Zeitraum oder nicht in vergleichbarer Informationsdichte zur Verfügung, weshalb immer wieder unterschiedlich generierte und strukturierte Datensätze darauf hin geprüft werden mussten, ob ein quantitativer Vergleich überhaupt sinnvolle Ergebnisse produziert.
33I. Die Vogelperspektive
Drei nationale Arbeitsordnungen im Umbruch