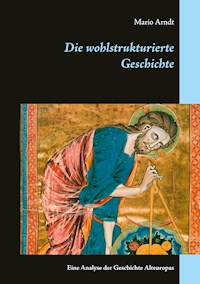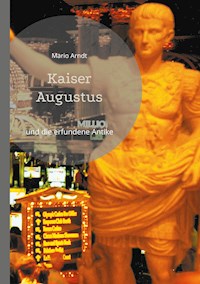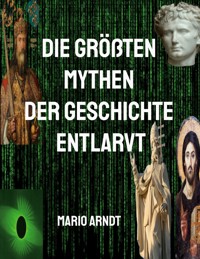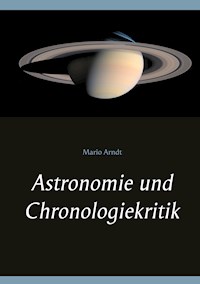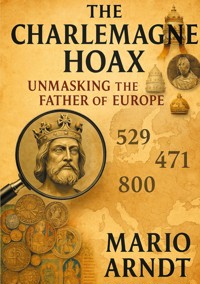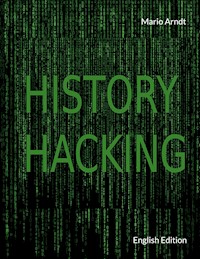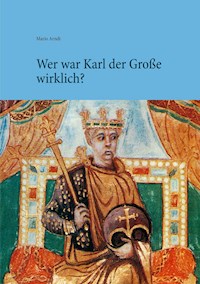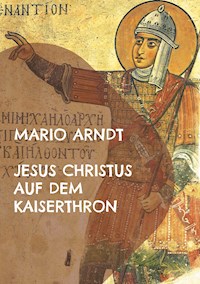
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jesus Christus aus dem Neuen Testament ist das Ergebnis der Fusion buddhistischer und jüdischer Traditionen unter dem Einfluss des Hellenismus. Unsere Zeitrechnung beginnt in Wirklichkeit mit dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und dem Bund Gottes mit Moses und den Menschen (derzeit auf 1313 v. Chr. datiert), und nicht mit der Geburt des gekreuzigten Jesus Christus. Der römische Kaiser Anastastios I. (Neudatierung im 11. Jahrhundert u. Z.) spielt die Rolle des auferstandenen Jesus Christus. Petrus, sein Nachfolger auf dem Kaiserthron mit dem Kaisernamen Justinian I., begründet die orthodoxe Kirche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Der Informatiker, Geschichtsanalytiker und Sachbuchautor Mario Arndt schreibt über Themen, die Sie nicht in traditionellen Geschichtsbüchern finden. Seine Analysen der offiziellen Geschichte decken auf, wie das Mittelalter, die Antike und die dazugehörigen Zeitrechnungen gefälscht und erfunden wurden. Der von Mario Arndt verfolgte geschichtsanalytische Ansatz des History Hacking beruht in erster Linie auf dem Computational Thinking.
Mario Arndt wurde 1963 in Rostock geboren und hat seit 2002 seinen Wohnsitz in Frankfurt am Main.
Website: www.HistoryHacking.de YouTube: History Hacking
Vom Autor sind außerdem erschienen:
Das wohlstrukturierte Mittelalter (2012), ISBN: 978-38423487762
Die wohlstrukturierte Geschichte (2015/2020), ISBN: 978-3738645583
Astronomie und Chronologiekritik (2015/2020), ISBN 978-3751997935
Wer war Karl der Große wirklich? (2015/2020), ISBN 978-3751966948
Die wohlkonstruierte Chronologie (2020), ISBN 978-3751980814
History Hacking (2021), ISBN 978-3754306437
Kaiser Augustus und die erfundene Antike (2021), ISBN 9783754339909
Inhalt
"Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat."Voltaire (1694-1778)
Jesus aus dem Alten Testament am Anfang unserer Zeitrechnung
Der verdoppelte Jesus
Der wichtigste Heerführer und Reichsgründer des Alten Testaments war Jesus. Er führte als Nachfolger von Moses das Volk Israel ins Heilige Land, schlug dort alle Völker "mit der Schärfe des Schwertes" , eroberte das Land und verteilte es an die Stämme.
Diese Geschichte stammt aus dem Alten Testament, dem Buch "Jesus", auf Latein erst ab der Bibel-Version Vulgata "Josua" genannt.
Diese Person heißt heute noch im Griechischen, Kirchenslawischen sowie Russischen "Jesus" bzw. "Jisus" (Ιησους bzw. Иисус).
Im Arabischen und im Koran wird er "Isa" genannt, von der griechischen Form abgeleitet. Im Arabischen gibt es kein "o".
Abb. 1: Jesus aus dem Alten Testament, erst nach der Bibel-Version Vulgata “Josua“ genannt, jetzt chronologisch 1313 Jahre vor dem neutestamentlichen Jesus – dazu später mehr (siehe auch [Arndt 2010]). Die Abbildung ist ein Fresko aus dem byzantinischen Kloster Hosios Loukas und zeigt Jesus als Krieger.
Es hat mehrere Versionen der lateinischen Bibel gegeben. Erst auf dem Konzil von Trient (1545-1563) wurde von der katholischen Kirche der lateinische Text der Bibelversion “Vulgata“ als verbindlicher Bibeltext bestimmt. Dieser Bibeltext soll nach offizieller Geschichte in der Zeit um 400 entstanden sein, also über 1100 Jahre zuvor.
Als Verfasser wird Hieronymus (347 - 420) genannt, der den griechischen Text des Alten Testaments ins Lateinische übersetzt und für das Neue Testament eine ältere Übersetzung überarbeitet haben soll. “Hieronymus“ (Ἱερώνυμος) ist griechisch und bedeutet “Heiliger Name“.
Abb. 2: Hieronymus (347-420, deutsch: “Heiliger Name“), der Übersetzer der erst seit dem 16. Jahrhundert vom Papst abgesegneten Bibelversion Vulgata – 1100 Jahre nach der Übersetzung
Nur im Lateinischen (ab Bibelversion Vulgata) und den darauf aufbauenden Bibelübersetzungen trägt der alttestamentliche Jesus den Namen "Jos[h]ua", um ihn von der neu geschaffenen neutestamentlichen Gestalt "Jesus" abzugrenzen. Auch im Koran werden beide Gestalten nicht klar voneinander getrennt. Genaugenommen sind sie identisch.
Abb. 3: Jesus Christus im Katharinenkloster im Sinai. Diese Ikone soll aus dem 6. Jahrhundert sein, wurde aber lange Zeit auf das 13. Jahrhundert datiert.
Der ursprüngliche Jesus Christus Pantokrator (All- bzw. Weltenherrscher), z. B. auf Abb. 3, hält das “Buch“, das er von Gott erhalten hat, in der Hand und tritt als Lehrer und Herrscher auf.
Im Unterschied dazu wird der neutestamentliche Jesus bevorzugt am Kreuze hängend dargestellt – siehe Abb. 4.
Diese erste Darstellung der Kreuzigung von Jesus Christus in einem Manuskript wird auf das Jahr 586 datiert, also nach den byzantinischen Kaisern Anastasios I. (491 - 518) und Justinian I. (527 – 565).
Abb. 4: Die erste Darstellung der Kreuzigung Jesu Christi in einem Manuskript, datiert auf 586 n. Chr.
Ist das Christentum erst viel später entstanden?
Da von der sehr späten Festlegung des Bibeltextes im 16. Jahrhundert die Rede war: Nach den Forschungen des englischen Historikers Edwin Johnson (1842 – 1901) sind alle frühchristlichen Schriften, inklusive der Bibel, erst in der Zeit um 1500 und später entstanden, und damit auch das Christentum in seiner heutigen Form [Johnson 1900 und 1904]. Dies passt zu der späten Festlegung der “Vulgata“ als verbindlichem Bibeltext im 16. Jahrhundert.
Darüber hinaus ist ein weiterer Punkt wichtig: Wie der Autor in [Arndt 2020/4, S. 20 ff.] gezeigt hat, hatte die Christianisierung überhaupt keinen Einfluss auf die Namensgebung in Deutschland. Erst ab dem 13. Jahrhundert, also gemäß offizieller Geschichte ca. acht Jahrhunderte danach, beginnen Namen von Heiligen und Personen aus der Bibel bei der Namenswahl eine nennenswerte Rolle zu spielen. Zuvor findet man insbesondere Namen aus dem Alten Testament lediglich in Überlieferungen über Geistliche [Seibicke 2008, S. 132].
Es ist allerdings für das 13. Jahrhundert kein Ereignis überliefert, dass diese Zunahme christlicher Vornamen gerade in dieser Zeit erklären könnte.
Ist daher das Christentum vielleicht gar nicht so alt, wie es heute in den Geschichtsbüchern steht? Sind die Überlieferungen aus der Kirchengeschichte davor vielleicht auch nur Fälschungen wie die jetzt schon bekannte Unmenge von nachgewiesenen Fälschungen der Kirche? (siehe hierzu [Arndt 2020/1, S. 20 ff.] und [Arndt 2021/1, S. 13 ff.])
Kammeier [Kammeier 2000] und Topper [Topper 1998] sehen das Papsttum erst im 14. Jahrhundert in Avignon entstehen, als sich dort nach offizieller Geschichte die römischen Päpste im sogenannten “Babylonischen Exil“ befanden.
Dies schließt allerdings nicht aus, dass man vor dieser Zeit unter “Christentum“ etwas ganz anderes verstanden haben könnte, was dann später von der Papstkirche vereinnahmt wurde wie so vieles andere. Z. B. ist es bei den wichtigsten christlichen Feiertagen vielen auch gar nicht bewusst, dass sie schon existierten, bevor die katholische Kirche entstand.
Abb. 5: Darstellung der Konstantinischen Schenkung auf einem Fresko von 1246, Silvesterkapelle bei der Basilika Santi Quattro Coronati in Rom.
Konstantin I. (römischer Kaiser von 306-337) schenkt dem Papst Silvester I. die westliche Hälfte des Römischen Reiches. Die Urkunde wurde im Jahre 1440 als Fälschung entlarvt.
Und die heute als katholische Päpste in der Papstliste stehenden Geistlichen waren dann zum Teil gar keine Päpste im heutigen Sinne, sondern einfach Priester oder Bischöfe von Rom.
Abgesehen davon ist ein Großteil der Papstliste eine Fälschung, wie der Autor in [Arndt 2012/2] und [Arndt 2020/4, S. 193 ff.] gezeigt hat.
Tab. 1: Die 8 Abschnitte der Wohlstrukturierten Papstliste von 685 – 1455 umfassen i.d.R. jeweils 14 oder 18 Päpste. Dazwischen liegen ein paar andere Päpste, meist mit Namen Anastasius (“Der Auferstandene“) oder Johannes (“der Täufer“).
Die christliche Zeitrechnung
Als Begründer der christlichen Zeitrechnung gilt der Mönch Dionysius Exiguus (ca. 470 – ca. 540), der ab etwa dem Jahre 500 in Rom lebte. Dieser berechnete zukünftige Daten des Osterfestes und fertigte eine Tabelle mit den Osterdaten an, die Ostertabellen seiner Vorgänger fortsetzte (zur Osterrechnung ab S. 99 mehr).
Darin bezeichnete er ab dem Jahr 248 der Ära der Märtyrer (Diokletianische Ära nach dem römischen Kaiser Diokletian) die Jahre als “Anni Domini Nostri Jesu Christi“ (Jahre unseres Herrn Jesus Christus). Das Jahr 248 der Diokletianischen Ära entspricht also nach ihm dem Jahr 532 Anno Domini, der christlichen Zeitrechnung.
Die Verbindung zu anderen Zeitrechnungen wird erst später hergestellt. In der Zeit um 600, als Bonifatius IV. Papst war, soll ermittelt worden sein, dass dem Jahre 754 nach der Gründung der Stadt Rom (ab urbe condita) das Jahr 1 nach Christus entspricht (anno domini).
Ab wann zählt man nun offiziell die Jahre seit Christi Geburt?
Die Autoren, die die neue Jahreszählung in den folgenden Jahrhunderten benutzen, sind dünn gesät.
Der angelsächsische Mönch Beda Venerabilis (672/673 – 735) verwendete die Anno-Domini-Jahreszählung in seinen Schriften.
Andere Autoren folgten dann um die erste Jahrtausendwende und später.
Abb. 6: Dionysius Exiguus (ca. 470 – ca. 540), der Begründer der christlichen Zeitrechnung
Karl der Große soll die christliche Zeitrechnung anderen Jahreszählungen vorgezogen haben und wurde dann auch pünktlich 800 Jahre nach der Geburt Jesu Christi vom Papst in Rom zum Kaiser gekrönt, am 25. Dezember 800 - so jedenfalls die offizielle Geschichte.
Die römisch-katholische Kirche datierte erstaunlicherweise Dokumente durchgehend erst ab dem späten 14. Jahrhundert nach der christlichen Zeitrechnung. Im christlichen Byzantinischen Reich zählte man bis zum Untergang im Jahre 1453 nie die Jahre nach Christi Geburt. Dort war die Zählung der Jahre ab Erschaffung der Welt (5508 vor Christus) die offizielle Zeitrechnung.
Auch im Moskauer Reich, dem nach eigener Auffassung Dritten Rom, wurde erst im Jahre 1700 auf die christliche Zeitrechnung umgestellt. Die anderen Länder mit orthodoxer Kirche folgten dann.
Abb. 7: Der Einzug von Papst Gregor XI. in Rom 1377 (Fresko von Giorgio Vasari, ca. 1571–1574). Von 1309 bis 1377 war Avignon in Frankreich Sitz des Papstes.
Auch erst seit dieser Zeit verliert die Papstliste ihren artifiziellen Charakter (siehe hierzu vom Autor den Internet-Artikel “Die wohlstrukturierte Papstliste“ sowie das Buch “Die wohlstrukturierte Geschichte“, ab S. 193)
Da ist es schon verwunderlich, dass uns eine ganze Menge Urkunden und andere Dokumente mit Angabe der Jahreszahl nach christlicher Zeitrechnung überliefert sind, die aus der Zeit Karls des Großen, seiner Nachfolger sowie der Könige des Ostfränkischen und späteren Römisch-Deutschen Reiches stammen sollen.
Weniger überraschend wäre in diesem Zusammenhang, dass alle diese Urkunden Fälschungen aus späterer Zeit sein könnten, zumindest bis ins 13. Jahrhundert hinein. Tatsächlich sind nach H.C. Faußner aus rechtshistorischer Sicht nahezu alle Königsurkunden vor 1122 (Wormser Konkordat) Fälschungen [Faußner 2003].
Jesus im Koran
Der Koran kennt keine zeitliche Distanz von 1313 Jahren zwischen dem Auszug aus Ägypten und der Geburt von Jesus Christus. Im Koran wird Jesus "Isa" genannt.