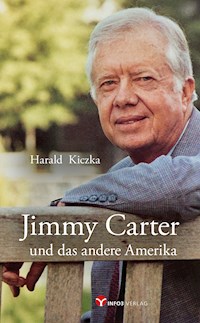
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Info 3
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die erste Biographie dieses ungewöhnlichen US-Präsidenten im deutschen Sprachraum und eine leidenschaftliche Würdigung des Gewissens Amerikas! In der langen Reihe von US-Präsidenten war Jimmy Carter zwischen 1977 und 1981 eine Ausnahmeerscheinung. Dieses Buch zeigt ihn von seiner persönlichen Seite mit seiner tiefen Religiosität und in vielen Facetten seiner Menschenfreundlichkeit. Gleichzeitig wird deutlich, wie der bescheidene Farmer aus dem Süden in seiner Amtszeit mit Weitblick zahlreiche Themen gesetzt hat, die uns gerade heute beschäftigen. Vor allem sind hier sein lebenslanger Einsatz gegen Rassendiskriminierung, für Frauenrechte und nicht zuletzt für den Klimaschutz zu nennen, den sich Carter bereits auf die Fahnen schrieb. Außenpolitisch steht er für eine Präsidentschaft ohne begonnene Kriege und mit historischen Friedensabkommen. Sein weit über die Amtszeit hinausreichendes Wirken für Frieden und Menschenrechte brachte ihm 2002 den Friedensnobelpreis ein. Gerade im Blick auf die zerstrittenen und geschwächten USA der Gegenwart ist Carter als Gesicht des „anderen Amerika“ heute hoch aktuell. „Jimmy Carter gehört in eine Reihe mit amerikanischen Philosophen wie Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau und anderen idealistischen Vertretern der Bürgerrechte. Er ist ein Mensch, der nicht durch einen egozentrischen Lebensweg geprägt ist. Carters Leben, Streben und Wirken basieren auf höheren Werten. Er dachte in größeren Zusammenhängen, mit Visionen für eine hoffnungsvollere globale Zukunft.“ Harald Kiczka
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Ähnliche
Harald Kiczka:
Jimmy Carter und das andere Amerika
ISBN E-Book 978-3-95779-156-6
ISBN gedruckte Version 978-3-95779-151-1
Diesem E-Book liegt die erste Auflage 2022 der gedruckten Ausgabe zugrunde.
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
© Info3 Verlagsgesellschaft Brüll & Heisterkamp KG
Frankfurt am Main, 2022
Lektorat: Jens Heisterkamp, Frankfurt am Main
Typographie und Satz: de·te·pe, Ulrich Schmid, Aalen
Umschlag: Frank Schubert, Frankfurt am Main
Über dieses Buch
Jimmy Carter gehört in eine Reihe mit amerikanischen Philosophen wie Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau und anderen idealistischen Vertretern der Bürgerrechte. Er ist ein Mensch, der nicht durch einen egozentrischen Lebensweg geprägt ist. Carters Leben, Streben und Wirken basieren auf höheren Werten. Er dachte in größeren Zusammenhängen, mit Visionen für eine hoffnungsvollere globale Zukunft.
Harald Kiczka
In der langen Reihe von US-Präsidenten war Jimmy Carter zwischen 1977 und 1981 eine Ausnahmeerscheinung. Dieses Buch zeigt ihn von seiner persönlichen Seite mit seiner tiefen Religiosität und in vielen Facetten seiner Menschenfreundlichkeit. Gleichzeitig wird deutlich, wie der bescheidene Farmer aus dem Süden in seiner Amtszeit mit Weitblick zahlreiche Themen gesetzt hat, die uns gerade heute beschäftigen. Vor allem sind hier sein lebenslanger Einsatz gegen Rassendiskriminierung, für Frauenrechte und nicht zuletzt für den Klimaschutz zu nennen, den sich Carter bereits auf die Fahnen schrieb. Außenpolitisch steht er für eine Präsidentschaft ohne begonnene Kriege und mit historischen Friedensabkommen. Sein weit über die Amtszeit hinausreichendes Wirken für Frieden und Menschenrechte brachte ihm 2002 den Friedensnobelpreis ein. Gerade im Blick auf die zerstrittenen und geschwächten USA der Gegenwart ist Carter als Gesicht des „anderen Amerika“ heute hoch aktuell.
Die erste Biographie dieses ungewöhnlichen US-Präsidenten im deutschen Sprachraum und eine leidenschaftliche Würdigung des Gewissens Amerikas.
Über den Autor
Harald Kiczka, Jahrgang 1954, hat in Bochum Philosophie, Anglistik und Amerikanistik studiert. Er war Fachlehrer für Englisch und Religion und Klassenbetreuer in der Oberstufe an der Rudolf Steiner Schule in Witten. Er hielt Vorträge, übersetzte und publizierte Artikel zu diversen Themen, vorrangig über das Thema Amerika. Er hat ausgewählte Werke Ralph Waldo Emersons übersetzt und herausgegeben und an der Veröffentlichung von Carl Stegmanns Buch Das andere Amerika mitgearbeitet. Seit 20 Jahren engagiert er sich ehrenamtlich in einem von ihm und seiner Frau gegründeten gemeinnützigen Verein für hilfebedürftige Menschen jedweder Herkunft.
Ein herzlicher Dank geht an meine Frau Ute Kiczka für die jahrelange Mitarbeit an diesem Projekt.
Inhalt
1Worum es geht
2Amerika lässt uns nicht kalt
3Das historische Erbe auf Carters Weg
4Plantagenwirtschaft in Virginia – Puritaner in Neuengland
5Amerikas Dualismus und Jimmy Carter
6Das Doppelantlitz Amerikas
7Jimmy Carter als Sprecher eines anderen Amerika
8Eine Kindheit – barfuß und ohne Hemd
9Bei der Marine
10Zurück in Plains
11Die politische Karriere – im Senat des Staates Georgia
12Auf dem Weg zum Amt des Gouverneurs
13Jimmy Carter wird Gouverneur von Georgia
14Wahlkampf auf dem Weg zur Präsidentschaft
15Auf dem Weg ins Weiße Haus
16James Earl Carter wird Präsident
17„Rosalynn and I“ – Ehefrau und Partnerin im Amt
18Ein Präsident macht seinen Job anders
19Global Player mit Weitblick
20Innenpolitische Errungenschaften
21Die Wasserreform
22Die Rechte indigener Völker – ein Beispiel aus dem Staat Maine
23Erziehung und Bildungschancen
24Herzensangelegenheiten während seiner Präsidentschaft
25Das Energiesparprogramm
26Der Panamakanal wird zurückgegeben
27Carter und Lateinamerika – bis heute ein großes Thema
28Carters Umgang mit den Phobien der Zeit
29Präsident in schwierigen Zeiten: Kalter Krieg, SALT II, Neutronenbombe
30Das Schreckgespenst des Kalten Krieges
31Camp David – Frieden zwischen Ägypten und Israel
32Das Jahr 1979 als Zeitenwende
33Eine Folge des Vietnamkriegs: flüchtende Menschen
34Krisenherd Afghanistan – auch im Jahr 1979
35Das Geiseldrama von Teheran – Carters Schicksalsjahr
36Was geschah wirklich?
37Carter ist nur eine Amtszeit vergönnt
38Unerfüllte Hoffnungen
39Nach der Präsidentschaft
40Das Carter Center im Kampf gegen den Hunger in der Welt
41Frieden schaffen in der Welt – aus praktischer Erfahrung
42Unermüdlicher Einsatz
43Politik und Religion
44Frauenrechte sind Menschenrechte
45Musik und Gebet
46Die Carters im Alter
47Carters Erbe
Anmerkungen
Bildquellenverzeichnis
Anhang
Bücher von Jimmy Carter
Filme und DVDs
Bücher von Rosalynn Carter
Informationsquellen über Jimmy Carter im Internet
Weitere Literatur
1
Worum es geht
Seit der Präsidentschaft Donald Trumps und mit dem neuen Präsidenten Joe Biden ist ein anderer amerikanischer Präsident wieder verstärkt in das öffentliche Interesse gerückt: Jimmy Carter. Dabei vollzieht sich auch eine neue Bewertung seiner Amtszeit, denn er wird nun nicht mehr als schwacher, zaudernder Präsident gehandelt. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf seine damaligen Ziele, die heute wieder hochaktuell wirken. Seine Entscheidungen in einer Zeit des Kalten Krieges und internationaler Krisen werden in Amerika von Historikern, Journalisten und Vertretern der Medien neu bewertet. Das geht aus zahlreichen Artikeln, Büchern, Beiträgen im Internet und mehreren Dokumentarfilmen deutlich hervor. Auch die Doku Carterland ist eine Würdigung seiner Leistungen und seiner Person. Sie wurde beim Atlanta Film Festival im April 2021 vorgestellt.
Jimmy Carter, mit vollem Namen James Earl Carter Junior, bekleidete von 1977 bis 1981 das höchste Amt der USA. Ihm war nur eine Amtszeit vergönnt. Seine Präsidentschaft fiel in eine äußerst krisenreiche Zeit mit vielen nationalen und internationalen Problemen, für die er keine Verantwortung trug, denen er sich allerdings mit allen Konsequenzen stellen musste. Bei Fertigstellung dieses Buches war er 97 Jahre alt. Seine Jugendliebe Rosalynn, die ihm Zeit seines Lebens liebende Ehefrau, Partnerin, aktive Mitstreiterin und Beraterin ist, lebt mit ihm gemeinsam in einem schlichten Haus in dem kleinen Ort Plains, in einer ländlichen Region im Bundesstaat Georgia, wo sie beide aufgewachsen sind. Nach seiner Zeit als Präsident ist es um dieses Ehepaar bis heute allerdings nicht still geworden. Es nimmt deutlich Stellung zu aktuellen Ereignissen, Themen und politischen Angelegenheiten. Carter ist einer der schärfsten und kompetentesten Kritiker der Regierungen und ihrer Präsidenten nach ihm. Rosalynn und Jimmy Carter gründeten 1982 das „Carter Center“ in Atlanta.
Für das Projekt Habitat for Humanity hat man bis vor einigen Jahren das betagte Ehepaar alljährlich als Projektteilnehmer in Aktion gesehen, in zünftiger Arbeitskluft mit Hammer und Säge.
Das ist ihnen zur Gewohnheit geworden. Jetzt hat für sie das hohe Alter begonnen, große Reisen und öffentliche Auftritte werden beschwerlicher und damit auch seltener.
Jimmy Carter zusammen mit seiner Frau Rosalynn bei der Arbeit für das Projekt Habitat for Humanity
Noch immer kommen Menschen von weit her nach Plains, um in der Baptistenkirche Carters Sonntagsansprachen nach der amerikanischen Tradition der Sunday School zu hören. Zahlreiche aufstrebende Politiker der demokratischen Partei und Vertreter der jüngeren Generation besuchen ihn scharenweise, um sich in Sachen Politik, Gesellschaft und in sozialen Fragen beraten zu lassen oder auch nur, um dieser charismatischen Persönlichkeit einmal persönlich zu begegnen.
Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mit zahlreichen falschen Urteilen über ihn persönlich und insbesondere über seine Präsidentschaft aufzuräumen. Viele negative Phrasen über sein Wirken werden von Kommentatoren, Journalisten und Politikern bis heute meist ungeprüft übernommen und wiederholt. Hinzu kommt, dass Jimmy Carter in Europa nicht sonderlich bekannt ist.
Als ich als junger Mann Gast in Amerika war, fiel er mir zur Zeit des Wahlkampfes 1976 als Kandidat der Demokraten auf. Die Berichterstattung über seine Persönlichkeit, seine Herkunft und seine politischen Ziele interessierten mich. Er war anders als alles andere was ich bisher kannte. Nicht nur war es überraschend, was er sagte, sondern da klang für meine jungen Ohren endlich einmal ein Politiker wie ein nachdenklicher, intelligenter, besonnener und seriöser Mensch. Nach Jahren der Beschäftigung mit Carter wurde mir klar, dass es sich bei dem Erdnussbauern aus Georgia, der zum Präsidenten wurde, um einen globalen Denker, Humanisten und Visionär handelt. Und es stellte sich mir die Frage, wie es möglich sein konnte, dass in einem kapitalistischen Land, in dem die Wirtschaft, die Finanzen und der Materialismus in vielen Bereichen über allem stehen, ein Mensch wie Jimmy Carter überhaupt Präsident werden konnte.
Dieses Buch soll Licht werfen auf manch verstaubte Sicht, ihn einordnen in verschiedene Strömungen innerhalb der USA, aber auch abgrenzen von Strömungen, die in Deutschland weitgehend unbeachtet bleiben. Der Blick soll dabei auf eine positive Denkrichtung gelenkt werden, für die er, unter anderen Zeitgenossen, als ein besonders hervorragendes Beispiel steht. Carter hat als Präsident der Weltmacht Amerika ein anderes Gesicht geben können. Fast fünf Jahrzehnte nach seinem Versprechen an das Volk: „Ich werde Sie niemals belügen“ regierte insbesondere mit Donald Trump eine völlig andere Gesinnung. Es schien in diesen vier Jahren der Trump-Präsidentschaft, als sei der Urgedanke dieser Nation in einen Tiefschlaf versunken. Es schlummern aber immer noch positive Kräfte hinter der Fassade eines Amerika, das sich uns in den Jahren 2016 bis 2020 mit dem nationalistischen Ruf „America First“ und mit einem narzisstischen Egomanen als Präsident offenbarte, der sich des Vokabulars des Rassismus und des Faschismus bediente und unverhohlen Andersdenkende als Feinde Amerikas bezeichnete. Die angedeuteten anderen Kräfte aber basieren auf den Werten idealistischer Vorfahren und der Gründerväter der USA, mit der Vision einer anderen, einer besseren Welt. Diesen Hintergrund sollten wir deutlich ins Bewusstsein nehmen.
Jimmy Carter gehört in eine Reihe mit den amerikanischen Philosophen des Idealismus und Transzendentalismus wie Ralph Waldo Emerson oder dem Verfechter bürgerlichen Ungehorsams Henry David Thoreau sowie von Literaten, Politikern, Intellektuellen und Vertretern der Bürgerrechte und der Chancengleichheit aller Amerikaner. Er ist ein Mensch, der nicht durch einen egozentrischen Lebensweg geprägt ist. Auf den geistigen Hintergrund Amerikas in der Philosophie des Transzendentalismus wird an späterer Stelle noch eingegangen. Carters Leben, Streben und Wirken basieren auf höheren Werten. Er dachte in größeren Zusammenhängen, mit Visionen für eine hoffnungsvollere globale Zukunft. Er bewies damit, dass er in sehr vielen Punkten schlicht und einfach anders war als die Präsidenten vor ihm, mit wenigen Ausnahmen, besonders aber anders als seine Nachfolger. Er ist in fast allen Punkten das krasse Gegenbild zu seinen Nachfolgern Ronald Reagan, George W. Bush und noch viel mehr zu Donald Trump. Er bekannte sich zur Wahrhaftigkeit und lebte in der Hoffnung, dass die Menschheit in Zukunft eine globale Gemeinschaft aller Nationen sein könne. Schon Rudolf Steiner brachte den Zusammenhang von Nationalismus und Unwahrhaftigkeit auf den Punkt: „Denn so viel Nationalismus in der Welt entstehen wird, so viel Unwahrheit wird in der Welt sein, besonders gegen die Zukunft hin.“1 Bedenkt man diese Äußerungen Steiners, so kann der Gedanke aufkommen, dass Carter durch sein Leben und Wirken als zeitweise mächtigster Mann der Welt möglicherweise durch das Einbeziehen eines Höheren im Menschen schlimmere Verhältnisse verhindert hat. Er hat aus dieser Gesinnung 2011 ein Buch mit Meditationen für jeden Tag des Jahres veröffentlicht, in dem er die ihm eigene Art des Meditierens vorstellte2. Steiner wies auf eine Gefahr hin, die lauern würde, falls die Menschen sich nicht mehr mit spirituellen Inhalten befassten, sei es durch geistige oder meditative Übungen. Sie würden in einen hochgradigen Egoismus hineingetrieben und könnten nur noch Forderungen an das Leben stellen, aber nicht gewiesen werden auf „soziale Triebe, auf soziales Mitgefühl und dergleichen.“3 Dies würde historische Ereignisse nach sich ziehen. Der Autor Wolfgang Weirauch spricht hier von einem drohenden Gegenschlag: „Dieser ergreift in dem Menschen unbewusste Instinkt- und Triebbereiche und gerät in den Willen als zerstörerische Kraft, in diesem Fall als nationale, chauvinistische Impulse oder kriegerische, menschenvernichtende Taten.“4
Wenn hier im Folgenden von Amerika die Rede ist, so sind die Vereinigten Staaten von Amerika gemeint, nicht Mittel- oder Südamerika und auch nicht Kanada, das sich eigenständig und anders entwickelt hat und eigentlich eher ein Schmelztiegel vieler Nationen geworden ist. Allerdings muss hier erwähnt werden, dass die europäischen Einwanderer und der spätere Staat Kanada die indigenen Völker ebenfalls menschenverachtend behandelt haben. Die USA sind als Melting Pot of Nations bekannt und tatsächlich sind sie eine neue Heimat all der Immigranten in Amerika geworden. Sie übernahmen zwar die Staatsbürgerschaft der USA, blieben aber oft der Heimat in Europa oder Asien verbunden. So ist die USA doch kein echter Schmelztiegel der Völker geworden. In fast jeder amerikanischen Großstadt gibt es noch heute eine Chinatown, ein italienisches, russisches oder polnisches Viertel, besonders in New York City. Im Norden der USA, aber auch in Texas, sind es die Skandinavier und die Deutschen, deren Nachfahren noch heute oftmals deutsche Bäckereien betreiben und dort ihre Muttersprache in Vereinen und im familiären Umfeld pflegen. Ein Bindeglied für Identifikation findet sich heutzutage fatalerweise aufgrund der Hautfarbe, am destruktivsten in Gestalt der „Bewegung der Weißen Vormachtstellung“ (White Supremacy) und deren vielen militaristischen und faschistisch-aggressiven Clubs und Untergruppen.
Um Jimmy Carter als Mensch, als Amerikaner und als Präsident der Weltmacht kennenzulernen muss allerdings auf einige Grundzüge im geschichtlichen Werdegang Amerikas eingegangen werden.
2
Amerika lässt uns nicht kalt
Die Spaltung der USA mit einer Polarisierung der Gesellschaft ist gerade in den letzten Jahren mehr als offensichtlich. Aber schon seit den Anfängen der amerikanischen Geschichte war dieses Land zerrissen zwischen Einwanderern, die überwiegend aus Europa stammten und den Ureinwohnern, den indigenen Völker, die fälschlicherweise als Indianer bezeichnet wurden. Die Vertreter verschiedener Eroberernationen, im wesentlichen Engländer, Spanier und Franzosen, waren auch untereinander zerstritten; so vertieften sich die Gräben. Wir versuchen Amerika besser kennenzulernen und dann vielleicht auch besser zu verstehen. Dazu ist es notwendig, eine ideengeschichtliche Zusammenschau voranzustellen. „Es ist also nüchterne Pflicht, uns über das rätselhafte Imperium im Westen immer von neuem ins Bild zu setzen,“ schreibt der Journalist Klaus Harpprecht. „Man muss beharrlich versuchen, den Medienvorhang der Klischees und die Barrieren der Vorurteile beiseite zu schieben, Tag um Tag. Das ist nicht leicht. Die Mythen verstellen den Blick. Sie erklären manches und verdunkeln viel. Die Vereinigten Staaten sind, jenseits der Mythen, die Amerikaner. Gesichter, die wir zu erkennen vermögen. Menschen, mit denen wir vertraut werden, die wir begreifen, wenn wir uns mit ihnen Mühe genug geben … Fangen wir bei denen an.“5
Weder Menschen noch ganze Völker, da können wir Klaus Harpprecht durchaus zustimmen, lassen sich ohne Sympathie verstehen. Kaum einem anderen Land gegenüber gibt es so viele Urteile, Meinungen, Klischees und Ängste wie gegenüber den USA. Dies ist bei der Bedeutung Amerikas für das alltägliche Leben aller Menschen auf Erden, für die internationale Politik, die Weltwirtschaft und die Finanzwelt, nicht weiter verwunderlich. Auch ist mehr als deutlich, wie sehr amerikanische Einflüsse die Menschheit verwandelt haben und weiter verwandeln. Man kommt als Zeitgenosse schlichtweg nicht umhin, sich mit Amerika auseinanderzusetzen. Bemerkenswert scheint dabei aber die Tatsache, dass bei dieser Auseinandersetzung gehörig von den Kräften der Sympathie oder Antipathie Gebrauch gemacht wird. Doch Zuneigung und Ressentiments, sofern sie kollektiver Art sind, sollte man gleichermaßen misstrauen, riet der altersweise Harpprecht.
Amerika gegenüber kann man aber offensichtlich nicht gleichgültig bleiben. Die täglichen Nachrichten aus diesem Land überraschen mit ihren Ungereimtheiten, das war schon bei der Regierung des George Bush, aber dann, in erheblich gesteigertem Maße, bei derjenigen Donald Trumps der Fall. Diese Empfindung wird auch durch die Geschichte der USA genährt, mit den unsäglichen und verlorenen Kriegen in Korea und in Vietnam, welche die Macht- und Expansionsbestrebungen der kommunistischen Staaten in Südostasien zurückdrängen sollten. In neuerer Zeit waren es die Kriege in Afghanistan mit 20 Jahren Militärpräsenz und im Mittleren Osten mit den beiden Golfkriegen, 1990/91 zwischen dem Irak und einer US-geführten Militärkoalition, und 2003 wiederum einer US-geführten Militärkoalition.
Unbeachtet, weil auf den ersten Blick weniger spektakulär und nicht den gängigen Klischees entsprechend, verbleiben andere Tatsachen. Das Vietnamtrauma ist in vielen amerikanischen Familien präsent. Die Aufarbeitung findet zwar statt, oftmals allerdings unterschwellig und auf gänzlich andere Art als dies in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg in Deutschland geschah. Die neuere Geschichte der USA hat ohne Zweifel das Denken vieler Menschen verändert, wie auch immer man amerikanische Versuche zur Geschichtsbewältigung beurteilen mag. Protestaktionen, die sich zum Beispiel gegen die Golfkriege richteten, übertrafen zahlenmäßig ähnliche Bewegungen in Deutschland und anderen Ländern. Eine so in Amerika noch nie dagewesene Protestbewegung gegen den Vietnamkrieg in den Sechzigern, gegen eine nationalistisch geprägte Kriegsverherrlichung und die Verschleierung der wahren Ausmaße des Krieges erschütterte die Grundfesten der bürgerlichen amerikanischen Gesellschaft. Es war dies die sogenannte „Hippie-Generation“, eine Antikriegsbewegung mit ihren Friedenssymbolen wie der Blume im Haar, der „Flower Power“ und der Botschaft zu lieben statt Krieg zu führen. Diese Bewegung wurde weltweit aufgegriffen und verbreitete sich besonders auch in anderen westlichen Ländern. Doch schon nach wenigen Jahren verflachte sie wieder. Immerhin bestanden in der Zeit des Vietnamkrieges und danach in den USA mehr als 6000 sozialutopische Landkommunen, die auf der Suche nach neuen Lebensformen waren.
Skandale werden in den USA von Journalisten oft häufiger und schonungsloser aufgedeckt als dies hierzulande geschieht. Besonderes Aufsehen erregten die Enthüllungen der Washington Post, die als Watergate Skandal in die Geschichte eingingen und einen verlogenen Präsidenten Richard Nixon zum Rücktritt zwangen. Nach Carters Präsidentschaft erschütterte ein Skandal das Land, der als die Iran-Contra-Affäre in die Geschichte einging. Und weitere Phänomene gehören in diese Reihe: Unvergessen rumoren in den Seelen vieler Amerikaner wie in einem kollektiven Erinnerungstableau noch die Morde an Abraham Lincoln, an Präsident John Fitzgerald Kennedy, an seinem Bruder Robert Francis Kennedy und an Martin Luther King.
Robert (Bobby) Francis Kennedy war Senator und Justizminister. Mit seinen politischen Grundhaltungen wirkte er wie ein Vorbote Jimmy Carters. Als Justizminister trat er entschieden der Rassendiskriminierung entgegen, setzte sich für Menschenrechte ein und kämpfte gegen das organisierte Verbrechen. Vehement kritisierte er die Vietnampolitik von Präsident Johnson und den verheerenden Krieg. Schon in seiner Zeit als Senator hatte er liberale, linke Positionen mit besonderem Interesse für gesellschaftliche und soziale Fragen vertreten. Anders als sein Bruder wurde er zu einem Vertreter des linken Flügels der demokratischen Partei. Während einer Wahlkampfveranstaltung für das Amt des Präsidenten wurde er im Juni 1968 Opfer eines Attentats. Historiker sehen die Attentate auf John F. Kennedy im November 1963, auf Martin Luther King im April 1968 und auf Bobby Kennedy im Juni 1968 als das Ende einer Ära der Hoffnung auf eine gesunde Demokratie für alle Amerikaner. Erst acht Jahre später wurde sie mit Jimmy Carter wiedererweckt und konnte sich entfalten.
Viele positive Impulse Einzelner mögen die Kritiker Amerikas als Randerscheinungen vom Tisch der vergleichsweise kurzen und kompakten Geschichte des Landes wischen. Sie mögen sich auch recht bescheiden ausnehmen, gemessen an den Widerwärtigkeiten amerikanischer Politik und den Exzessen einer materialistischen Weltanschauung und der bis heute schwelenden Probleme, wie dem Rassismus, der Benachteiligung von Frauen, der Ureinwohner des Kontinents und der Afroamerikaner. Dazu gehören auch der immer wieder aufflammende Unilateralismus, der Militarismus und diverse Erscheinungen nationaler Selbstherrlichkeit.
Die positiven Ansätze stehen nicht im Rampenlicht der Medien. Wesentlich daran ist aber, dass es sich um Willensimpulse einzelner Menschen handelt, die genauso zu Amerika gehören wie die der politischen Entscheidungsträger und deren Hintermänner, und insbesondere der Medien, die Sensationen und Einschaltquoten höher schätzen als die Wahrheit. Das Wissen und eine Würdigung dieser anderen Impulse in der amerikanischen Gesellschaft könnte über nationale Grenzen hinweg menschenverbindend sein. Es könnte helfen, die Hürden vorgefertigter Urteile abzubauen, um den Blick frei zu bekommen für eine umfassendere Realität.
Klaus Harpprecht, der unter anderem langjährig im Büro Willy Brandts tätig war und als Korrespondent für das ZDF in Washington arbeitete, war für meine Amerika-Forschung seit vielen Jahren Vorbild und Berater, insbesondere durch seine umfassenden Erfahrungen und sensiblen Schilderungen des Lebens in Amerika. Er ermutigte mich letzten Endes auch, diese Carter-Biographie zu beginnen, da er der Überzeugung war, dass es im deutschen Sprachraum Zeit dazu sei und dass diese Persönlichkeit eine gründliche Biographie verdiene, damit sie auch im deutschen Sprachraum eine stärkere Würdigung erfahre.
Die weltweite Faszination für Amerika bleibt als Phänomen bestehen, und dies trotz all der Machtansprüche und Alleingänge in globalen Zusammenhängen nicht nur auf militärischem Gebiet, sondern auch bei der internationalen Kooperation in Themen der Umwelt, des Naturschutzes und der Menschenrechte. Es wäre zu kurz gegriffen, wollte man die in den USA immer noch bestehende Offenheit auf die Faszination eines bestimmten Lebensstils zurückführen oder auf materielle Phänomene wie Cola, McDonalds, Disneyland, Jeans, Nike, Hollywood, Microsoft oder Google reduzieren. Erstaunlich bleibt, wie viel vom amerikanischen Lebensstil weltweit übernommen wird. Beispiele lassen sich in fast allen Lebensbereichen finden. Das christliche Allerheiligen-Fest wird zu Halloween, einem heidnischen Brauch. Aus dem christlichen Gedenktag Christi Himmelfahrt wird der Vatertag, das Christkind wird zum Weihnachtsmann. Ein anderes Beispiel sind die Debatten vor den Wahlen mit Rededuellen der Kandidaten im Fernsehen und flache, aber durchaus unterhaltsame Talkshows- und Quizsendungen. Die Traumfabrik Hollywood liefert mit ihren Spektakeln, den alljährlichen Preisverleihungen immer noch genügend Material, um in den Hauptnachrichten in Deutschland erwähnt zu werden. Die USA sind nach wie vor ein beliebtes Reiseziel, trotz der offensichtlich amerikanischen Lebenswirklichkeit zwischen extremem Luxus in den Ghettos der Superreichen und der unübersehbaren Armut nicht nur in den Elendsvierteln der Großstädte mit einer krassen Obdachlosigkeit. Es herrscht finanzielle Not auch bei vielen Menschen des Mittelstandes, die oft unzureichenden Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Hinzu kommt die immer wieder aufflammende Polizeigewalt, insbesondere gegenüber den Angehörigen von Minderheiten, inzwischen nicht nur gegen Schwarze, sondern auch gegen Menschen asiatischer Herkunft. Aufgrund der sich häufenden Attacken gegen Angehörige von Minderheiten wurde ein neues Wort geprägt: Hassverbrechen.
Es ist nicht nur die atemberaubende Schönheit und Weite des Landes oder die Faszination des pulsierenden Lebens der Metropolen mit Vertretern nahezu aller Herkunftsländer und Ethnien der Erde, die dem Gast dort ins Auge fallen. Allein aufgrund dieser Tatsache verwundert es, dass es weiterhin Rassismus in den USA gibt. Das alltäglich erlebbare Verhältnis der Menschen im Umgang miteinander wird als freundlich, verbindlich und wärmer als anderswo wahrgenommen, besonders außerhalb der großen Städte. Auffallend ist die häufige Anrede mit dem Namen des Gegenübers während einer Unterhaltung. Jugendliche, die an einem Schüleraustausch in den USA teilgenommen haben, berichten häufig, dass der Umgang zwischen Schülern und Lehrern entspannter, freundlicher und respektvoller sei. Es herrscht trotz vieler Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten nach wie vor eine erstaunlich positiv-optimistische Lebenseinstellung. Reisende im Lande erfahren vielerorts und immer wieder große Gastfreundschaft, die wir in Europa immer seltener antreffen, oft kommt ein geradezu kindlich neugieriges Interesse an der Herkunft und an den Gründen für den Besuch auf.
Die Vorstellung von einer anderen, einer besseren Welt, die der Entwicklung der USA zu Grunde liegt, ist der wahre amerikanische Traum. Zu Recht wird Amerika als das Land der Kontraste und Extreme bezeichnet. Wie Klaus Harpprecht bemerkt, können Reisende mit Leichtigkeit jedes Klischee und jedes Vorurteil tausendfach bestätigt finden, im Negativen wie im Positiven. Manche Länder machen es einem leichter. Wer mit positiven Augen auf dieses Land und seine Menschen blickt, wird bereichert heimkehren, wer mit einer negativen Grundeinstellung kommt, kann sich überwältigender negativer Bestätigung sicher sein. Wer lernen will, Amerika zu verstehen, kommt nicht umhin, sich zumindest kurz mit der Geschichte dieses Kontinents zu befassen.
3
Das historische Erbe auf Carters Weg
Wenn wir auf Carters Amtszeiten als Gouverneur und als Präsident zurückblicken, ist es wichtig, die historischen Zusammenhänge deutlich in den Blick zu nehmen. Die Vereinigten Staaten, die eine vergleichsweise kurze Geschichte haben, sind die einzige unter den großen Nationen der Welt, die sich selbst durch einen bewussten Gründungsakt geboren hat. Der Entwurf Amerikas als die Neue Welt weist auf ein Urbild für Staats-Utopien zurück, das auf die Schrift Utopia des englischen Humanisten Thomas Morus im Jahr 1560 zurückgeht. Darin beschreibt er eine Insel in einer Neuen Welt als Sitz eines Staates in seiner Idealform, dessen Regierung demokratisch ist. Eine Bürgerversammlung bestellt ein Wahlkollegium, das seinerseits einen Rat der Weisen und einen Fürsten auf Lebenszeit einsetzt. Allgemeine Schulpflicht und zahlreiche Weiterbildungseinrichtungen für Erwachsene werden eingeführt, Kranken- und Altenfürsorge bestehen als feste staatliche Institutionen. Dies alles basiert auf demokratischer, freiheitlicher Grundlage, einschließlich religiöser Freiheit. Die allgemeine Wehrpflicht wird damit begründet, dass der Staat in der Lage sein muss, befreundeten Ländern im Falle einer Bedrohung durch Tyrannen zu helfen, denn eine Bedrohung anderer Staaten stellt auch eine Bedrohung für Utopia dar.
Utopia sollte das transatlantische Asyl für die in der alten Welt Bedrängten sein. Man kann davon ausgehen, dass die „Entdecker“ Amerikas und die späteren Eroberer und Einwanderer nicht nur von den damals neuen Erdkarten geleitet wurden, sondern auch von Ideen einer neuen Welt mit visionären Gesellschaftsformen. Doch nicht nur die eingewanderten Weißen nahmen etwas Neues in Angriff. Auch schon vor ihnen waren auf dem amerikanischen Doppelkontinent fortschrittliche Gesellschaftsformen mit Millionen Einwohnern gebildet worden, und dies, wie noch nicht lange bekannt, auch in großen Städten und Ansiedlungen, nicht nur in Süd- und Mittelamerika, sondern bis in die arktischen Regionen hinauf. Es gab auch in Nordamerika Hochkulturen mit einem ausgeprägten Ahnenkult, religiösen Kultstätten und Pyramidenbauten. Cahokia, die bekannteste Metropole dieser vergessenen Kulturen, gilt als das Hauptzentrum. Ihre Zeit war längst schon zu Ende gegangen, als die Mächte Europas Amerika vor 500 Jahren entdeckten. Einiges davon hat sich erhalten. Nicht unterschätzt werden darf zum Beispiel die Bedeutung der Konföderation der Irokesenstämme im 16. Jahrhundert. Dieses Bündnis, hervorgegangen aus einer Häuptlingsversammlung, die auf dem Gebiet der mittleren Atlantikregion alle ehemals verfeindeten Stämme befriedet hatte, schuf eine Zone dauerhaften Friedens. Ironie der Geschichte: Dieses Bündnis bot in seiner friedlichen Haltung eine günstige Grundstimmung auch den Siedlern gegenüber, die sonst auf eher skeptische bis feindselige Einwohner getroffen wären. Hinzu kam der wiederauflebende Mythos des Weißen Gottes, der aus dem Osten kommen sollte. Die Ureinwohner Amerikas lebten also in der Erwartung kommenden Heils. Die Geschichte der Besiedlung Amerikas hätte sonst mit Sicherheit einen anderen Verlauf genommen. Der Gründervater Benjamin Franklin rettete immerhin die Grundgedanken der Vereinigten Indianischen Nationen hinüber in den Entwurf der amerikanischen Bundesverfassung.
Zwei Hauptströmungen kennzeichnen das weitere geschichtliche Werden Amerikas. Da ist zunächst die Gründung einer ersten englischen Kolonie in Jamestown, Virginia, im Jahre 1607 und dann die der Puritaner an der Plymouth Bucht in Massachusetts im Jahre 1620. Im 15. und 16. Jahrhundert hatten sich die Konflikte der wirtschaftlich und machtpolitisch führenden Staaten in Europa verschärft. Die Spanier beherrschten die Weltmeere und erschlossen durch die Eroberung und anschließende Plünderung der Kulturen Süd- und Mittelamerikas der spanischen Krone eine Quelle des Wohlstandes. Mit ihrer dadurch ausgebauten Vormachtstellung erschütterten sie das wirtschaftliche und politische Gleichgewicht in Europa. England war bemüht, Spanien diese Stellung abzuringen. Die Niederlage der spanischen Armada besiegelte 1588 den Niedergang Spaniens und den Aufstieg Englands. Die neue Weltmacht, das British Empire, war relativ spät zum Kampf um die Aufteilung der Neuen Welt angetreten und zog zwar nun ebenfalls zur Mehrung des Ruhmes der Krone aus, richtete ihr Begehren aber mehr auf das Dauerhafte, auf den Besitz an Grund und Boden, den es zu besiedeln und zu bewirtschaften galt. Die Werbe-Balladen sangen von einer guten Erde, die wirksamer sei als Gold und Waren, und lockten damit in den englischen Dörfern und Städten die Armen und die Mutigen für das neue Leben im Westen an. Wie der Hungrige nach Brot, so verlangten die Auswanderer nach dem neuen Land.





























