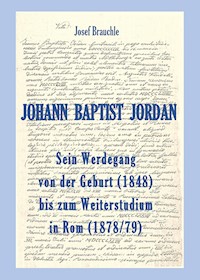
5,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch bringt eine ausführliche und quellenbezogene Dokumentation des Lebens von Johann Baptist Jordan, dem späteren Pater Franziskus Maria vom Kreuze (1848-1918), bis zum 31sten Lebensjahr. Diese gibt einen Einblick in seine persönliche und geistliche Entwicklung von seiner Kindheit und Jugend in seiner Heimat Gurtweil (Baden) an. Nach seiner beruflichen Tätigkeit erlangte Jordan das Abitur in Konstanz und begann in Freiburg das Theologiestudium. Nach der Priesterweihe kam er zum Weiterstudium nach Rom. Doch bewegte ihn immer mehr der Gedanke durch eine universale Gesellschaft zur Verlebendigung und Ausbreitung des katholischen Glaubens beizutragen. In den achtziger Jahren des 19. Jahrhundert gründete er in Rom die Ordensgesellschaften der Salvatorianer und der Salvatorianerinnen und legte die Grundlage für ein Laieninstitut, die Internationale Gemeinschaft des Göttlichen Heilandes. Am 15. Mai 2021 findet in der Lateranbasilika in Rom seine Seligsprechung statt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Josef Brauchle
JOHANN BAPTIST JORDAN
Sein Werdegang von der Geburt (1848)bis zum Weiterstudium in Rom (1878/79)
Josef Brauchle
JOHANN BAPTIST JORDAN
Sein Werdegang von der Geburt (1848) bis zum Weiterstudium in Rom (1878/79)
2021
Umschlagbilder:
Vorne: Eigenhändige Vita von J. B. Jordan im Archiv des Campo Santo Teutonico in Rom Hinten: Ölgemälde auf Leinen von Raúl Berzosa (2020), Mutterhaus der Salvatorianer in Rom
© 2021 Josef Brauchle
Lektorat und Gestaltung: Johan Moris
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback: 978-3-347-31053-7
e-Book: 978-3-347-31054-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
KAPITEL 1 GEBURT UND TAUFE VON JOHANN BAPTIST JORDAN
KAPITEL 2 DIE FAMILIE JORDAN
2.1. Die Vorfahren
2.2. Die Eltern: Lorenz und Notburga Jordan, geb. Peter
2.3. Die beiden Brüder Martin und Eduard
2.4. Nahe Verwandte von Johann Baptist Jordan
KAPITEL 3 DAS HEIMATDORF GURTWEIL
3.1. Die geographische Lage
3.2. Zur Geschichte des Dorfes
3.3. Die Pfarrkirche
3.4. Die Einwohnerschaft von Gurtweil
3.5. Das Geburtshaus von P. Jordan
KAPITEL 4 KINDHEIT UND JUGEND
4.1. Kindheit in ärmlichen Verhältnissen
4.2. In der Volksschule
4.3. Firmung am 20.9.1860 in Waldshut (?)
4.4. Das besondere Erlebnis der Erstkommunion am 7.4.1861
KAPITEL 5 ARBEITSJAHRE UND MILITÄRZEIT
5.1. Arbeiter am Bau der Bahnlinie Waldshut – Konstanz (1862-1864)
5.2. Als Malerlehrling in Waldshut (1864-1866)
5.3. Jordan und der Volksschriftsteller Pfarrer Heinrich Hansjakob
5.4. Als Malergeselle auf Wanderschaft (März 1867 - August 1868)
5.5. Musterung beim Militär (20.8.1868)
5.6. Mitglied im katholischen Gesellenverein (Kolping) 27.9.1868
5.7. Maria und das Jesuskind – eine Kohlezeichnung von Baptist Jordan (1868)
5.8. Jordan beim Militär (1869 und 1870)
KAPITEL 6 PRIVATSTUDIEN (1869-1870)
6.1. Cajetan Geßler, Pfarrer in Gurtweil
6.2. Friedrich Werber, Kaplaneiverweser in Waldshut
6.3. Gottfried Nägele, Vikar in Waldshut
6.4. Erinnerungen
6.5. Eine Primizfeier in Gurtweil
6.6. Volksmission in Gurtweil
KAPITEL 7 AUF DEM GYMNASIUM IN KONSTANZ (1870-1874)
7.1. Empfehlung durch den Heimatpfarrer
7.2. Konstanz am Bodensee
7.3. Das Großherzoglich Badische Gymnasium
7.4. Bezeichnung der Klassen
7.5. Das Schuljahr 1870-1871
7.6. Das Schuljahr 1871-1872
7.7. Das Schuljahr 1872-1873
7.8. Das Abiturjahr 1873-1874
7.9. Die Prüfungen zum Abitur
7.10. Das Abiturzeugnis vom 11.8.1874
7.11. Stark in den Sprachen – schwach in der Mathematik
7.12. Jordan und seine Bücher in der Gymnasialzeit in Konstanz
7.13. Jordans Wohnadressen in seiner Konstanzer Zeit (1870-1874)
7.14. Verköstigung
7.15. Das Kurz’sche Stipendium
7.16. Reise nach Italien (September 1874)
KAPITEL 8 POLITISCHE UND KIRCHLICHE ZEITEREIGNISSE IN BADEN
8.1. 1848 – ein ereignisreiches Jahr
8.2. Das Erzbistum Freiburg und die badische Regierung (1821-1860)
8.3. Kulturkampf in Baden
8.4. Jordan und der Kulturkampf in Baden
KAPITEL 9 STUDIUM IN FREIBURG 1874-1877
9.1. Immatrikulation an der Universität Freiburg i. Br. (23.10.1874)
9.2. Jordans Studienkollegen in Freiburg
9.3. Studium der Philologie
9.4. Jordans „Stundenplan“ an der Universität Freiburg
9.5. Jordans Theologie-Professoren (1874-1877)
9.5.1. Johann Baptist Alzog – Kirchengeschichte
9.5.2. Franz Joseph Ritter von Buß – Kirchenrecht
9.5.3. Joseph König – Altes Testament
9.5.4. Friedrich Kössing – Moraltheologie
9.5.5. Adalbert Maier – Neues Testament
9.5.6. Alban Stolz – Pastoral, Katechetik und Homiletik
9.5.7. Friedrich Wörter – Dogmatik und Apologetik
9.6. Überblick über die Vorlesungen und Bewertungen
9.7. Jordan und seine Bücher während des Studiums in Freiburg
9.8. Das geschlossene Konvikt – Wohnung bei Privatleuten
9.9. Mitglied des theologischen Studentenvereins „Arminia“ (18.12.1875)
9.10. Konviktsdirektor Joseph Litschgi und J. B. Jordan
9.11. Studium von Fremdsprachen
9.12. Beginn der Aufzeichnungen im Geistlichen Tagebuch (1.7.1875)
9.13. Katholikentag in Freiburg (31.8.-4.9.1875)
9.14. Jordan und das „Werk des hl. Paulus“ in Fribourg (8.9.1875)
9.15. Katholikentag in München (September 1876) – Kontakte mit Arnold Janssen
9.16. Interesse am Chinesischen – bei Pfarrer Smorenburg (Sommer 1877)
9.17. Finanzielle Unterstützung während des Studiums in Freiburg (1874-1877)
KAPITEL 10 IM PRIESTERSEMINAR ST. PETER (1877-1878)
10.1. Prüfung zur Aufnahme in das Priesterseminar (August 1877)
10.2. Die Einberufung der Kandidaten ins Priesterseminar (4.10.1877)
10.3. Das Priesterseminar St. Peter
10.4. Priesterliche Begleiter im Priesterseminar St. Peter
10.5. Empfang der niederen Weihen (23.10.1877)
10.6. Erzbistumsverweser Lothar von Kübel
10.7. Geistliche Lektüre im Geistlichen Tagebuch
10.8. Persönliche Notizen im Geistlichen Tagebuch bis zur Diakonatsweihe
10.9. Ein neues Unternehmen? – Aufzeichnungen im Geistlichen Tagebuch
10.10. Weihe zum Subdiakon und Diakon
10.10.1. Ärztliche Untersuchung am 6.3.1878
10.10.2. Ausstellung des Tischtitels am 12.3.1878
10.10.3. Ankündigung der Weihen in der Heimatgemeinde Gurtweil (10.3.1878)
10.10.4. Exerzitien vor den Weihen. (11.-15.3.1878)
10.10.5. Die Weihe zum Subdiakon am 15.3.1878
10.10.6. Die Weihe zum Diakon am 16.3.1878.
10.11. Anfrage betreffs Studium an der Propaganda Fide in Rom (21.3.1878)
10.12. Gründungsgedanken im Geistlichen Tagebuch vor der Priesterweihe
10.13. Weitere Einträge im Geistlichen Tagebuch vom 16.3.-17.7.1878
10.14. Kontakte mit dem Missionsbischof Raimondi von Hongkong
10.15. Mögliche Anstellung im Seminar Ste Foy (Bordeaux)
10.16. Seelsorgliche Ausbildung in St. Peter (11.7.1878)
10.17. Verkündigung der Priesterweihe in seiner Heimatpfarrei (14.7.1878)
10.18. Exerzitien vor der Priesterweihe (17.7.-20.7.1878)
10.19. Priesterweihe in St. Peter am 21.7.1878
10.20. Die Anstellung der Neupriester
KAPITEL 11 ZWISCHEN PRIESTERWEIHE UND STUDIUM IN ROM (JULI-OKTOBER 1878)
11.1. Primiz am 25.7.1878 in Döttingen in der Schweiz
11.2. Anmeldung zum Sprachenstudium in Rom
11.3. Beendigung des Kurz’schen Stipendiums (31.7.1878)
11.4. Antrag für das Columban Häußler‘sche Stipendium (1.8.1878)
11.5. Glückwunschschreiben von Franz Xaver Oehry SJ (12.8.1878)
11.6. Bitte um ein Zelebret (11.9.1878)
11.7. Aufzeichnungen im Geistlichen Tagebuch
11.8. Rechtliche Regelungen von Familienangelegenheiten (21.9.1878)
KAPITEL 12 DAS STUDIUM DER ORIENTALISCHEN SPRACHEN IN ROM (1878-1879)
KAPITEL 13 PRIESTERSTUDENT AM CAMPO SANTO TEUTONICO (1878-1879)
13.1. Ankunft im Campo Santo Teutonico (4.10.1878)
13.2. Der Campo Santo Teutonico und Rektor Anton de Waal
13.3. Die Bewohner des Priesterkollegs (1878/79)
13.4. Das Curriculum von Johann Baptist Jordan (26.10.1878)
13.5. Aufnahme in die Erzbruderschaft Santa Maria della Pietà
13.6. Teilnahme an den Sabbatinen
13.7. Besuch der Kirchen Roms (Oktober - November 1878)
13.8. Jordan bei Papst Leo XIII. (2.12.1878)
13.9. Einträge im Geistlichen Tagebuch (Oktober 1878 - Februar 1879)
13.10. Entwurf einer „Societas catholica“ (1878-1879)
13.11. Bedenken gegenüber den neuen Ideen (21.12.1878)
13.12. Teilnahme an der internationalen Journalisten-Audienz (Februar 1879)
13.12.1. Redakteur Werber kommt zur Journalistenaudienz
13.12.2. Werber und Jordan begegnen sich in Rom
13.12.3. Jordan als Vertreter des „Das Schwarze Blatt“ am 24.2.1879
13.12.4. Jordan als Kirchenführer für Redakteur Werber
13.13. Papstaudienz am 2.3.1879
13.14. Wohnungswechsel in die Largo dell‘ Impresa Nr. 2 am 10.4.1879
13.15. Im Sommer 1879 in Fribourg
13.16. Einträge im Geistlichen Tagebuch (25.3.1879-9.1.1880)
KAPITEL 14 QUELLEN UND LITERATURVERZEICHNIS
14.1. Archive
14.2. Literatur
VORWORT
Vorliegende Arbeit will vor allem durch eine Dokumentation der Quellen sowie durch die Darstellung der Hintergründe die ersten 30 Lebensjahre des Ordensgründers Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan (Taufname: Johann Baptist) aufzeigen. Eine klare Gliederung zeigt seinen Lebensweg von der Geburt im südbadischen Gurtweil (bei Waldshut) im Umkreis seiner Heimatgemeinde bis hin zum Weiterstudium als Priester in Rom, dem universalen Zentrum katholischen Glaubens. Besondere Erlebnisse hatten schon früh eine Veränderung des lebhaften Schülers zur Folge. Allerdings galt es zunächst als Bahnarbeiter, Maler und Wandergeselle sowie kurzfristig als Soldat tätig zu sein, bevor Johann Baptist Jordan nach einer Vorbereitung durch Privatunterricht mit 22 Jahren das Gymnasium in Konstanz besuchen konnte. Die schulischen Leistungen werden dabei ebenso genannt wie seine Vorliebe für fremde Sprachen. Nach dem Abitur studierte Jordan in seiner Heimatdiözese Freiburg im Breisgau Theologie in der Zeit des sogenannten Kulturkampfes. Betreffs des Studiums an der Universität wird auf die einzelnen Fächer und seine Professoren eingegangen. Zu dieser Zeit bekam Jordan auf den Katholikentagen in Freiburg und München auch prägende Kontakte zu Vertretern der Mission und Presse. Außerdem begann er mit Aufzeichnungen in seinem Geistlichen Tagebuch, die Einblick geben in die von ihm benutzte geistliche Literatur wie auch seine persönliche Erfahrungen. Nach der Priesterweihe am 21. Juli 1878 in St. Peter im Schwarzwald konnte Jordan das Studium der orientalischen Sprachen in Rom angehen, doch bewegte ihn schon zu dieser Zeit das Verlangen eine Gesellschaft aus Männern und Frauen, Priestern und Laien ins Leben zu rufen, die sich für die Verbreitung des katholischen Glaubens mit allen Mitteln einsetzen. Am 8. Dezember 1881 gründete er die Ordensgemeinschaft der Salvatorianer und am 8. Dezember 1888 jene der Salvatorianerinnen, die beide heute weltweit wirken. Pater Jordan starb während des Weltkrieges am 8. September 1918 in Tafers (Kanton Fribourg, Schweiz). Seine sterblichen Überreste wurden 1956 in das Mutterhaus der Salvatorianer nach Rom überführt. 2011 wurde im Seligsprechungsprozess der heroische Tugendgrad zuerkannt. Am 15. Mai 2021 findet in Rom die Seligsprechung des Ordensgründers Pater Franziskus Maria vom Kreuze statt.
Im Laufe der Zeit ergaben sich durch die vielfältigen Nachforschungen immer mehr Kenntnisse über die Lebenszeit von Pater Jordan. Sie reichen von der Befragung von Zeitzeugen in den 1920er Jahren über die Sammlung von Briefen und Dokumenten im Generalarchiv und anderen Archiven bis hin zu Lebensbeschreibungen in Büchern und zahlreichen Artikeln. In einer umfassenden Gesamtschau wird hier nun versucht, das vorhandene Schriftgut zu ordnen und zu dokumentieren. Auf Personen, die mit P. Jordan in Beziehung standen, wird näher eingegangen. Durch eigene Nachforschungen konnte etliches vervollständigt werden. Besonders danke ich Herrn Johan Moris für seine aufmerksame Durchsicht und so manche Ergänzung. Und allen, die zur Veröffentlichung beigetragen haben.
Die Lebensgeschichte von Pater Jordan - wobei es sich hier nur um die Jahre zwischen 1848 und 1879 handelt - kann aufzeigen, wie sehr ein Mensch geprägt wird von seiner Umgebung und Zeit. Sie zeigt aber auch, wie sehr der junge Johann Baptist Jordan seinen persönlichen Weg ging, ausgerichtet auf Gott und das Verlangen, dass alle Menschen Jesus Christus erkennen.
Josef Brauchle
KAPITEL 1GEBURT UND TAUFE VON JOHANN BAPTIST JORDAN
Am 16. Juni 1848 erblickte Johann Baptist Jordan in Gurtweil bei Waldshut (Baden) das Licht der Welt und wurde tags darauf in der nahen Pfarrkirche getauft. In dem Taufbuch1 der Pfarrei ist festgehalten: „Im Jahre eintausend achthundert achtundvierzig am sechzehnten Juny Morgens acht Uhr wurde dahier geboren und am siebenzehnten Morgens sieben Uhr durch den Unterzeichneten in der Kirche getauft Johannes Baptista ehlich-geborene Sohn des hiesigen Bürgers Laurentius Jordan und der Nothburga Peter von Bühl. Zeugen sind die Pathen Anton Jordan ledig & Theresia Jehle ledig nebst Josef Müller Sigrist sämtlich von hier.
Gurtweil am 17ten Juny 1848. Clar, Pfrvrsr. [= Pfarrverweser2]"
Weitere Eintragungen wie der Termin der Firmung oder der Empfang der Weihen wurden im Taufbuch nicht gemacht.
Aus der Kindheit von Johann Baptist ist noch der Impfschein3 erhalten, der am 9.10.1849 in Waldshut ausgestellt wurde. Demnach hatte der Arzt namens Faller am 25.9.1849 die Impfung vorgenommen. Vermutlich handelte es sich um eine Pockenschutzimpfung, die im 1. Jahr nach der Geburt und im 9. Jahr gesetzlich vorgeschrieben war. Das Dokument war bei Schuleintritt, Musterung und anderen wichtigen Begebenheiten vorzuzeigen. Der Erhalt des Dokumentes aus dem Nachlass des Gründers ist wohl so zu erklären.
1 Geburts- und Taufbuch der Pfarrei Gurtweil (1810-1882), S. 169, Nr. 5. Kopie: AGS.0100.01/F42.3; Documenta et Studia Salvatoriana (= DSS) XII, Rom 1986, Nr. 4, S. 5.
2 Pfarrverweser Fridolin Clar: geboren am 20.1.1812 in Wyhl am Kaiserstuhl, gestorben am 24.6.1867 in Breisach. FDA 17 (1885) 73.
3 Impfschein vom 25.9.1849. AGS.0100.01/C5. (= DSS XII, Nr. 5, S. 6).
KAPITEL 3DAS HEIMATDORF GURTWEIL
3.1. Die geographische Lage
Geographisch gesehen liegt das Dorf Gurtweil40 ganz im Süden von Deutschland, nahe an der Grenze zur Schweiz, an den Ausläufern des Schwarzwaldes zum Rhein hin. Im Westen und Südwesten trennen bewaldete Hügel das Dorf von Waldshut. Tiengen, das ebenso wie Waldshut ein größeres Städtchen ist, liegt im Osten. Gegen Norden steigt das Gelände stark an.
Die „Schlücht", ein meist ruhig dahin fließendes, doch zuweilen auch alles mitreißendes Flüsschen aus dem Schwarzwald, hat sich im Lauf der Jahrtausende eine tiefe „Schlucht" durch das harte Gestein gegraben und brachte mit seinen Überschwemmungen in früheren Zeiten so manche Gefahr für das Dorf Gurtweil und seine Bewohner. Nach etwa 3 Kilometer ergießt sie sich, mit der weiter ostwärts aus dem Schwarzwald kommenden „Wutach" in den Rhein. Aus der Schweiz schließlich fließt vom Süden her die „Aare" bei Waldshut in den Rhein, der nach dem Ausfluss aus dem Bodensee und dem Rheinfall von Schaffhausen bis nach Basel als „Hochrhein" bezeichnet wird.
Landschaftlich liegt Gurtweil an der Grenze zwischen dem östlich gelegenen Klettgau, der heute noch deutsches und schweizerisches Gebiet umfasst, und dem nordwestlich gelegenen Albgau, dem früheren Alpengau.41
3.2. Zur Geschichte des Dorfes
Funde aus der Steinzeit deuten auf eine frühe Besiedelung hin. Aus der Römerzeit wurden Fundamente mehrerer Häuser wie auch einer Badeanlage mit fünf Räumen entdeckt. Bruchstücke von Leistenziegeln mit Stempeln der römischen XI. und XXI. Legion deuten auf deren Lager hin.42
Im 3. Jahrhundert nach Christus schoben sich die Alemannen vom Stamm der Sueben (Schwaben) in harten Kämpfen an den Hochrhein und ins Bodenseegebiet vor. Im 6. Jahrhundert übernahmen die Franken die Herrschaft, welche nach 713 unter dem Hausmeier Pippin fränkische Kolonien an den wichtigsten Stellen anlegten. Diese Orte tragen meist die Bezeichnung „heim" oder „wihl", „weil", so auch „Gurtweil". „Curtvilla" ist zusammengesetzt aus: Curtis und Villa. Curtis ist ein großes Hofgut nach merowingisch-fränkischer Bezeichnung. Villa oder Villare ist ein kleiner Weiler. Gurtweil ist also eine fränkische Hofsiedlung, die wohl im 6. Jahrhundert entstanden ist. Urkundlich genannt wird Gurtweil („Gurtwila in Alpegowe") allerdings erstmals 873 im Kartular des Klosters Rheinau.
Um 900 fiel Gurtweil als Schenkung des Grafen Ulrich an das Kloster St. Gallen. Im 11. Jahrhundert gelangte Gurtweil in die Hände weltlicher Herren. Die Ritterschaft von Gurtweil wechselte mehrfach ihren Besitzer. 1646 erwarb das Kloster St. Blasien durch Kauf die Herrschaft des Ritters Martin von Heidegg und errichtete in Gurtweil eine Obervogtei und ab 1697 eine Propstei. Der Abtei St. Blasien verdankt Gurtweil denn auch sein „Schloss" (Propstei), das schließlich bei der Säkularisation 1807 an das Großherzogtum Baden überging.
Nach dem Verkauf an Privatpersonen konnte die junge Kongregation der Schwestern vom Kostbaren Blut 1857 das Kloster erwerben, wurde aber schon 1873 wegen des „Kulturkampfes" vertrieben. Im Jahre 1897 wurde das Schloss durch Franziskanerinnen von Gengenbach als Erziehungsheim für Mädchen neu eröffnet. 1972 erstand eine Heimschule für Behinderte, und seit 1980 dienen die Baulichkeiten dem Caritasverband der Erzdiözese Freiburg als Wohnheim und Werkstätte für Behinderte.43
3.3. Die Pfarrkirche
Die Anfänge des Christentums am Hochrhein gehen bis in die Römerzeit zurück. Mit der thebäischen Legion kam auch die hl. Verena, die um das Jahr 350 im nahen Zurzach in der Schweiz gestorben war und dort verehrt wird. Nicht sehr weit entfernt ist Säckingen, wo der hl. Fridolin (gestorben um 540) als Glaubensbote aus Irland wirkte. Bereits um 560 wurde Konstanz Bistum und blieb es bis 1821, als dann bei der Neuordnung das Gebiet zur neuerrichteten Erzdiözese Freiburg im Breisgau kam. Prägend war für lange Zeit der Einfluss der Mönche von der Insel Reichenau und St. Gallen.
Bis zum Jahre 1612 war Gurtweil noch keine eigene Pfarrei und gehörte zum „Kirchspiel" Thiengen, wo einst der hl. Bernhard von Clairvaux am 8./9. Dezember 1146 den Kreuzzug gepredigt hatte. Eine dem hl. Nikolaus geweihte Kapelle stand vermutlich in der Nähe der Schlüchtbrücke. Am 11. November 1608 wurde die neuerbaute Kirche zu Ehren des hl. Bischofs Konrad, Patron der Diözese Konstanz und zugleich Namenspatron des Stifters Konrad von Heidegg, geweiht.
Als die Kirche erneut zu klein wurde und sich als baufällig erwies, entschloss sich das Benediktinerkloster St. Blasien unter Abt Franz II. (1727-1747) und dem Probst P. Stanislaus Wülberz zu einem Neubau an der gleichen Stelle. 1740 begann man mit dem Abtragen der alten Kirche und dem Bau des jetzigen Gotteshauses, das am 6.9.1747 die Weihe erhielt. Damals wurde auch das Kirchenpatrozinium geändert: Die hl. Apostel Judas Thaddäus und Simon, dargestellt auf dem Altarbild des Hauptaltares, werden die neuen Patrone der Kirche, während der hl. Konrad als Ortspatron beibehalten wurde. Der Taufstein aus der früheren Kirche von 1609 wurde in der neu erbauten Kirche aufgestellt. Die prächtige Stuckdekoration im Stil des Rokoko zeigt in der Mitte der Decke die Aufnahme Mariens in den Himmel. Mit einem Relief des P. Franziskus Maria vom Kreuze Jordan, Gründer der Ordensgemeinschaft der Salvatorianer, wird das Andenken an einen großen Sohn der Gemeinde in Ehren gehalten.44
3.4. Die Einwohnerschaft von Gurtweil
Als im Jahre 1766 Fürstabt Martin Gerbert vom Benediktinerkloster St. Blasien im Herrschaftsgebiet des Klosters die Feuerversicherung einführte, wurde auch für Gurtweil ein Häuserverzeichnis angelegt. Demnach besaß die Gemeinde mit 373 Einwohnern 36 Wohnhäuser (ohne Propsteigebäude und Amtshaus). Nach dieser Aufstellung waren im Dorf nur 12 Häuser mit 2 Stockwerken und 4 Steinbauten. Die anderen waren Holzbauten und hatten wahrscheinlich meist Strohdächer.45
Die einzige Zählung während der Lebenszeit von P. Jordan stammt aus dem Jahre 1860, als Johann Baptist als Zwölfjähriger zur Schule ging. Damals gab es 460 Einwohner, von denen 97 % der katholischen Kirche angehörten. An Eheschliessungen verzeichnen die Kirchenbücher jährlich 2-7, nur im Jahre 1868 waren es 11. Die geburtenreichsten Jahrgänge zählen etwas über 20 Geburten. Die Kindersterblichkeit war in früheren Jahren recht hoch.
Überwiegend beschäftigt waren die Einwohner des Dorfes Gurtweil zur Zeit Jordans mit der Landwirtschaft. Dazu gehörte neben der Haltung der Tiere auch der Anbau von Getreide und Wein (Weinanbau von ca. 10 Hektar). Von der Stellung her waren die Mehrzahl der Bewohner Tagelöhner und Dienstboten (Tuner). Unter die Handwerker gehören die Küfer, Schmiede, Uhrmacher und Schuhmacher. Mit Wasserradantrieb betrieben wurden eine Mahl- und Sägemühle. Eine Klopfsäge oder Stampfe stand am Mühlkanal gegenüber dem Geburtshaus von P. Jordan. Anton Jordan (1821-1897) soll der letzte Säger gewesen sein.
Seit 1572 gab es für Gurtweil eine eigene Dorfordnung, die bestimmte Ämter und Aufgaben vorsah wie einen Vogt (Bürgermeister), Ratsschreiber, Geschworene (Gemeindeordner), Märker und Zoller (zuständig für die Grenzziehung und den Brückenzoll), Umgelter (Steuereinnehmer), Trottmeister (Verwaltung der Weinpresse), Jäger und Forstbeamte, Nachtwächter und Gemeindehirt. Das Weide- und Wasserrecht war genau festgelegt.46 Erhalten sind noch sog. Leselisten, d.h. Aufzeichnungen, nach denen arme, wenig begüterte Personen in den Wäldern Brennmaterial holen konnten.
Andere Familien suchten ihr Glück in der Fremde. So kamen im 18. Jahrhundert einige Familien aus Gurtweil in den Banat in Südosteuropa, um sich dort eine sichere Existenz aufzubauen. Östlich von Arad, bei Gutenbrunn, soll um 1736 ein Ort „Gurtwil“ gegründet worden sein. Doch sei die Niederlassung durch Krieg und Pest wieder eingegangen. Lediglich ein Flurname zu Gutenbrunn trägt noch den Namen Gurtweil.47 Im 19. Jahrhundert wanderten Familien und Einzelpersonen vor allem nach Nordamerika aus, so auch Verwandte des Johann Baptist Jordan.
3.5. Das Geburtshaus von P. Jordan
Der Großvater von Johann Baptist Jordan, Franz Jordan, hatte im Jahre 1842 in finanzieller Not sein geräumiges Wohnhaus Nr. 21 mit Scheuer und Stallung verkauft und dafür das kleinere „Wohnhaus mit Scheune und Stallung bei der Säge Nr. 20“ erworben.
Bei der Übergabe an den „ledigen großjährigen Sohn Lorenz Jordan“ im Jahre 1848 wurde auch für die ledigen Geschwister des Lorenz Jordan geregelt „das ungehinderte Aufenthaltsrecht in dem gedachten Haus und zur Schlafstätte die Kammer ob der Wohnstube, schreibe ob der Stubenkammer für die Mädchen, für den Sohn Anton aber die an solche anstoßende Kammer … auf eine unentgeldliche Weise und auf die Dauer ihres ledigen Standes“ zu gewähren. Die Eltern des Lorenz Jordan behielten sich „zur ausschließlichen unbeschränkten Wohnung und Schlafstätte die untere linke Stubenkammer“48 vor.
Im Kaufvertrag vom 26.9.1878, in welchem Martin Jordan von seiner Mutter, „Wittwe Lorenz Jordan Nothburga, geb. Peter“ die Liegenschaften übernahm, heißt es: „Ein einstöckiges Wohnhaus Nr. 45a. mit Scheuer und Stallung, nebst einem Nebengebäude Holzremieße von Stein gebaut und mit Ziegel gedeckt nebst Hausplatz neben Fridolin Strittmatter und Anton Keller.“49 Noch vor seiner Heirat am 21.7.1879 hatte Martin Jordan es gewagt, das „strohgedeckte“ Holzhäuschen zu erneuern. „Sehr bald nach seiner Heirat baute Martin das Häuschen zweistöckig aus. Eine Außentreppe führte zur oberen Wohnung, so dass diese vollständig von der unteren getrennt war.“50 In der Darlehenszusage der Bank Leu vom 15.4.1881 wurde das Haus beschrieben als „zweistöckiges Wohnhaus mit Scheuer und Stallung unter einem Dach, nebst einem besonders stehenden Nebengebäude, Wagen- und Holzremieße, von Stein gebaut und mit Ziegeln gedeckt.“51
Am 16.3.1894 verkaufte Martin das Haus an die Witwe Maria Josepha Griesser, geb. Hilpert. Bereits ein Jahr später erwarb es am 28.4.1895 Leo Müller (1868-1954), dessen Tochter Frau Rosa Menden bis zu ihrem Tod im Haus lebte.
In ihren Erinnerungen „aus der Jugendzeit des seligen Paters Johannes Baptist Jordan, von Gurtweil“ vom 27.12.1924 hält die Witwe Regina Schlosser-Vonderach fest: „Seine Eltern waren äußerst arme Bauersleute und lebten in einem kleinen, armseligen Strohhäuschen.“52
Ihre Tochter Frida Schlosser erzählte am 3.1.1926: „Das Geburtshaus ist unten oberhalb der Mühle; es ist ein ärmliches Häuschen. Drei Häuschen sind ineinander und nebeneinander gebaut. Über der Straße war die alte Klopfsäge.“53 Edwein kommentiert: „Drei Häuschen“ will heißen „einstöckiges Wohnhaus mit Scheune und Stall“54, wie es im Kaufbuch Gurtweil jeweils beschrieben ist.
In einem weiteren Brief von Frau Frida Schlosser vom 9.1.1927 heißt es: „Über H. H. Pater Jordans Geburtshaus habe ich sicheren Bescheid erhalten können und zwar von einer älteren Frauensperson, die früher eine Nachbarin von H. H. P. Jordan war. Diese sagte mir, dass das Haus nicht so war, wie es jetzt ist, sondern es war da nur eine armselige Wohnung zu ebener Erde, mit einem Strohdach bis fast auf den Boden, u. keine Mauern, u. kein Kamin oder Schornstein, nur ein schwarzes, verräuchertes Holzhaus sei’s gewesen. H. H. P. J. und seine beiden Brüder hatten eine äußerst armselige Dachkammer ohne wirkliches Fenster und die untere kleine arme Wohnung mussten sie noch teilen mit 2 ledigen Schwestern von seinem Vater.“55
Das Jordanhäuschen wechselte öfters seine Hausnummer, da immer wieder die Häuser neu durchnummeriert wurden, entsprechend dem Anwachsen des Dorfes. 1844 trug es die Nr. 20, vor 1869 die Nr. 50, 1869 die Nr. 45, um 1900 die Nr. 57. Heute ist das Geburtshaus von P. Jordan als Haus Nr. 4 der Franz-JordanStraße gekennzeichnet.56
Fotos im Buch von P. Pankratius Pfeiffer „P. Jordan und seine Gründungen“57 zeigen Aufnahmen von Gurtweil und das Geburtshaus von P. Jordan vor der Renovierung. P. Markward Probst SDS (1901-1978) hat später unter anderem Bilder von Gurtweil, der Kirche, dem Geburtshaus, Wohnstube und Geburtszimmer von P. Jordan gemalt, die zum Teil in der Schrift des Gurtweilers Pfarrer Leo Beringer, P. Franziskus Maria vom Kreuze Jordan, erschienen 1950, veröffentlicht sind.58
40 Ortschaftsverwaltung Gurtweil (Hg.), Dorfchronik Gurtweil. Gurtweil. Zur Geschichte des Dorfes im Wandel der Zeit. Gurtweil 2003; Kiebele Anton, Das Dorf Gurtweil als Geburtsort des Gründers, in: Forum SDS 1989/2, S. 247-255; Sutter Konrad u. Lilly, Gurtweil (Schnell, Kunstführer Nr. 1564). München 1985; Beringer Leo, Geschichte des Dorfes Gurtweil. Gurtweil 1960; Die Chronik des Kreises Waldshut. Das Haus und Heimatbuch des Kreises Waldshut. Waldshut/Baden 1957.
41 Edwein in DSS XIII-I, S. 5-6 und DSS XIII-II, S. 27.
42 Beringer, Geschichte des Dorfes Gurtweil, S. 15-21.
43 Beringer, Geschichte des Dorfes Gurtweil, S. 22-63; Kiebele, Das Dorf Gurtweil, S. 247-253.
44 Beringer, Geschichte des Dorfes Gurtweil, S. 151-182; Kiebele, Das Dorf Gurtweil, S. 250-251.
45 Beringer, Geschichte des Dorfes Gurtweil, S. 243-245 (Anhang).
46 Kiebele, Das Dorf Gurtweil. S. 249-250.
47 Beringer, Geschichte des Dorfes Gurtweil, S. 142-143.
48 Übergabevertrag vom „28. May 1848 zu Thiengen“ im Archiv des Amtsgerichtes Waldshut sowie „Vermögensübergabe“ im GAG, Kaufbuch Bd. 3, Nr. 97, S. 299 sowie „Auszug aus der Vermögensübergabe“, Amtsrevisorat Waldshut; zitiert nach Edwein in DSS XIII,II, S. 19-20, 29.
49 Auszug aus dem Kaufvertrag. Archiv der Gemeinde Gurtweil. Grundbuch Band 7, S. 133-140, Nr. 28. Kopie: AGS.0100.01/F49.35 (= DSS XII, Nr. 28).
50 Edwein in DSS XIII-I, S. 19.
51 Pfandbuch Bd. 7, Nr. 7, 15.4.1881; Edwein in DSS XIII-II, S. 43-44
52 Regina Schlosser-Vonderach, 27.12.1924. AGS.0100.01/J23A.
53 Frida Schlosser, 3.1.1926. AGS.0100.01/G18.1.169.
54 zitiert nach Edwein in DSS XIII-I, S. 39.
55 Frida Schlosser, 9.1.1927. AGS.0100.01/J51.
56 Edwein in DSS XIII-II, S. 48.
57 Pfeiffer, P. Jordan, S. 7-12.
58 Beringer Leo, P. Franziskus Maria vom Kreuze Jordan. 1950. Bilder S. 7, 13, 19, 24, 29 u. 33.
KAPITEL 5ARBEITSJAHRE UND MILITÄRZEIT
5.1. Arbeiter am Bau der Bahnlinie Waldshut – Konstanz (1862-1864)
Nach dem Abschluss der Volksschule an Ostern 1862 bot sich Johann Baptist die günstige Gelegenheit beim Bau der Bahnlinie Waldshut-Konstanz (88,73 km) etwas Geld zu verdienen. In einer Zeit, in der es noch kaum Maschinen gab und vieles von Hand getan werden musste, bedeutete es wohl schwere und anstrengende Arbeit, eine Brücke über die Schlücht zu bauen, den Weg der Bahnlinie einzuebnen und die Dämme aufzuschütten. „Die Gurtweiler beteiligten sich an den großen Erdbewegungen, welche der Bahnbau durch Schaffung von Einschnitten und Dämmen erforderlich machte. Auch der jugendliche Johann Bapt. Jordan, der spätere Ordensstifter, arbeitete am Bau. Vor allem musste die Schlücht eingedämmt und die Schlüchtbrücke für die Bahn gebaut werden, was im Jahre 1862 mit einem Aufwand von 30000 Gulden erfolgte.“84
Am 8. November 1862 wurde die Schlüchtbrücke das erste Mal probeweise befahren. Am 19. Dezember 1862 erfolgte die erste technische Probefahrt von Waldshut nach Konstanz. Ab 15. Juni 1863 galt der erste Fahrplan für die Strecke Waldshut-Konstanz, am 15. Juli 1863 war die „Großherzogliche Eröffnung.“85
Auch nach der Eröffnung der Bahnstrecke gingen die Arbeiten weiter, vor allem am Ausbau der Dämme und der Regulierung des Flusses Schlücht. Eduard Jordan erinnert sich: „Faschinat an der Schlücht. Wegen des Bahnbaues wurde es notwendig, da sonst zwei Brücken hätten gebaut werden müssen.“86
Erwähnt wurde von Eduard Jordan auch, dass Johann Baptist gerne malte: „Nach dem Feierabend setzte er sich zum Zeichnen und Malen hin und zeigte darin auffälliges Geschick.“87 „Beim Bahnbau malte er für die Baracke einen schönen Schild: ‚Gasthaus zum alten Schlappen, wer kein Geld hat, kann umsonst hereintappen’“88
Doch fiel in diese Zeit nach längerer Krankheit auch der Tod des Vaters am 19.5.1863. „Tief erschütterte ihn der Tod des Vaters, sodass er nachher wie umgewandelt war“89, bezeugte Johann Müller. Hier wird die veränderte Lebensweise des Johann Baptist Jordan mit dem Tod seines Vaters in Verbindung gebracht, wie es Jordan selbst in den Mitteilungen, die P. Pfeiffer notiert hatte, getan hat. „1. Kom - m[union] gut / Vater tot / Umgewandelt / An verborgenen Orten beten.“90 Zu letzterem passt auch die Aussage von Regina Schlosser: „Im Wald oben baute er sich einmal eine Bretterhütte.“91
5.2. Als Malerlehrling in Waldshut (1864-1866)
Nach 2 1/2 Jahren harter Tätigkeit beim Bahnbau trat Johann Baptist Jordan im Oktober 1864 eine Lehrstelle als Maler bei Meister Jakob Hildenbrand im etwa fünf km entfernten Waldshut an. Bereits am 28.4.1864 hatte dieser in der Zeitung „Alb-Bote“92 ein Inserat mit dem Titel „Lehrlings-Gesuch“ aufgegeben: „Ein ordentlicher Knabe, welcher die Malerei gründlich erlernen will, kann unter annehmbaren Bedingungen in die Lehre treten. Wo? sagt die Redaktion dieses Blattes.“93 Druck und Verlag der Zeitung lag zu dieser Zeit bei H. Zimmermann in Waldshut unter dessen Verantwortlichkeit. Es ist durchaus möglich, dass Jordan auf dieses Inserat hin sich bei Malermeister Hildenbrand gemeldet hat.
Am 11.10.1864 ersuchte der Gemeinderat von Gurtweil beim Bezirksamt Waldshut um Ausstellung eines Passbuches für 4 Jahre: „Baptist Jordan, ledig, von Gurtweil, geboren am 16ten Juny 1848, hat zum Zwecke des Eintritts in die Lehre als Mahler in Waldshut um Ausstellung eines Paßbuches nachgesucht.“94 Die Ausstellung am 19.10.1864 beschränkte sich dann allerdings „auf drei Jahre“, vermutlich wegen der Pflicht zur Musterung.
Über Malermeister Jakob Hildenbrand (1825-1888), den Großvater des Malerprofessor Adolf Hildenbrand (1881-1944), schreibt Otto Leible: Jakob Hildenbrand „verehelichte sich am 19.2.185795 mit Adelheid Eckert von Rohr. Er inserierte in der Folge öfters im ‚Alb-Bote‘ und empfiehlt sich als Maler und Vergolder, bei dem auch Goldleisten96, Tapeten, Ölfarben und Firnisse zu haben seien. Im Jahre 1861 eröffnete er auch eine photographische Werkstätte. 1864 machte er sodann in St. Blasien Reklame für diesen Geschäftszweig. Er hatte damals sein Atelier ‚nächst dem oberen Tor‘. … Das Familienwappen ist ‚in goldenem Schild auf grünem Dreiberg ein schwarzer brennender Ast oder Feuerbrand mit 4 roten Flammen‘ und hält als Daten fest „Hans Hiltbrant, Basel, um 1480; Hildenbrand, Waldshut, um 1780.“97
In seinen Erinnerungsnotizen, die der Neupriester P. Pankratius Pfeiffer 1896 nach einem Gespräch mit P. Jordan machte, hatte er als Stichworte festgehalten: „Photographie Maler.“98 Vielleicht hatte P. Jordan damals auch erzählt, dass sein Lehrmeister Hildenbrand ihn nicht nur als Maler ausbildete, sondern bereits eine photographische Werkstätte hatte. Mit größter Wahrscheinlichkeit dürfte das Foto99, das uns Jordan als Wandergeselle zeigt, im Foto-Studio von Hildenbrand entstanden sein. Am 6.12.1864 hatte „J. Hildenbrand, Photograph“ im Waldshuter „Alb-Bote“100 eine „Photographische Anzeige“ aufgegeben und dabei auf ein Album mit 24 photographischen Aufnahmen der Stadt Waldshut und Umgebung angekündigt. „Zugleich mache ich alle Jene, welche sich auf Weihnachten photographisch aufzunehmen wünschen, aufmerksam, sich bei Zeiten anzumelden, um ihre gefälligen Aufträge vollkommen ausführen zu können.“101 In einem Artikel über „Die frühe Fotografie in Waldshut“ wird das Können von Herrn Hildenbrand beurteilt: „Die bis jetzt gefertigten Bilder, welche in ihren Umrissen sehr scharf, hell und sprechend ähnlich sind, zeugen, dass der Künstler Meister seines Faches ist, und wetteifern seine Photographien mit den besten, die wir der Art in größeren Städten zu sehen Gelegenheit hatten.“102
Jordan, der eine gute zeichnerische Veranlagung hatte, erhielt am Ende seiner zweijährigen Lehrzeit als „Maler, Vergolder und Tapezier“ von seinem Lehrmeister ein belobendes Zeugnis auf blauem Papier, versehen mit einem Lacksiegel mit den Initialen „JH“ (Jakob Hildenbrand):
„Zeugniss. Baptist Jordan von Gurtweil hat heute seine Lehrzeit als Maler, Vergolder und Tapezier vollendet und sich durch Treue, Fleiß und sittliches Betragen meine Zufriedenheit derart erworben, daß ich nicht umhin kann, denselben meinen Herrn Collegen aufs Beste zu empfehlen. Waldshut, 2. Sept. 1866. Hildenbrand, Maler.“103
Jordans jüngerer Bruder Eduard erinnerte sich: „Mit 16 Jahren kam er zu Jakob Hildenbrand in Waldshut zur Flachmalerei in die Lehre. Hier besuchte er auch die Gewerbeschule. – Das Malerhandwerk lernte er in Waldshut bei Herrn Hilde[n]brand; täglich ging er abends heim und morgens früh zur Arbeit. Sein Meister war sehr zufrieden.“104
Frau Schlosser-Vonderach schrieb: „Er trat dann in die Lehre bei Malermeister Hilde[n]brand in Waldshut u. war beim Meister sehr beliebt u. den Gedanken u. den Herzenswunsch, Priester zu werden, gab er nicht auf und nahm dort schon Stunden beim Herrn Pfarrer Hansjakob. Er suchte auch bei jeder Gelegenheit Geld zu verdienen, um sich wieder ein Buch kaufen zu können. Gegen sich selbst war er sehr streng, in einem Wirtshaus oder bei einer Lustbarkeit sah man ihn nie, jede freie Zeit verwendete er zum Lernen.“105
5.3. Jordan und der Volksschriftsteller Pfarrer Heinrich Hansjakob
Dass Pfarrer Hansjakob Johann Baptist Jordan allerdings Privatstunden gegeben hat, ist nicht anderweitig bestätigt und sehr unwahrscheinlich.106





























