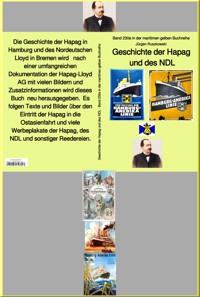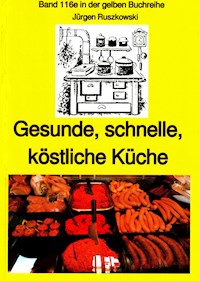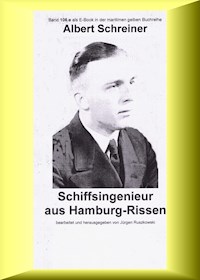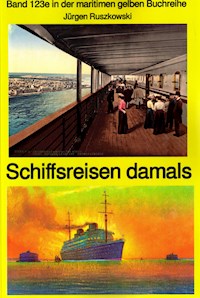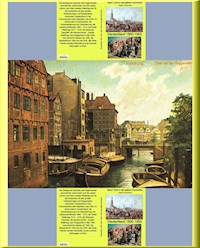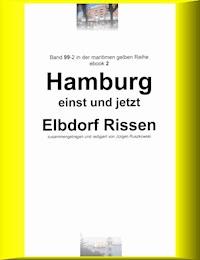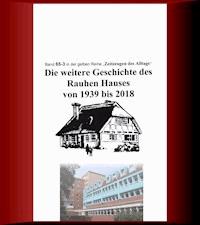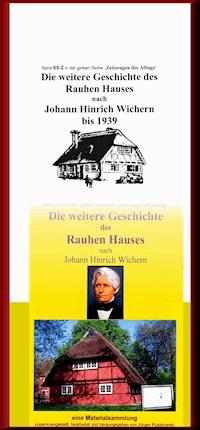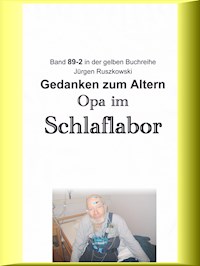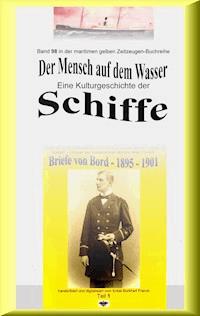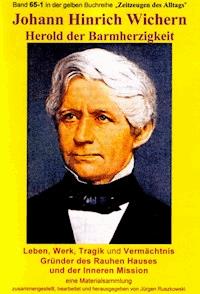
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: gelbe Reihe bei Jürgen Ruszkowski
- Sprache: Deutsch
Seit 180 Jahren gibt es das Rauhe Haus in Hamburg-Horn. Es wurde 1833 von Wichern in einer Zeit großer Umbrüche in Folge der industriellen Revolution für Straßenkinder gegründet, die in Hamburgs Gängevierteln und Elendsquartieren mehr vegetierten als lebten. Aus einem tiefen christlichen Glauben heraus wurde Wichern zum Mann der Tat, der nicht zusehen konnte, wie seine Mitmenschen litten. Einer erstarrten Kirche machte er klar, dass Christsein Verantwortung für die Ärmsten der Armen fordert. Aus der Inneren Mission, die er ins Leben rief, wurde das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche. Wicherns Gedanken und Forderungen wirkten bis in unsere Zeit hinein, etwa in der Reformpädagogik, im Jugendstrafrecht oder in der Seemannsmission. Der Beruf des Diakons wurde unter Wicherns Einfluss neu geschaffen. Dieses Buch erinnert an Wicherns Vermächtnis und soll uns Ansporn für heute sein. - Band 65-2 zur weiteren Geschichte des Rauhen Hauses folgt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Ruszkowski
Johann Hinrich Wichern - Herold der Barmherzigkeit
Leben, Werk, Tragik und Vermächtnis - und die Geschichte des Rauhen Hauses
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Herausgebers
Historischer Kontext
Chronik des Rauhen Hauses und Daten aus Wicherns Leben
Urgrund der Diakonie
Wicherns Zeit
Wicherns Leben und Werk
Der junge Wichern
Begegnung mit Pastor Rautenberg
Johann Gerhard Oncken
Wicherns Theologiestudium
Oberlehrer an der Sonntagsschule in St. Georg – Besuchsverein
Zur Gründung eines Rettungshauses
Die Gründung des Rauhen Hauses in Horn bei Hamburg 1833 und seine Anfangsgeschichte
Der Erzieher Wichern in Selbstzeugnissen
Wicherns Glaube und sein Dienst an der Welt
Die Gemeinschaft der Anstaltsfamilie
Der Geist der Anstaltsfamilie
Stärkung des Erziehers durch das Evangelium
Freiheit in Christo
Die Bedeutung des Festes in der Familie
Erziehung zur Arbeit
Das Spiel als Gegenpol der Arbeit
Anleitung und Aufsicht im Sinne des Ora et Labora
Anforderungen an den Erzieher
Aufgabe und Durchführung des Schulunterrichts
Musik, hohes inneres Bildungsgut
Hausandacht und kirchliche Feste
Die Evangelische Unterweisung
Wicherns erste Gehilfen
Verlag und Druckerei
Das Rauhe Haus und seine Gehilfen
Genossen der Barmherzigkeit – Die Brüder des Rauhen Hauses und der Diakonat
Bruder Christoph Friedrich Götzky
Wichern und sein Verhältnis zu Bremen
Wichern und die Auswanderung nach Übersee
Theodor Rhiem
Wicherns Vorstoß von Hamburg vor 1848 und die Ausdehnung seiner Arbeitszweige
Wichern unermüdlich auf Reisen
Wichern und die Angst vor der Revolution unter den Zeitgenossen
Wichern und Marx
Kritik der frühen Sozialdemokratie an der Inneren Mission
Wichern, der Theologe
Das Revolutionsjahr 1848
Kirchentag zu Wittenberg
Wichern auf den Spuren von Baron von Kottwitz
Ein Gespenst geht um in Europa
Wicherns dreifacher Weg zur Lösung der sozialen Frage:
Die Arbeit des Central-Ausschusses für die Innere Mission unter Wicherns Leitung von 1849 an
Dr. Hermann Krummacher
Wicherns Plan einer kirchlichen Diakonie und ihr Schicksal
Wicherns Eintritt in den preußischen Staatsdienst
Wichern und die gescheiterte Gefängnisreform
Die soziale Frage auf den Tagungen des Central-Ausschusses
Johann Hinrich Wichern, Anreger und Leitfigur einer deutschen Seemannsmission
Wicherns Krankheit und Tod
Wicherns Handschrift:
Wicherns Bedeutung
Wicherns Vermächtnis
Caroline Wichern
Die maritime gelbe Buchreihe
Weitere Informationen
Impressum neobooks
Vorwort des Herausgebers
Als ein in den 1950ern in fünf langen Jahren im Rauhen Haus ausgebildeter Diakon, der in vielen Berufsjahren als Sozialarbeiter (Jugendfürsorger) und Geschäftsführer im Dienste der Inneren Mission und als Heimleiter des Seemannsheimes der Hamburger Seemannsmission diente,
habe ich das Erbe Johann Hinrich Wicherns persönlich erfahren und erlebt.
Es gibt bereits etliche Bücher über Wichern und sein Werk. Warum noch eins? Das ergab sich so: Nachdem ich in der von mir herausgegebenen gelben Buchreihe viele Bände mit Zeitzeugenberichten – vor allem von Seeleuten – veröffentlich habe, auch einige Autobiographien von Diakonen des Rauhen Hauses, stellte mir kürzlich mein für Historisches zeitlebens sehr aufgeschlossener Freund und Diakonenkollege Karlheinz Franke dankenswerterweise seine über Jahrzehnte mit großer Sorgfalt gesammelten Zeitungsausschnitte, Dias und Bilder über Wichern und sein Werk zur Verfügung, weil er im begnadeten Alter von 85 Jahren aufräumt, um sein Haus „altlastenfrei“ an seine Tochter vererben zu können. Diese kostbaren Schätze habe ich nun ausgewertet und aus Anlass der 180. Wiederkehr der Gründung des Rauhen Hauses durch Wichern zu dieser Materialsammlung als Buch verarbeitet.
Dabei fand ich auch etliche hervorragende Texte über Wichern von Dr. theol. Reinhard Freese, den ich als Präsident der Deutschen Seemannsmission persönlich erlebt hatte. Zu meinem Erstaunen stellte ich bei meinen Nachforschungen fest, dass dieser profunder Kenner Wicherns und seiner Schriften noch lebt und bereits seinen 100. Geburtstag gefeiert hat. Ihm sei für die Erlaubnis der Zitierung seiner wissenschaftlichen Arbeiten herzlich gedankt.
In dieser Neuauflage ergänze ich die Ausgabe von 2015 um einige Texte und Bilder und teile den Band in zwei Bücher auf.
Mögen diese Bücher mithelfen, Wicherns Werk als Vermächtnis für uns zu begreifen.
Hamburg, 2013 / 2015 / 2018 Jürgen Ruszkowski
Karlheinz Franke, Diakon des Rauhen Hauses
Ohne seine Sammlung von Texten und Bildern gäbe es dieses Buch nicht.
Ruhestands-Arbeitsplatz des Herausgebers
www.maritimbuch.de
Historischer Kontext
Im 19. Jahrhundert führten verschiedene Faktoren zur Verarmung und Verelendung breiter Massen der Bevölkerung.
Noch um 1700 betrug die Lebenserwartung für Neugeborene nicht mehr als 30 Jahre. Viele Kinder starben früh, denn die Ernährung war oft dürftig, die Hygiene miserabel und die medizinische Versorgung schlecht. Etwa um 1750 begann die allgemeine Lebenserwartung in Deutschland zu steigen. Im folgenden Jahrhundert sorgten dann bessere Ernährung und der medizinische Fortschritt für ein immer längeres Leben. Während die Sterblichkeit in Deutschland und in den meisten westeuropäischen Ländern schon im Laufe des 18. Jahrhunderts und dann im 19. Jahrhundert immer schneller zurück ging, blieb die durchschnittliche Zahl der Kinder pro Frau bis etwa 1875 konstant hoch. Ja, die Geburtenrate erhöhte sich zeitweise noch, weil viele Heiratsbeschränkungen fielen.
Infolge der Französischen Revolution und der napoleonischen Kriege sahen sich viele europäischen Herrscher veranlasst, die eingeschränkten Freiheiten ihrer Untertanen zu lockern. Die Stein-Hardenbergschen Reformen in Preußen, vor allem das Oktoberedikt zur Bauernbefreiung, das eines der zentralen Reformgesetze war, wurde etwa nur fünf Tage nach der Ernennung Steins unterzeichnet und beruhte auf einem Entwurf von Theodor von Schön. Mit ihm wurden die Leibeigenschaft und Erbuntertänigkeit aufgehoben sowie die Freiheit der Berufswahl eingeführt.
1816 galt im Süden und Westen Europas und in Nordamerika, aber auch in Deutschland als das ‚Jahr ohne Sommer’ infolge des Ausbruchs des Vulkans Tambora auf der Insel Sumbawa im heutigen Indonesien im Jahre 1815 mit weit reichender Trübung der Atmosphäre durch Vulkanasche. 1817 wurde daraufhin ein Hungerjahr. Auch die Revolution von 1789 in Frankreich war bereits mit die Folge einer durch einen Vulkanausbruch auf Island verursachten Missernten-Hungersnot. Es gab immer wieder Missernten und Hungerzeiten. Auch 1848 herrschte große Hungersnot in Teilen Deutschlands, vor allem Schlesien.
Durch alle diese Ereignisse kam es im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer wahren Explosion der Bevölkerungszahl. Landflucht ließ viele Menschen in die Städte strömen oder gar über den Atlantik nach Amerika auswandern.
Durch die zunehmende Industrialisierung, Technisierung und Automatisierung der Arbeitswelt, die industrielle Revolution, verarmten große Gruppen der Bevölkerung, besonders die der nicht mehr konkurrenzfähigen Handwerker (z. B. die Weber).
Chronik des Rauhen Hauses und Daten aus Wicherns Leben
Die Zeittafel enthüllt die Marksteine eines großen tätigen Lebens. Werden, Planen und Schaffen, gedrängt von prophetischer Schau, reichem Wissen und heiliger Liebe, starkem Glauben sprechen unüberhörbar zum besinnlichen Leser und fordern in unserer Zeit größter Not von allen: weiterzutreiben das Werk Wicherns.
1745 21. Mai: Mit diesem Datum versehen befindet sich eine Karte von Horn in der Hamburger Kommerzbibliothek in die der Grundriss des alten Rauhen Hauses (ohne Namensbezeichnung) bereits eingezeichnet ist.
1785 28. Februar: In einem Kontrakt findet sich zum ersten Mal die Bezeichnung „bey dem sogenannten Rougenhause“.
1808 21. April: Johann Hinrich Wichern geboren.
1814 8. Januar: Flucht aus Hamburg vor den Befreiungskämpfen der Russen gegen Napoleons Besatzungstruppen nach Kuhla bei Stade – Rückkehr im Juni.
1816: Das Rauhe Haus nebst Grundstück wird an den Gärtner Jannack vermietet.
1818 8. März: Wicherns Eintritt in die Gelehrtenschule Johanneum in Hamburg.
1823 14. August: Tod des Vaters.
1826 26. Januar: Wicherns Eintritt als Helfer in die Plunsche Erziehungsanstalt zu Hamburg.
1828 22. Oktober: Wichern studiert an der Universität Göttingen.
1830 31. März: Fortsetzung des Studiums in Berlin bis August 1831.
1832 6. April: Wichern besteht seine theologische Prüfung und wird candidatus rev. ministerii.
1832 24. Juni: Wichern wird Oberlehrer der Sonntagsschule Pastor Rautenbergs in St. Georg und zugleich Mitglied des von Rautenberg gegründeten Besuchsvereins.
1832 8. Oktober: Der Gedanke, eine Kinderanstalt für Hamburg zu gründen, kommt (im Besuchsverein) zum ersten Mal zur Besprechung.
1832 27. Oktober: Syndikus Dr. Sieveking tritt in den Besitz des alten Rauhen Hauses.
1832 13. November: Wichern gewinnt den Syndikus Dr. Sieveking für seinen Plan.
1833 25. Februar: Wicherns Rede im Schneideramtshaus.
1833 27. April: Syndikus Dr. Sieveking bietet Wichern das alte Rauhe Haus in Horn mit 6 Morgen Land an.
1833 19. Juni: Erste Sitzung des Verwaltungsrats. Syndikus Dr. Sieveking wird zu dessen Präses erwählt.
1833 12. September: Versammlung in der Börsenhalle mit Gründung des Rauhen Hauses in Horn.
1833 1. November: Einzug Wichern und seiner Mutter in das Rauhe Haus.
1833 8. November: Aufnahme der ersten drei Knaben.
1834 April: Wichern werden zwei Gehilfen zur Seite gestellt.
1834 20 Juli: Einweihung des Schweizerhauses. Das alte Rauhe Haus wird Mädchenhaus (bis 1842).
1835: Bau des ersten Oekonomiegebäudes.
1835 29. Oktober: Wicherns Hochzeitstag. Einweihung des Mutterhauses „Grüne Tanne“.
1836 11. August: Grundsteinlegung zum ersten „Goldenen Boden“ – Besuch des späteren Fürst von Bismarck im Rauhen Hause.
1836 1. August: Das Rauhe Haus besetzt außerhalb das erste Rettungshaus durch Bruder Baumgartner.
1838: Einrichtung einer dritten Knabenfamilie im „Goldenen Boden“.
1838 6. November: Besuch des Prinzen Christian (später König Christian VIII) und der Prinzessin Caroline Amalie von Dänemark im Rauhen Haus.
1839 1. April: Das Rauhe Haus entsendet den ersten Lehrer, Bruder Feldhusen.
1839 14. Juli: Grundsteinlegung zum Betsaal im Rauhe Haus.
1839 7. Oktober: Einweihung des Betsaals.
1840 19. Juni: Das Rauhe Haus entsendet Bruder Schladermund als ersten Kolonistenprediger nach Amerika.
1841 19. August: Elisabeth Frey im Rauhen Hause.
1841 3. Oktober: Einweihung des ersten Hauses „Bienenkorb“.
1841 20. Dezember: Der Verwaltungsrat erwirbt die Schlottaukoppel.
1842 11. Februar: Gründung der Druckerei und Buchbinderei.
1842 5. Mai: Der Hamburger Brand. Das Rauhe Haus nimmt obdachlose Familie auf.
1844 16. März: Bildung eines Kuratoriums für die Brüderanstalt unter Vorsitz Syndikus Dr. Sievekings.
1844 September: Begründung der „Fliegender Blätter“.
1848 März: Wichern geht mit 10 Brüdern nach Oberschlesien zur Linderung der infolge des Hungertyphus entstandenen Waisennot.
1848 21. September: Erster deutscher evangelischer Kirchentag in der Schlosskirche zu Wittenberg.
1848 22. September: Wicherns Rede auf dem Kirchentag über „Innere Mission als Aufgabe der Kirche.“
1848 23. September: Vorschlag zur Gründung des Centralauschusses.
1849 21. April: Wichern gibt seine Denkschrift über die Innere Mission heraus.
1849 13. – 15. September: Kongress der Inneren Mission in Wittenberg. Wichern über: I. Wie ist die Innere Mission als Gemeindesache zu behandeln?“ II. Welches ist die Aufgabe der Inneren Mission für die wandernde Bevölkerung?“
1850 1. Januar: cand. Theodor Rhiem wird Inspektor des Rauhen Hauses und vertritt Wichern während seiner vielen Reisen.
1850 12. – 14. September: 2. Kongress der Inneren Mission in Stuttgart. Wichern über das Thema: „Wie sind die nötigen Arbeiter für den Dienst der Inneren Mission zu gewinnen?“
1851 3. Juni: Wichern erhält den Doktor theol. von der theologischen Fakultät der Universität Halle.
1851 18. – 19. September: 3. Kongress der Inneren Mission in Elberfeld. Wichern über das Thema: „Die Inneren Mission in ihrer nationalen Bedeutung für Deutschland im Hinblick auf die Reformation.“
1852 16. – 17. September: 4. Kongress der Inneren Mission in Bremen. Wichern über das Thema: „Die Behandlung der Verbrecher in den Gefängnissen und der entlassenen Sträflinge.“
1852 Oktober-November: Wicherns Revisionsreise durch Westpreußen, Ostpreußen und Pommern.
1853 Juni: Wicherns Revisionsreise durch Brandenburg, Schlesien und Sachsen
1853 22. – 23. September: 5. Kongress der Inneren Mission in Berlin. Wichern über das Thema: „Die evangelischen Deutschen in der europäischen Diaspora.“
1854 21.Mai: Eröffnung der ersten Herberge zur Heimat in Bonn; Bruder Heinrich Groth wird Hausvater.
1854 25. – 26. September: 6. Kongress der Inneren Mission in Frankfurt/M. Wichern über das Thema: „Bericht des Centralausschusses für die Innere Mission über deren Tätigkeit, deren Umfang und Prinzipien.“
1856 5. Juli: Der Brüderschaft des Rauhen Hauses wird der Aufseherdienst im Moabiter Gefängnis in Berlin übertragen.
1856 11. – 12. September: 7. Kongress der Inneren Mission in Lübeck. Wichern über das Thema: „Der Dienst der Frauen in der evangelischen Kirche.“
1856 31. Oktober: Entsendung von 19 Brüdern nach Moabit.
1857 14. Januar: Ernennung D. Wicherns zum Oberkonsistorialrat und Vortragenden Rat für die Strafanstalten und das Armenwesen im Ministerium des Innern.
1857 24. – 25. September: 8. Kongress der Inneren Mission in Stuttgart. Wichern über das Thema: „Die Inneren Mission als Aufgabe der Kirche innerhalb der Christenheit.“
1858 25. April: Rede D. Wicherns zur Gründung des Johannesstiftes in Berlin.
1858 18. – 19. September: Erster Brüdertag im Rauhen Hause.
1860 13. – 14. September: 10. Kongress der Inneren Mission in Barmen.
1862 25. – 26. September: 11. Kongress der Inneren Mission in Brandenburg/Havel Wichern über das Thema: „Die Verpflichtung der Kirche zum Kampf gegen die heutigen Widersacher des Glaubens in ihrer Bedeutung für die Selbsterbauung der Gemeinde.“
1863 4. – 8. Oktober: Zweiter Brüdertag im Rauhen Hause.
1864 20. Februar: Begründung der Felddiakonie. D. Wichern zieht mit 12 Brüdern auf den Kriegsschauplatz.
1867: Das Dorf Horn hat 1.700 Einwohner.
Das Dorf Hamm hat 3.400 Einwohner.
1867 5. – 6. September: 13. Kongress der Inneren Mission in Kiel. Wichern über das Thema: „Der Beruf der Nichtgeistlichen für die Arbeit im Reiche Gottes und den Bau der Gemeinde.“
1869 10. – 12. August: Dritter Brüdertag im Rauhen Hause.
1869 2. – 3. September: 14. Kongress der Inneren Mission in Stuttgart. Wichern über das Thema: „Die Aufgabe der evangelischen Kirche, die ihr entfremdenden Angehörigen wiederzugewinnen.“
1871 6. Juni: Th. Rhiem feiert sein 25jähriges Jubiläum.
1871 Anfang Juni: erster Schlaganfall Wicherns.
1871 22. Juli: Wichern wünscht nach seiner schweren Erkrankung vom Sohn Johannes eine Erklärung, ob er willig sei, einst sein Nachfolger in der Leitung des Rauhen Hauses zu werden.
1871 12. Oktober: Wichern auf der Oktober-Versammlung der Inneren Mission: „Die Mitarbeit der evangelischen Kirche an den sozialen Aufgaben der Gegenwart.“
1872 15. Mai: Rückkehr D. Wicherns in das Rauhe Haus und Wiederübernahme der Leitung der Anstalt.
1873 1. April: Eintritt seines Sohnes Johannes Wichern als „stellvertretender Vorsteher“ des Rauhen Hauses.
1876 18. – 21. Juli: Erste Konferenz der Vorsteher der deutschen evangelischen Brüderhäuser im Rauhen Hause.
1881 7. April: Wicherns Todestag.
Urgrund der Diakonie
„Denn wo Glaube ist, da wird aus ihm die Liebe geboren,
wie der Strahl der Sonne, wie die Wärme aus dem Feuer“
Rudolf Willborn schrieb 1981 in ‚Der weite Raum’:
Wer aus der Hamburger Innenstadt mit der Untergrundbahn nach Osten fährt, kommt zu einer Station mit dem Namen „Rauhes Haus“. Der diakonisch Kundige rekapituliert bei diesem Namen: „Brunnenstube der Inneren Mission“, „Rettungshaus für verwahrloste Kinder“, 1833, Wichern. Bei aller gebotenen Zurückhaltung könnte man nicht nur das Strohdachhaus in Hamburg-Horn, sondern die gesamte Heimatstadt Wicherns als Brunnenstube, Quellgrund oder eben ‚Untergrund’ der modernen Diakonie vorstellen. Hanseatisches Selbstbewusstsein und kommerzielle Nüchternheit, weltoffener Unternehmergeist und Sinn für das Machbare verbanden sich in dieser exklusiven Stadtrepublik mit der norddeutschen Variante der Erweckungsfrömmigkeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem beachtlichen Aufbruch christlicher Initiative auf sozialem Gebiet. Er ist gekennzeichnet durch die Namen Johann W. Rautenberg, Amalie Sieveking, Elise Averdieck, Hinrich M. Sengelmann und – J. H. Wichern, den „Vater der Inneren Mission“. Sie alle waren in Denken und Tun unverkennbar bestimmt von dem, was Bischof Wölber als die eigene hamburgische Spielart der Spiritualität beschrieben hat: „Die noblen Hanseaten haben den Geist des Christentums aus anderen Wurzeln als denen der religiösen Erwärmung entfacht. Es war der Hamburger Bürger Johann Hinrich Wichern, ewiger Kandidat der Theologie, der 1848 durch eine zündende Stegreifrede auf dem Wittenberger Kirchentag mit einem Schlage dem christlichen Sozial- und Liebesdienst in moderner Weise zum Durchbruch verhalf. Seine Parole lautet: ‚Die Liebe gehört mir wie der Glaube.’ Dies begriff der Hamburger Bürgersinn.“ Aber Naumanns Charakterisierung erinnert nicht nur an hanseatischen Gemeinsinn, Stiftungen, Legate und Mäzenatentum, sondern auch an jenen ‚Untergrund’, den der junge Wichern meinte, als er in seinen Aufzeichnungen über „Hamburgs wahres und geheimes Volksleben“ seine Beobachtungen von der schreienden Armut in den Arbeiterwohnvierteln der Hansestadt, z. B. dem sogenannten „Gängeviertel“ und der Matrosenvorstadt St. Pauli festhielt. Der Hinweis auf den weltstädtischen Bürgersinn der Hansestädter beleuchtet nur die eine Hälfte des Untergrundes, aus dem das Wirken dieser Pioniere der Diakonie hervorging. Die andere Hälfte der Wahrheit war das Elend der von der bürgerlichen Gesellschaft im Stich gelassenen Proletarier und der verwahrlosten Proletarierkinder in den schnell wachsenden Arbeitervorstädten. Als Oberlehrer der von Kirche und Staat gleichermaßen beargwöhnten und sogar polizeilich kontrollierten Rautenberg’schen Sonntagsschule gewann der 25jährige Wichern aus erster Hand Einblick in die Abgründe einer Elendswelt, wie sie außer in dem großen Seehafen Hamburg in Deutschland so wohl kaum zu finden war – damals ein Mikrokosmos der industriellen Zukunft Deutschlands. Viele Hamburger Bürger erfuhren erst durch die Reden Wicherns vor Hunderten von eingeladenen Zuhörern im großen Tanzsaal des Schneideramtshauses am 25. Februar 1833 und während der Gründungsversammlung des Rauhen Hauses in der Hamburger Börsenhalle am 12. September 1833 etwas von dieser unheimlichen Nachtseite ihrer stolzen und reichen Stadt. Was Wichern gesehen hatte, war die schmutzige Realität dessen, was in den Geschichtslehrbüchern „die soziale Frage“ des 19. Jahrhunderts genannt wird. Es waren Bilder, wie sie uns heute als unbewältigte Gegenwart in Berichten aus Asien, Afrika und Südamerika entgegentreten. Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Hunger, Krankheit und frühe Invalidität, Alkoholismus. Prostitution Minderjähriger, Verwahrlosung und sittliche Verrohung, Auflösung von Ehe und Familie waren die äußeren Kennzeichen der hoffnungslosen, völlig ungesicherten Existenz ständig wachsender Massen von Tagelöhnern, Handwerken und Arbeitern. Wichern wusste aus eigener Kindheitserfahrung, dass mit dem sozialen Elend das seelische Elend einherging. Erst Bewusstsein des Ausgestoßenseins aus der bürgerlichen Gesellschaft macht den Armen zum Proletarier. Wichern war sich auch bewusst, dass die soziale und seelische Not ein Massenproblem war, dem sich die Kirche mit neuen Arbeitsmethoden zu stellen hatte. Den katastrophalen Folgen der industriellen Revolution in den Städten und der Strukturveränderung auf dem Lande war mit individueller karitativer Einzelfallhilfe allein nicht beizukommen. Zur helfenden, erbarmenden, rettenden Liebe musste die gestaltende, vorsorgende Liebe hinzukommen. Das Rauhe Haus als Rettungsanstalt der heimatlosen Kinder und als erste Ausbildungsstätte für Diakone war nur ein kleiner Teil dessen, was die geistliche und leibliche Not des Volkes erforderte. Trotzdem wurde das Rauhe Haus das „einflussreichste soziale Unternehmen im protestantischen Deutschland“ und ein bleibendes Symbol für die Weltverantwortung des christlichen Glaubens.
Wichern war kein Sozialreformer im heutigen Sinn. Trotzdem ist sein Name aus der deutschen Sozialgeschichte und aus der Auseinandersetzung zwischen christlichem Sozialismus und radikalem, klassenkämpferischem Sozialismus nicht wegzudenken. „Es ist der dringende, unabweisbare, heutige Beruf der Kirche, sich des Proletariats in seinem tiefsten Grunde anzunehmen“, schreibt Wichern im August 1848 in einem Artikel über „den Kommunismus und die Hilfe gegen ihn“. Kurze Zeit später rief er den 500 auf dem Kirchentag in Wittenberg Versammelten zu: „Die innere Mission hat es jetzt schlechterdings mit der Politik zu tun.“ In den vorangegangenen Monaten war in fast allen europäischen Hauptstädten und auch in Berlin die Revolution ausgebrochen. Im Februar 1848 war das von Marx und Engels verfasste „Kommunistische Manifest“ herausgekommen mit seinem Kampfruf: „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“
Moderne Kritiker werfen Wichern vor, er habe sich nach 1848 zum willigen Werkzeug der preußischen Restauration gegen die demokratische Revolution machen lassen. Den meisten seiner kirchlichen Zeitgenossen – unter ihnen besonders den norddeutschen Lutheranern – war er dagegen eher zu revolutionär, zu ökumenisch und zu wenig kirchlich. Man betrachtete die Innere Mission als ein „Schlinggewächs an Stamm und Asten des Kirchenbaumes“ und lehnte es ab, die „Arbeiterfrage“ als eine Aufgabe der Kirche zu betrachten. „Die Verhältnisse des Arbeiterstandes zu ändern, steht in keines Menschen Macht“, schrieb 1849 der Hannoveraner Pastor Petri, einer der Hauptkritiker der Inneren Mission Wicherns.
Die soziale Frage des 19. Jahrhunderts ist kein Thema der Vergangenheit. Sie ist heute brisanter denn je, denn sie hat weltweite Ausmaße angenommen und ist zu einer Bedrohung der Menschheit geworden. Ohne soziale Gerechtigkeit kann es keinen Weltfrieden geben. Nationalökonomie und staatliche Lenkung allein können die Probleme auch nicht lösen. Es ist an der Zeit, den Prinzipien ethischer Wertorientierung, dem vom Glauben geschärften Gewissen auch in den Fragen der Weltwirtschaft den ihnen gebührenden Platz einzuräumen. Nicht von ungefähr richten heute Politiker solche Erwartungen an die Adresse der Kirchen. Kirche und Theologie der Gegenwart, nicht nur die Experten der Diakonie, täten gut daran, sich intensiver mit dem geistigen Lebenswerk J. H. Wicherns kritisch auseinanderzusetzen, um die aktuelle Diskussion um den Weltfrieden sachgerechter, d. h. theologischer führen zu können.
Als Wichern am 22. September 1848 auf dem Kirchentag in Wittenberg in der Schlosskirche seine Stegreifrede hielt und zur inneren Mission in Deutschland aufrief, um die Not vieler Menschen zu lindern, die durch die industrielle Revolution verarmt waren und unter Hungersnot durch Missernten litten, hatten bereits um die Jahreswende 1847/48 Karl Marx und Friedrich Engels im Auftrag des Bundes der Kommunisten das „Manifest der Kommunistischen Partei“ verfasst. Wichern rief zur inneren Mission und zur Barmherzigkeit auf, Marx und Engels forderten statt Barmherzigkeit Gerechtigkeit und zu ihrer Verwirklichung den „gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung“. „Mögen die herrschenden Klassen vor der kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen.“ Die Geschichte hat gezeigt, dass das kommunistische Programm am menschlichen Unvermögen scheiterte, weil es unter den Gleichen immer ‚Gleichere’ gab, die in der Diktatur des Proletariats ihre Position für sich persönlich zu nutzen wussten. Auch Wichern verzweifelte letztlich daran, dass sein Entwurf eines Programms der inneren Mission zur Überwindung der sozialen Probleme nicht nach seinen Wünschen durchzusetzen war.
Aus heutiger Sicht war Wichern ein Konservativer. Aus der Sicht seiner sozialistischen Gegenspieler galt er auch damals bereits als konservativ oder gar reaktionär. Aber für die Kirche seiner Zeit und das ‚erweckte’ christliche Bürgertum war er damals ein Herold und seine Ideen und Taten revolutionär. Für die evangelischen Kirchen in Deutschland und anderen Ländern war er der Bahnbrecher diakonischen Denkens und Handelns, und auch in der Reformpädagogik, im Strafvollzug und in Sozialarbeit und Sozialpolitik hat er bis heute bleibende Spuren hinterlassen.
Wicherns Sprache ist uns heute etwas fremd und nicht immer leicht verständlich, seine Schriften, besonders die Handschriften nur schwer zu lesen, aber seine Zeitgenossen hat er damit wachgerüttelt.
Wicherns Zeit
Manfred Schick berichtet 1981 in „Weltweite Hilfe“
(Hessen-Nassau):
Die Französische Revolution, im ausgehenden 18. Jahrhundert als das Fanal der Neuzeit schlechthin aufleuchtend, bringt das vorrevolutionäre Staatensystem Europas unter Napoleons Feldzügen zum Einsturz. Hamburg, die Geburts- und Heimatstadt Wicherns, steht unter französischer Besatzung, als Wichern geboren wird. Der Gedanke der Volkssouveränität und der Verfassung, die den staatlichen Gewalten ihre Aufgaben und Kompetenzen zuweist und sie begrenzt, bestimmt die politische Diskussion des Jahrhunderts. Die Tradition gottverordneter Obrigkeit ist zerbrochen, auch wenn für den Rest des Jahrhunderts nur in Frankreich die Staatsform der Republik besteht. Das Bürgertum, der dritte Stand nach Adel und Geistlichkeit, wird die gesellschaftstragende Schicht des Jahrhunderts.
Dieses Bürgertum wird auch der Initiator einer nicht minder eingreifenden Veränderung. Ein neuer und anderer Geist wirtschaftlichen Denkens und Handelns erwacht.
Hochkomplizierte technische Spielereien und Erfindungen gab es schon lange, aber niemand kam auf den Gedanken, diese Spielereien industriell zu nutzen. Aber über die Hintertreppen alchimistischer Versuche zur Goldherstellung und den Umweg absolutistischer Manufakturen zur Porzellanherstellung als einem unfreiwilligen Nebeneffekt alchimistischer Versuche entsteht ein Fabrikanten- und Fabrikarbeiterstand.
Die Erfindung der Dampfmaschine und der Lokomotive, des mechanischen Webstuhls u. ä. sind Ergebnis und Anreger solcher Entwicklung zugleich. Die industrielle Revolution geht mit der politischen Hand in Hand. Fabriken entstehen. Entwicklungen, die uns heute in der Dritten Welt so unverständlich erscheinen, prägen das Bild der Zeit damals: Die Städte mit ihren entstehenden Slums, ihrer Entwurzelung aus allen bergenden Gemeinschaften, sind ganz offensichtlich für Millionen Menschen immer noch attraktiver als die Unfreiheit der ländlichen Agrargesellschaft mit ihren ausgesprochenen und unausgesprochenen Verboten: z. B. dem Verbot zu heiraten, überhaupt und wen und wann man will, dem Verbot, den Beruf seiner Wahl zu lernen und auszuüben, den Beschränkungen des Eigentums- und Besitzerwerbs usw. Am schlimmsten trifft diese Veränderung den Handwerkerstand; vor allem der kleine, arme, aber sozial integrierte Handwerker ist plötzlich der Konkurrenz industrieller Produktion nicht mehr gewachsen. Dass er Fabrikarbeiter werden muss, ist vielleicht weniger ein wirtschaftlicher Niedergang als ein sozialer Abstieg. Andere des gleichen gesellschaftlichen Standes springen auf den fahrenden Wagen auf; die großen Firmenvermögen des 19. Jahrhunderts, die Krupps, die Thyssens usw. entstehen aus vergleichsweise kleinen Anfängen. Die soziale Frage im Besonderen wird aber erst das Problem des letzten Drittels dieses Jahrhunderts werden.
Parallel dazu entstehen die Nationalstaaten. Deutschland bleibt in diesem Punkt hinter der allgemeinen Entwicklung zurück. Während rundum das Gestaltungsprinzip der neuen staatlichen Ordnung der nationale Gedanke ist, bleibt Deutschland in dynastische Einheiten geteilt, und die Nationwerdung von 1870 - 1871, die Wichern noch erlebt, ist im Grunde auch nur eine Teillösung. Trotzdem mischen sich in die nationalen Töne der Kirche dann sehr schnell nationalistische. Die Kirchen beider Konfessionen sind über diese Entwicklung eher irritiert. Die wissenschaftliche Theologie zieht zwar mit dem modernen Denken mit (Hegel, Schleiermacher, die Entwicklung der wissenschaftlichen Exegese u. s. f.). Gegen den militanten Atheismus, wie er als Unterströmung der französischen Revolution das Jahrhundert durchweht, entsteht eine starke Erweckungsbewegung, die aber nur die zweie oder gar dritte Garnitur der wissenschaftlichen Theologie erfasst. Der Kampf zwischen Altgläubigen und Freisinnigen bestimmt die innerkirchliche Diskussion für den Rest des Jahrhunderts; d. h. dass es kaum zur Diskussion zwischen beiden kommt, lähmt das kirchliche Leben und zieht auch dem Wirken der Inneren Mission unnötige Grenzen, weil die Initiatoren der Inneren Mission in der Mehrheit zur altgläubigen Schar gerechnet werden.
Aber soweit auch die Theologie auf die Strömungen der Zeit eingeht, die kirchliche Organisation bleibt stehen. Die im Zeitalter der Reformation mehr aus Verlegenheit entstandene Koppelung von Thron und Altar im Landesherrlichen Summepiskopat konnte dem neuen Geist im Staatsdenken nicht mehr gerecht werden, wurde aber umso verbissener verteidigt. Erstaunlicherweise hatten die Konservativen für das Unzeitgemäße der kirchlichen Organisation ein besseres Gespür als die Freisinnig-Fortschrittlichen. Dass die Innere Mission sich organisatorisch neben der verfassten Staatskirche konstituierte, ist ein Ergebnis dieser im Wesentlichen erst mit der Revolution von 1918 gelösten Problematik der kircheneigenen Organisation.
Mehr als einige Aspekte dieses bewegten und bewegenden Jahrhunderts, das erst in seinem letzten Drittel, das aber nicht mehr die Zeit Wicherns ist, wieder etwas zur Ruhe kommt, kann ich nicht aufzeigen, aber auf diesem Hintergrund muss man Wicherns Leben sehen.
Wicherns Leben und Werk
Peter Meinhold, * 1907, † 1981, war von 1936 bis 1975 Theologe und Professor für Kirchengeschichte an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Ende der 1950er Jahre forschte er zusammen mit seinem Assistenten Manske (†) im Archiv des Rauhen Hause und veröffentliche 1958 eine mehrbändige Gesamtausgabe aller Schriften Wicherns. Er urteilt über Wichern:
Johann Hinrich Wichern ist bekanntlich der ‚Herold’ der Inneren Mission, d. h. ihr eigentlicher Anreger und Organisator für das kirchliche Handeln in den verschiedensten Bereichen des sozialen Lebens. In seinem umfangreichen Lebenswerk hat er der evangelischen Christenheit zahlreiche neue Antriebe vermittelt und die Motivationen für ein neues Handeln der Kirche niedergelegt. Wichern hat als erster erkannt, dass die Gesellschaft der Neuzeit eine Massengesellschaft ist, in der nur das korporative Handeln der Kirche soziale Auswirkungen hat. Die von ihm ins Leben gerufene ‚Innere Mission’ sollte eine gesellschaftliche Erneuerung in allen Schichten der Bevölkerung herbeiführen und ein korporatives Wirken angesichts der bedrängenden Nöte der Zeit bewirken, damit aber auch zu einer Einlösung des Glaubens durch die Werke der Liebe werden. Schon der junge Wichern hat für die Abhilfe der ihn bedrängenden Nöte der Zeit durch die praktische Tat gesorgt. So ist er durch die Begründung des Rauhen Hauses der äußeren und inneren Verwahrlosung der Jugend entgegentreten. In den Gehilfen des Rauhen Hauses ist dabei eine Brüderschaft herangewachsen, die er in die vielfältigen diakonischen Dienste, wie sie die Zeit erforderte, eingeführt hat. Zu den bleibenden Werken Wicherns gehört die Gefängnisreform, die eine Umstellung des Strafvollzuges von der Massenhaft auf die Einzelhaft gebracht hat. Sie führte auch zu einer Erneuerung des Gefängnispersonals, für das Wichern Kräfte aus der Brüderschaft des Rauhen Hauses und des Evangelischen Johannesstifts in Berlin genommen hat, die in menschlicher und fachlicher Hinsicht auf diesen Dienst vorbereitet waren. Das letzte Ziel der Gefängnisreform war die Resozialisierung der Gefangenen und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Damit verfolgte er das gleiche Ziel wie in der Erziehung und gesellschaftlichen Reintegration der Jugend, für die er im Rauhen Hause das erste Modell der nach dem Familienprinzip aufgebauten Heimerziehung geschaffen hat. So ist Wichern der große Sozialreformer und Sozialpädagoge aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, den die evangelische Kirche hervorgebracht hat. Viele moderne Gedanken über die Erziehung, über Arbeit, Verdienst, Freizeit, Entlohnung, soziale Sicherung und Altersversorgung hat Wichern zuerst gedacht und sie in seinen zahlreichen Schriften begründet und immer weiter ausgebaut.
Peter Meinholds Gesamtausgabe ist ein kirchengeschichtliches Ereignis, weil sie nicht nur Person und Werk Wicherns in einem neuen Lichte sehen lässt, sondern auch deutlich macht, wie wenig die Kirche des 19. Jahrhunderts den geistigen Anregungen Wicherns zu folgen vermochte und wie groß die späteren Generationen hinterlassene Aufgabe ist, dieses Werk mit seinen sozialethischen, aus dem Glauben kommenden Begründungen in ihre Zeit zu übertragen und umzusetzen.
Der junge Wichern
Nachfolgende Formulierungen stammen teilweise von Dr. theol. Reinhard Freese, Manfred Schick, aber auch aus anderen Quellen, etwa von Erich Beyreuther, Dr. Hans Luckey, 1949 von Ruth Färber ausgewählte und zusammengestellte Texte, aus der Verteilschrift ‚Der Rauhhäusler Bote’ 1954 oder Wikipedia.
„Ich bin in Hamburg 1808 den 21. April geboren, von guten und liebevollen Eltern, die mich hegten und pflegten, so lange sie konnten; durch die Taufe ließen mich meine Eltern in Gottes Verzeichnis der Christen (da heißt der mit dem heiligen Geist gesalbten) einschreiben Dafür sei Ihnen Dank hier und dort ewig.“ – so lesen wir es im Tagebuch des 18jährigen Johann Hinrich.
Wicherns Vaer
Wicherns Mutter
Johann Hinrich Wichern wurde also am 21. April 1808 als ältestes von acht Kindern des gleichnamigen Vaters Johann Hinrich Wichern geboren und am 15. Mai 1808 auf dessen Namen getauft.
Wichern stammt aus einer Aufsteigerfamilie. Der Großvater väterlicherseits, Nachkomme armer hannoverscher Leineweber, 1770 in die Stadt gekommen, ist noch ungelernter Arbeiter; der Vater arbeitet sich vom Mietkutscher und Schreiber zum kaiserlichen Notar (dazu bedurfte es damals in Hamburg noch keines akademischen Studiums) und durch eisernes autodidaktisches Sprachen-Studium, er beherrschte schließlich zehn Sprachen, zum vereidigten Übersetzer hoch.
Taufregister von St. Michaelis
Doch die Wirren der Napoleonischen Kriege und die Kontinentalsperre vereiteln einen finanziellen Lebenserfolg. Die Mutter, Caroline Maria Elisabeth geb. Wittstock, eine Hamburgerin, stammte mütterlicherseits aus einem verarmten holländischen Adelsgeschlecht und wird als energisch, praktisch und fromm beschrieben. Sie hatte von Jugend auf schwer arbeiten müssen; noch im hohen Alter hat sie im Rauhen Haus Gemüse geputzt und Kartoffeln geschält.
Wichern besucht eine Privatschule, in der nach der Pädagogik Pestalozzis unterrichtet wird. 1818 wechselt er auf das Johanneum, ein bereits lang bestehendes Gymnasium, das im 16. Jahrhundert von Johannes Bugenhagen, dem Mitstreiter Martin Luthers und Reformator Norddeutschlands, gegründet worden war. Der älteste Sohn, Johann Hinrich, soll studieren. Es ist darum ein furchtbarer Schlag, als der Vater, der sangesfrohe, bildungsbegeisterte, der Romantik zugetane, herzensfromme Vater im Jahre 1823 an Schwindsucht stirbt, als der Sohn 15 Jahre alt ist. Die Tagebucheinträge des jungen Johann Hinrich verraten die tiefe Erschütterung, die noch jahrelang nachklingt. Langsam, aber unaufhaltsam verarmt die achtköpfige Familie. So tapfer Johann Hinrich Wichern für die Mutter und die sechs jüngeren Geschwister durch Privatstunden und Klavierunterricht zum Unterhalt beiträgt, der vorzeitige Abgang von der vorletzten Klasse des berühmten Gymnasiums, des Johanneums, lässt sich nicht vermeiden.
Im Johanneum
Der Sohn verlässt 1823 die Schule kurz vor dem Abschluss, um die Familie mit zu ernähren, und wird Erziehungsgehilfe. Aber der junge Wichern hat schon den zähen Fleiß, der Kennzeichen seines ganzen Lebens ist. Doch in diesem äußeren, bedrängten Rahmen vollzieht sich eine reiche innere Entwicklung.
Johann Hinrich Wichern ist durch und durch ein Kind der Romantik, einer kulturgeschichtlichen Epoche, die vom Ende des 18. Jahrhunderts bis weit in das 19. Jahrhundert hinein dauerte. Das merken wir besonders, wenn wir seine Tagebuchtexte lesen, die uns heute allerdings reichlich pathetisch scheinen.
Er beginnt, sein Tagebuch zu schreiben, in dem er auch einen Anfang seines geistlichen Lebens schildert (1824). Demnach hatte sein Konfirmandenunterricht ein Bekehrungserlebnis zur Folge: „Der Durchbruch geschah abends, als Gottes Geist mich anfing von neuem zu gebären. Das Licht des Evangelii erleuchtete auch für mich die Wissenschaften … ich habe Fortschritte in jeglichem gemacht.“
Es ist wunderbar, das der Mensch das, was ihm am allernächsten liegt, – und das ist er selbst – am leichtesten und liebsten übersieht. Wer dies bemerkt hat, soll und wird demnach kein Mittel unbenutzt lassen, seinen Blick auf sich, in sich zurückzuwenden.
Also der Mensch liebt die Täuschung und deswegen die Perspektive oder das Ferne und deswegen alle anderen Gegenstände – nur kennt er seinen inneren Menschen nicht. Will er den besehen, so muss er eine Brille aufsetzen; die hat er aber nicht, er muss sie annehmen, das macht ihm aber Mühe, und deswegen setzt er sie lieber nicht auf.'
Nach dem Tode seines Vaters: Jetzt erkenne ich, wie der Heimgang meines unvergesslichen Vaters mir zu großem inneren Segen geworden ist. Herr, wie sind Deine Wege und Gerichte unbegreiflich, 'hoch über den tausendsten Himmel erhaben. Hier heißt es recht: durchs Kreuz zur Freud’!
Beichtgebet: Liebreicher Vater, ich komme zu Dir als zu meinem Erbarmer und Erlöser, der Du mich allein ganz kennst, weil Du allein meine Schuld kennst. Du weißt, wie oft ich noch fleischlich und irdisch gesinnt bin, wie oft noch verwickelt in törichte Einbildungen, wie unachtsam ich das betrachte, was in mir ist, wie felsenhart mein Herz sich hält gegen Tränen der Reue und den Schmerz über meine Sünden; wie ungestüm ich bin in meinen Handlungen, wie leicht zum Zorn gebracht, wie gehör- und gefühllos gegen Dein heiliges Wort, wie schläfrig beim Gottesdienst und wachsam bei törichten Erzählungen, wie so reich an guten Vorsätzen und so bettelarm an guten Werken. Du weißt es, o Herr, am besten, wie oft ich mich auf Menschentrost verlasse, ihn suche und hoffe, während ich nur den besten und reichsten, den Du für mich bereit hältst, hätte annehmen sollen. Du kennst meinen Unglauben und meine geringe Andacht in Stunden, worin sie nicht fehlen dürften. Und dieses kann alles nicht geändert werden als durch Dich, o Herr, mein Gott! Erbarmer, erlöse mich vom Leibe dieses Todes um Deines Sohnes willen nach, Deiner Gnade. Doch; Dein Wille geschehe in alle Ewigkeit! Amen.
Ich habe überhaupt erst ein Fünkchen vom Christentum seit April und Mai, wo mein Konfirmationsunterricht bei Wolters begann. Ich hörte in dieser Zeit evangelisches Christentum bei dem lieben Pastor und glaubte historisch. Sache meines Gemütes war es nur selten und in vorübergehenden Augenblicken. Das Ganze war eine tiefe Dämmerung. Ich las die Bibel nicht und auch keine theologischen Schriften. Dabei pochte ich gewaltig auf über die Würde und Wahrheit der Bibel, lernte hundert und einige Sprüche, die ich größtenteils nicht verstand, wusste weder, was Glauben noch was Gerechtigkeit und Hoffnung sei, sprach aber viel davon, als wenn ich es alles wüsste, disputierte in der Zeit viel darüber, hielt übrigens an im Gebet, wusste aber nicht im Geiste zum Erlöser zu beten.
Kampf gegen meine „Hauptsünde“: Es ist wahr, ich bin inwendig, wenn ich andern gegenüberstehe, stolz und bilde mir was darauf ein, dass ich demütig bin, und übe so den größten Stolz.
Nach dem Abendmahl: Gib mir Kraft, die Kräfte, die Du mir heute mitgeteilt, anzuwenden zum Kampf gegen das Gesetz in meinen Gliedern, gib, dass ich einst mit Paulus rufen kann: Ich lebe; aber doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. (Gal. 2,20).
In demselben Augenblick, in welchem man beleidigt wird, soll man dem anderen, der beleidigt, sogleich verzeihen, ihn recht herzlich lieb haben und für ihn beten. Mein Gott, das hab’ ich heute gekonnt, das hat Dein Geist gewirkt, dank Deiner Gnade!
Je mehr Erfahrungen wir machen, desto ärger setzt der Böse uns durch Zweifel zu, um uns nicht zu verlieren, aber Seine Gnade ist größer denn alles, der Herr ist über alles!
Nach kurzer Krankheit: Mein Gott, wie Du mich gestern hast fühlen lassen die Krankheit meines Körpers, so lass mich auch durch Deinen Geist die Schwachheit und Armut meines Geistes fühlen und merken. – Wie Du mich aber hast genesen lassen durch den Schlaf, von dem ich erfrischt wieder erwachte, so erlöse Du nun auch meine Seele, vom Übel, vom Tode, den ich täglich sterben soll, bis jener Tod kommt, von dem ich übergehe in des Geistes Klarheit, der mir Deine Vaterhand reicht und mich Deinem Heiligtum nahebringt.
Rechenschaft am Bußtag: Wie glaube ich?: Ich fange an, meinem Gott herzlich zu vertrauen und mich ihm kindlich zu ergeben, aber wie oft – ach, nur einzelne Stunden – so manche Stunde vergeht ohne Blick auf Ihn! Wie hoffe ich?: Wie wenig habe ich von der lebendigen Hoffnung, der Quelle der Freuden, die mich machen soll zum Erben jenes Reiches, das mein sein soll und ewig über den höchsten Stern hinaus geht. Wie liebe ich?: Wo wird hier die Liebe bleiben bei solchem Glauben und solcher Hoffnung?! O wirke nur erst„ dass ich sie recht erkenne inwendig an mir, wie Du mich geliebt, ehe noch keiner meiner Tage über uns war. Dich soll ich lieben - mein Ich liebe ich –; mit Dir soll ich Eins werden – Du weißt, wie oft ich Dich bitte und Dich spüre – eben bin ich bei Dir – nach einer Minute wieder tief in der Welt.
Die Auseinandersetzung des „Neuen Menschen“ mit der Welt.
Ich war stets mit glühendem Eifer für die eine Wahrheit eingetreten, die ich in dieser Zeit, da ich sie immer tiefer aus der Schrift erkannte, auch immer treuer festhielt und lauter verteidigte.
Ich befinde mich in einem großen Zwiespalt, wie das Christentum mit dem Leben zu vereinigen ist, was wir von unserer Eigentümlichkeit lassen und was wir abwerfen sollen. In der Theorie mag so etwas leichter scheinen, als es in Wahrheit ist.
Undenklich groß ist die Veränderung, die seit einem Vierteljahr in mir vorgegangen ist. Ich fühle kräftiger; dies mag manchem als Hitze oder als gemacht erscheinen; ich liebe mutiger und tätiger; Verstand und Herz sind in einem großen Wetteifer; der eine will dem anderen voraus; sie erliegen wechselseitig, bis sie zu jener schönen Harmonie kommen. O schöner Tag, wo das wird wahr werden! Wo dieser nur aus eigener Erfahrung erkennbare Zustand aufhört und beide gebunden durch das reinste Band Hand in Hand einhergehen. Die Hilfe von oben wird mir nicht fehlen.
Die Jünglingsseele gleicht allem Vergleichbaren, dem tobenden Meer und der friedlichen Heimat, dem heillosen Schwelger und dem frommen Heiligen! Nenne eine Freude, einen Schmerz, den seine Seele nicht empfindet, ehe der Jüngling sich entfaltet zum kräftigen, ruhigen, schauenden Mann!
O welche Welt geht einem mit der Kunst auf! Man schwindet betäubt zurück vor den heiligen Hallen dieser Werkstatt des menschlichen Geistes.
An Gottes Hand bin ich zu dieser und zu aller Freude gelangt, die einem .das Herz vor Wonne zerschmelzen möchte. Ich habe schon die unterste Stufe betreten, die zum weitesten Tempel führt. Ich liebe Gott und liebe die Brüder wie mich. Vater, das konntest nur Du geben.
Wenn ich dieses Jahr mit dem vorigen zusammenhalte, wo soll ich dann anfangen, Gottes Hand zu sehen und ihm zu danken! Vor einem Jahr fast gar keine jungen Freunde und von den alten durch äußere Lage gänzlich und schmerzlich getrennt. Jetzt eine Reihe innigster Freunde aus dem Verein und ein Kreis frommer, christlicher und dabei geistreicher, gelehrter und einflussreicher Männer – und das alles erkannt und in mein Herz geschrieben und recht beleuchtet durch das Licht des Evangeliums, das mir in meiner tiefen inneren Nacht Klarheit schenkt und mir den Weg zeigt.
Mein Freundeskreis: Unter dem Namen „Christlicher Verein“ sehen sich eine Reihe von Jünglingen, die, wenn auch im Leben auf das Verschiedenste verzweigt, in dem einen Punkte alle übereinstimmen: Jesus Christus, wahrer Gott und Mensch; da jeder das von dem anderen weiß, werden Gespräche der Art nur selten geführt. Die strengste Moralität, das regste Streben nach dem Besseren, dem Edlen im Leben, in Wissenschaft und Kunst, machen einen zum Mitgliede, zum Freund und Bruder. Dieses Bewusstsein hat Studierende, Kaufleute und Künstler zusammengeführt und soll sie für das ganze Leben zusammenhalten, wenn auch das äußere Schicksal noch so weit im Raume trennt.
Das Evangelium bilde den Mittelpunkt und Quellpunkt unseres Lebens, aber wir wollen uns hüten vor der Engigkeit der Herzen.
Es war ein Aufwachsen aus einer „tiefen Dämmerung“, wie der 18jährige es einmal in sein Tagebuch schreibt, ein Aufbrechen von tief in ihm liegenden Kräften. In geradliniger Folgerichtigkeit wuchs daraus eine immer fester werdende Bindung an Jesus Christus als seinen Heiland. Hinzu kommt im Jahre 1826 eine Begegnung mit Johannes Claudius, dem Sohn des Dichters Matthias Claudius, durch die er zu der Erkenntnis kommt, „dass wir einen Gott haben, der uns unaussprechlich liebt und heiligen will“. Nebenbei belegt er Vorlesungen am Akademischen Gymnasium und holt das Abitur nach. Dort begegnet er als Mitschüler einem seiner späteren Mitstreiter für die Belange der Inneren Mission, Clemens Theodor Perthes.
Hamburg vom Stintfang aus betrachtet
Durch seine Privatstunden kommt Johann Hinrich Wichern mit Familien in Verbindung, die der Romantik und der neu sich regenden Erweckungsfrömmigkeit zugetan sind. Bedeutende Persönlichkeiten Hamburgs nehmen sich des hochbegabten und gläubigen Gymnasiasten an. Im Stadtbibliothekar und Professor am akademischen Gymnasium Hartmann gewinnt der junge Wichern einen väterlichen Freund. Die edle, leidgeprüfte, große Künstlerin Luise Reichard, die Goethe und alle berühmten Romantiker in ihrem Vaterhaus kennengelernt hatte, eine Frau voller Glauben, vermittelt ihm eine Fülle von Anregungen. Im christlich-romantischen Jugendkreis der „Theebakklesia“, wie er ihn scherzhaft nennt, kommt man jeden Sonnabend abends von sieben Uhr an bei Brot und Bier zusammen, singt, musiziert, liest, schwärmt. In nächtlichen Bootsfahrten auf der Alster findet man romantischen Stimmungszauber. Junge Kaufleute, Studenten, Künstler sind sich hier eins in „Jesus Christus, wahrer Gott und Mensch“. Die neue Welt der Jugend tritt hier der noch vom religiösen Rationalismus beherrschten Welt des Alters gegenüber. Man protestiert nicht, doch gestaltet man sich seine eigene Welt. Aus diesem Kreis sind mehrere bedeutende Männer der romantischen Malerei und des öffentlichen Lebens hervorgegangen.