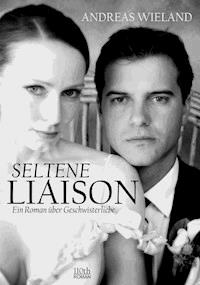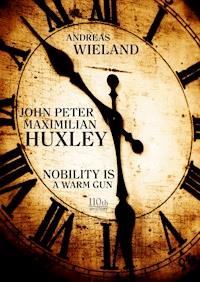
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 110th
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
John Peter Maximilian Huxley ist der geistreich aphoristische Abzug von Querdenken, Standesdünkel und weiteren Attitüden. Er ist ein junger Engländer, welcher erwartungsvoll neue Welten entdeckt. Wider der Moral und Karriereplanung seiner Tante Helen, bricht er alte Verbindungen ab und reist von England nach St. Moritz. Zumindest wähnt er sich in dessen Nähe, wenn er sich durch die borstige Schweizer Alpenlandschaft durchringt. Nach dem Schlagen und der Erkenntnis einer geheimnisvollen Bresche, konfrontiert ihn das Leben in doppeltem Sinne. Einmal im Irdischen, dann wiederum in etwas Ungreifbarem. Während seiner Wanderschaft lernt er den Journalisten und Reporter Walter Zwycki kennen. Immer wieder kreuzen sich ihre Wege an den undenkbarsten Orten und trennen sich gleichermaßen. Einer Laune folgend reist John Peter Maximilian Huxley Jahre später nach Orkney Islands. Dort freundet er sich mit der jungen und aufgeschlossenen Miss Siusan an. Zusammen besuchen sie seinen Freund George Mackay Brown, in dessen Wohnung John Peter Maximilian Huxley, dann selbst den Schritt durch die vor Jahren geschlagene Bresche macht. Geschehnisse und all die philosophischen Gedankensplitter werden dadurch zur gespiegelten Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
John Peter Maximilian Huxley
Nobility is a warm gun
von
Andreas Wieland
Impressum:
Cover: Karsten Sturm, Chichili Agency
Foto: fotolia.de
© 110th / Chichili Agency 2014
EPUB ISBN 978-3-95865-290-3
MOBI ISBN 978-3-95865-291-0
Urheberrechtshinweis:
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors oder der beteiligten Agentur „Chichili Agency“ reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
*
Da gebe es bestimmt etwas, worauf es sich zu schießen lohnt, murmle ich vor mich hin und schaue aus scheuen Augenwinkeln einmal nach rechts und dann nach links, den Kopf halte ich dabei gesenkt, gedankenverloren und mit glänzender Stirn schreite ich voran, die Hände hinter dem Rücken, in der einen halte ich eine Kleeblume. Schnalzend sauge ich an einem Tropfen Baumharz, welchen ich zuvor mit dem Taschenmesser aus einem Rinnsal von Harz herausgebrochen habe. An meiner Schulter hängt eine kakifarbene Feldtasche, darin habe ich belegte Brote und eine glucksende Wasserflasche, am Hals baumelt ein Feldstecher, welcher mir bei jedem Schritt leicht gegen die Brust schlägt, fast wie ein äußerer Herzschlag. Als impertinent bezeichneten mein ehemaliger Arbeitgeber, meine Vermieterin und die Leute aus dem Quartier meinen Aufbruch, wie könnte man mir nichts dir nichts alles hinter sich lassen wollen, unbegreiflich sei dies für sie, ja selbst Tante Helen zeigte sich bockig in ihren Abschiedsworten und quittierte diese durch fortwährendes Kopfschütteln. Dass sie immer erreichbar sei, sagte sie und auch, dass sie alle vierzehn Tage von mir hören wolle. Schriftlich, telefonisch oder über Dritte, doch alle vierzehn Tage würde sie damit rechnen wollen, ansonsten sie mir nichts Gutes mehr wünschen könnte. Ich kann nicht behaupten, dass diese Bitte mir Lust abgewinnen konnte, doch wollte ich mich mit ihr nicht über den Haufen werfen wegen dieser Kleinigkeit, schließlich war sie es, die mich nach dem Tod meiner Eltern aufgezogen hatte. Als Einzelkind lebte ich seit meinem elften Lebensjahr bei ihr und durfte ihre Erziehung genießen, auch wenn ich diese bis zum heutigen Tag nicht immer verstehen kann. Irgendwie kam es mir entgegen, als ich damals, anschließend an meinen Schulabschluss zur Rekrutenschule beordert wurde, bei aller Liebe für Tante Helen, aber danach konnte ich mit gutem Grund ein selbständiges Leben führen, denn all zu lange hatte sie mir die Ohren vollgepustet und gesagt, dass nur die Marine es vermöge, die kindlichen Flausen eines Jünglings zu verscheuchen und dass ich erst dann das Bild eines Mannes verkörpern würde. Nun gut, mein Onkel war Flagg Offizier bei der Royal Navy, auch glaube ich, dass er der erste und letzte Mann meiner Tante war und sie einer heimtückischen Denkweise betreffend seiner Qualitäten zum Opfer fiel. Verbissen wehrte sie jegliche Gedanken ab, welche ihr Bewusstsein hätten verändern können. Außer in meinem Schlafgemach und der Besenkammer, hing, bezeugend ihrer Liebschaft, in jedem Raum eine Ablichtung von ihrem Mann, jedes zeigte ihn in schnittiger Uniform vor irgendeinem Kriegsschiff. Noch heute sehe ich vor meinen Augen, wie sie auf Zehenspitzen an seiner Kleidung herumzüpfelt und mit den Fingern über tadellose Falten, Patten und Kragen fährt und mit den Kuppen auf Auszeichnungen und Ehrungen tippt, als würde sie diese küssen. Mein Onkel strich sich derweilen tief einatmend über seine rotblonden Backenbärte, über das kantige Kinn, in der anderen hielt er seine Mütze. Seine Nase stach dabei in die frische Morgenluft und wie bei einem Appell, überblickte er den Hof, der drei Stufen tiefer sich der Straße zu erstreckte. Einmal anvertraute sich mir meine Tante und meinte, dass die Ungewissheit, in der er sie jeweils zurücklassen würde, ihr nicht gut bekäme. Ich könne dies nachempfinden, antwortete ich ihr darauf und auch würde ich Vermutungen anstellen, was sie unmerklich alles in Bereitschaft halten könnte deswegen. Und es war tatsächlich so, dass ich mit ihr mitfieberte, fast wie bei den Pferderennen, welche wir uns jeden Winter in der Schweiz, in St. Moritz, anschauten und Wetten abschlossen. Nur, dass es hier um etwas ganz anderes ging und obwohl sich teils Parallelen ergeben mochten, hier ging es nicht ums Setzen, hier dachte niemand an Vergnügen, Entzücken konnte auch ich dem Ganzen keines abgewinnen. Ich liebte meinen Onkel sehr und dass er auf mich einen vorbildlichen Eindruck hinterließ, ordne ich nicht zuletzt seinen kulanten Manieren zu. Heute bin ich selbst in der Reife, in welcher mein Onkel war, als er zum letzten Mal Morgenluft durch seine Nase und in die Lungen strömen ließ und als meine Tante mit ihren Händen seine Uniform glättete. Von da an wusste ich, wie sehr mich der Alltag braucht und auch, dass ich noch etwas erleben wollte. Mit fest geschlossenen Lippen denke ich an meinen Aufbruch zurück, sehe mich auf der Steintreppe vor dem Haus meiner Tante stehen, frisch war die Morgenluft, meine Hände vergrub ich in den Hosentaschen. Jetzt ist es angenehm warm, die Arme halte ich noch immer auf dem Rücken, in den Finger rolle ich den Stil der Kleeblume hin und her, und wenn ihr Saft an meiner Haut klebt, werde ich daran riechen wollen.
Gescheite Augen hätte ich, rühmten mich früher meine Lehrer mit zusammengezogenen Brauen. Doch sei ich zu faul, um einmal einer ehrbaren Arbeit nachgehen zu können, sowieso seien meine Ansichten über das Berufsleben im höchsten Maße verdreht und lebensfremd, kurzum - aussichtslos. Tatsächlich hatten sie recht behalten und so wurde aus mir eben kein Arzt und auch kein Admiral, Commodore, Captain oder Commander, sondern jemand, der mit einer Kleeblume in der Hand und Baumtropfen saugend sich der verwegensten Versuchung zu stellen wagt, jemand, der den Beginn der Welt in sich trägt und darin seine Aufgabe gefunden hat. Frei von Normen und Konventionen flammen in mir Ideen, bestimmt werde ich etwas finden, worauf es sich zu schießen lohnt. Doch ist mein Geist keineswegs dazu angetan etwas aufzuschnappen, so sanft oder zornig ich ihn auch antreiben mag, ach, wie wenig ich mich doch kenne in solchen Momenten, sonor stelle ich mir die Stimme vor, die lautlos in mir schaltet und waltet, die den Rost der Ungeduld schürt und die mir eine minuziöse Gestaltung meiner Zukunft verwehrt. Offensichtlich hat das Leben keine Eile, mir auf meine Fragen oder Bitten zu antworten. Und wenn ich alles aufschreiben täte, den ganzen Tag lang alles aufschreiben täte was mich beschäftigt, mit was ich mich beschäftigen will, ich bin mir gewiss, immer wieder würde ich das Geschriebene durchstreichen, neu schreiben und wieder durchstreichen und dies so lange, bis sich die Sonne senkt. Mag mein Wille auch noch so um sich greifen, Erfolg und Genugtuung sehe ich nur darin, dass ich mich mit solcher Situation nicht ernsthaft streite und wenn doch, so wünsche ich mir in diesen Sekunden nichts sehnlicher, als dass eine ungewohnte Faulheit von mir Besitz nehmen könnte. Wohl müssen es die Stimmungen der Liebe sein, eine Fülle verschiedenster Gemüter vielleicht, denke ich mir und rieche an meinen Fingern das Chlorophyll.
Kamala
In flirrender und schweißfeuchter Luft erspähe ich sie. Mit meinem dritten Auge, sozusagen. Vom Beobachtungsmasten aus, mit dem imaginären Fernrohr des Admirals John Peter Maximilian Huxley (Das bin ich). Zusammengekauert, mit dem Rücken erschöpft an einen Baum gelehnt, von Affen neugierig gemustert. Kamala hieße die junge Frau, ließ man mich wissen. Und dass sie in Indien lebte. In einem Herrenhaus. Sogleich stellte ich mir Paläste in verschiedensten Farben vor. Pinkfarben, Blau, Weiß. Sah Marmorsäulen und filigran geschaffene Torbogen. Gepolsterte Nischen, Himmelbetten und mit teuren Stoffen behangene Erker. Audienzhallen, Rauchsalons und Harem. Hunderte von Treppenstufen, welche auf und ab und rundherum führten und tiefe, dunkle Brunnen in schattigen Innenhöfen. Männer mit schwarzen Augen und verwirbelten Bärten. Zartgliedrige Mädchen und Frauen in bunten Saris und Maharadschas, aber auch Rajputen, Rajas und Moguln, mit ihren hohen Turbanen auf Elefanten reiten. Ja, vielleicht war Kamal eine Rani. Eine Königstochter, die sich verlaufen hatte?
Wie froh ich doch bin, nie in solcher Lage geschmachtet zu haben, denke ich mir und weiter, dass ich mit königlicher Robe wohl nie was anfangen kann. Obschon, als Kind mochte ich die königlichen Märchen über alles. Die orientalischen. Scheherazade und Salomo. Sindbad und Ali Baba und wie die alle heißen. Auch sah ich mich öfters in der Rolle des Königs oder des furchtlosen Ritters. Nun, außerhalb dieser surrealen Romantik sind mir Feldflasche und Fernglas allerdings um vieles lieber, auch wenn solche oder ähnliche Haltungen von meiner Außenwelt nie so ganz anerkannt werden. Noch immer auf meinem Beobachtungsposten (allegorisch zu verstehen), lehne ich mich über den Korbrand und erblicke unweit von Kamala ein flackendes und Rußsäulen hochschießendes Flugzeugfrack. Auch Madhukar, ihr Pilot, ist gleich Kamala, bereits vom zeitlichen gesegnet worden, jedenfalls brutzelt sein Fleisch übelriechend vor sich hin wie bei einer BBQ-Party. Und wie auf einem Bratrost, so sehe ich jetzt, liegt Kamalas Körper direkt neben dem seinen. Was sich also am Baum angelehnt hält, ist demnach dem irdischen bereits entwichen. Doch sehe ich sie noch immer in gelbem Sari und wie sie sich jetzt aufrichtet und auf Madhukar zugeht, welcher noch immer fassungslos neben blechernem Inferno steht. Trotz meines geschärften Verstandes bleibt mir im Augenblick vieles verborgen von dieser rätselhaften Welt. So entschließe ich, dieses sonderbare Szenario zu verabschieden und weiter einen Fuß vor den anderen zu setzen. Über Wiesen und Matten und durch Waldabschnitte, wohl offen mein Blick durch eine mir zuvor unbekannte Bresche dringt. An einem Wegrand stelle ich mich auf einen Baumstrunk und halte meine Nase in die Luft. Atme tief ein und aus, denke an Tante Helen und an ihre Abschiedsworte. Weizen- und Rapssaat glänzen auf meinem Gesicht und vor mir habe ich eine goldene See, die sich rauschend hin und her wirft. Als Flagg Offizier blicke ich auf die entfernte Bergkette, welche ich zu erkunden habe. Eine Expedition außergewöhnlichen Einsatzes. Unentrinnbarem immer bewusster, spüre ich dieses von fernher geglaubte Leben nun dicht neben mir, auch in mir, und bin froh, dieses dort zu wissen. Darüber allerdings, werde ich Tante Helen kein Sterbenswörtchen berichten, Ihnen jedoch, erzähle ich bereitwillig mehr darüber. Wie Nissen kleben meine Gedanken, meine ganze Aufmerksamkeit an diesen abenteuerlichen Ereignissen und werden zur anhaltenden Äußerung meines unsichtbar vorgezeichneten Weges. Fern ab von Schlafwandlertum oder etwelcher Sinnestäuschung führe ich meinen Gang in brennender Liebe fort.
Igor
Ukraine. Südrussische Schwelle. Saporoshje. Igor ist stadtbekannt, neunzehn Jahre alt und träumt von Dingen, welche Freiheit und Geltung illustrieren; aversierend und schnippisch gegenüber allem Glanzlosen zu sein macht ihn aus, die Welt hätte man sich gefälligst wie eine Göttin vorzustellen, aus Gold und funkelnden Edelsteinen, gekleidet in wertvollen Brokat. Kamalas Kaste, so stelle ich mir vor, könnte in etwa seinem Geschmack entsprechen. Hoch zu Ross neben Alexander dem Großen, in feudaler Staatskutsche mit Napoleon Bonaparte oder hinter einem Kirschbaum-Schreibtisch im Kreml, umgeben von Zaren. Igor ist ein Stadtmensch. Tiere sieht er am liebsten vor sich auf dem Teller liegen, ob in Wurstform oder am Spieß, mit viel Soße soll alles übergossen sein, dazu trinkt er Bier. Vom Schatten der schwarzen Wildlederhutkrempe werden seine eisblauen Augen abgedeckt, am Hals hängt der mit beschlagenem Silber gefasste Hauer eines Ebers, darunter fein das Goldkettchen mit dem Kruzifix, die oberen fünf Perlmuttknöpfe des westernbestickten Hemdes sind geöffnet. Hautenge Bluejeans winden sich um seine hageren Beine, die auf Halluxfüßen in abgelaufenen, aber! original texanischen Stiefeln stecken. Die Gurtschnalle drückt sich leicht ins behaarte Fettpolster, doch protzig sieht er aus, der Büffelschädel. Genauso die eingefassten Onyx- und Labradorit-Fingerringe. Aus einem unrasierten Gesicht lugt die gekrümmte Boxernase jeweils in frühe Abendstunden hinaus, wenn andere Feierabend machen, nimmt er das Frühstück ein. Sein Zuhause sind Spieltische und die nach Rosenöl duftenden Laken der Dirnen, sein Finanzinstitut ausgeklügelte Lügengeschichten, als Bürge hierfür dient der Grabstein seiner Mutter und ich weiß, dass Sie es auch wissen, dass eines Ganoven Schulden sich nicht rechnen. Mit wachem Auge betrachte ich also die vor mir liegende Bresche, dahinter noch immer die brausenden Wogen der Felder. Umgeben vom Bratfett- und Frittieröldunst der Imbissbude trommelt Igor rastlos mit den Fingerkuppen auf die Stehtischplatte. Dass es ein attraktives Geschäft sein soll, sagt sein Freund und auch, dass sie damit für die nächsten zwei Jahre ausgesorgt hätten, sollten sie sich auf die Sache einlassen. Das Risiko ließe sich kalkulieren, eine leichte Beute, daran bestünde kein Zweifel und das mit der Moral ließe ihn kalt, der Pistolenlauf müsse heiß sein, dann käme alles gut. Noch in der Nacht würden sie nach Kiew fahren. Und wenn sie ankämen, säße die Gute, bereits im Morgenmantel und tuppiertem Haar am Frühstückstisch und würde ihrem Schoßhund Kaviar in den Rachen schieben. In lauerndem Kreise würden sie dies betrachten, sich ihr nähern, eine Muse wäre ihre Ahnungslosigkeit. In süßem Schlaf fände man sie auf, Spuren gäbe es keine. Etwas erschüttert steige ich vom Baumstrunk und gehe weiter. Dabei achte ich darauf, dass ich meine Füße bei jedem Schritt schön abrolle, die Ferse richtig aufsetze, die ganze Fußsohle bewusst wahrnehme und sich der Tritt erst bei der Zehenspitze löst, um in einen nächsten überzugehen. Nun, eigentlich hoffe ich, dass Igor diese Missetat nicht ausführen wird. Wüsste mein geliebter Onkel George davon, er würde ihn gleich den Haien zum Fraß vorwerfen. Alleine der Plan schon, gäbe ihm Grund dazu. Meuterer, pflegte er stets zu sagen, sterben eben früher. Ein Admiral ohne … Aber lassen wir das. Jedenfalls würde das Geld bestimmt nicht lange anhalten. Er würde es verspielen und in Freudenhäusern ausgeben. Teure Kleidung kaufen und was übrig bleibt freimütig um sich werfen. Kaum hoffe ich, seine Geschichte möge sich zum Besten wenden, erblicke ich durch mein magisches Auge eine mir bislang unbekannte Frau, welche Igor und seinem Kumpanen ihre Haustüre öffnet. Ihr Wohlstand steht ihr ins Gesicht geschrieben. Mit feiner, leichter Feder muss dies jemand getan haben. Sofort schließe ich meine Augen und halte die Hände vors Gesicht. Da steht er nun, Igor. Bestürzt schaue ich zu, wie er verdutzt auf seinen erschossenen Körper starrt. Sein Kumpane und die Frau sind meinem Blickfeld entwichen. Eigentlich bin ich ganz froh darüber, so habe ich für heute doch schon so allerhand erlebt.
Lars
Trotz seiner neunundachtzig Jahre sind seine Hände noch immer flink und gewandt, wenn er seinen Gänsen die Flaumfedern rupft. Weit weg von Lärm und Radau tut er dies, nordwestlich von Seydisfjördur, eigentümlich seines geebneten Lebens. Auf seinem Gesicht liegt die tiefstehende Sonne, gegerbt wirkt seine gebräunte Haut. Der Hof vor dem Haus, die Balustrade und die schmalen Rabatte, erinnern mich in gewisser Weise an das Anwesen von Tante Helen, vielleicht ist es aber auch nur die vertraute Ruhe, mit der das Bild behaucht ist. Ungewohnt verdattert nehme ich dies wahr und staune, wie sich meine Jugendjahre eigenständig in Erinnerung rufen. Dabei gerät Lars beinahe in Vergessenheit. Auf dem Bauch liegend, das Kinn in Handballen stützend, die Ellenbogen in den Rasen gestemmt schaue ich zwischen Balustern hindurch, sehe Heidelbeerstauden und Firnfelder, aber auch die staubigen Straßen von Mansfield. Dass ich fortwährend einen Fuß vor den anderen setze und vorpresche als gäbe es was einzuholen, steht mir nahe, avantgardistisch eventuell, meine Sinne jedoch rein durch gespiegelte Welten ziehen.