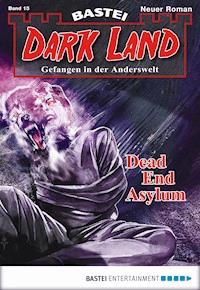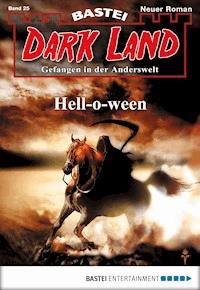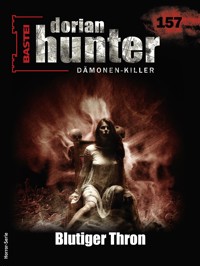1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair
- Sprache: Deutsch
Ich bin der Sohn des Lichts. Ich habe schon unendlich viele Kämpfe gegen die Mächte der Finsternis bestritten. Dennoch werde ich nicht müde, den Höllenmächten weiter Paroli zu bieten. Manchmal wundere ich mich selbst, woher ich die Kraft und meinen Optimismus nehme, niemals aufzugeben. Dabei ist die Antwort ganz einfach: Es ist meine Berufung.
Dennoch gibt es Fälle, die auch mich an die Grenze meiner Fähigkeiten bringen. Dieser Fall gehörte dazu. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Beginnen wir einfach damit, wie alles anfing ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Die Dämonin, die aus der Kälte kam
Briefe aus der Gruft
Vorschau
Impressum
Die Dämonin, die aus der Kälte kam
von Logan Dee
Ich bin der Sohn des Lichts. Ich habe schon unendlich viele Kämpfe gegen die Mächte der Finsternis bestritten. Dennoch werde ich nicht müde, den Höllenmächten weiter Paroli zu bieten. Manchmal wundere ich mich selbst, woher ich die Kraft und meinen Optimismus nehme, niemals aufzugeben. Dabei ist die Antwort ganz einfach: Es ist meine Berufung.
Dennoch gibt es Fälle, die auch mich an die Grenze meiner Fähigkeiten bringen. Dieser Fall gehörte dazu. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Beginnen wir einfach damit, wie alles anfing ...
Nämlich mit einem Traum, aus dem ich bibbernd und am ganzen Körper zitternd erwachte. Ich hatte geträumt, splitternackt in einer eisigen Schneelandschaft herumzuirren. Überall um mich herum war alles weiß. Die ganze Landschaft, bis zum Horizont, glich einem riesigen Leichentuch. Im Traum wusste ich nicht, was mein Ziel war oder warum ich überhaupt weiterging, statt mich einfach fallen zu lassen und mich meinem Schicksal zu ergeben.
Etwas trieb mich weiter. Vielleicht war es einfach mein Selbsterhaltungstrieb, denn instinktiv spürte ich, dass es mein Ende sein würde, wenn ich stehen blieb, obwohl jeder einzelne Schritt eine unendliche Qual bedeutete. Das lag daran, dass der Boden nur auf den ersten Blick eben wirkte. Wenn ich genau hinsah, war die Oberfläche mit nadelspitzen winzigen Eissplittern übersät, die mir schmerzhaft in die Haut stachen.
Einmal blickte ich zurück und erkannte die blutigen Fußspuren, die ich auf dem Eis hinterlassen hatte. Auch sie zogen sich bis zum Horizont. Ich war also schon sehr lange unterwegs, ohne dass ich wusste, woher ich kam.
Also ging ich weiter.
Es gab aber noch einen anderen Grund, der mich vorwärtstrieb. Mir war, als hörte ich die ganze Zeit eine flüsternde, verlockende Stimme in meinem Kopf. Die Stimme war weiblich. Ich verstand nicht, was sie sagte. Sie drückte sich in einer mir unbekannten, fremdartigen Sprache aus. Und dennoch spürte ich die Verheißung darin, die nicht ohne Wirkung auf mich blieb.
Trotz der verlockenden Stimme hatte ich selten einen quälenderen Traum gehabt. Denn im Grunde hatte ich das Gefühl, nicht von der Stelle zu kommen. Der Horizont blieb so grenzenlos weit entfernt wie eh und je, ohne dass ich je ein Ziel vor Augen sah.
Umso überraschter war ich, als ich weit vor mir eine Gestalt ausmachte. Zuerst glaubte ich an eine Täuschung, denn sie hob sich kaum von ihrer Umgebung ab, mal abgesehen von einem wehenden schwarzen schleierartigen Etwas, das ich nicht zu deuten wusste.
Aufgeregt beschleunigte ich meine Anstrengungen vorwärts zu kommen, wobei der Schmerz, den die winzigen Eiskristalle verursachten, als sie durch die Haut in meine Fußsohlen eindrangen, fast nicht zu ertragen war. Er trieb mir die Tränen in die Augen, die jedoch sofort auf meinen Wangen gefroren.
Es war eine bizarre, unwirkliche Situation, die mir aber als solche nicht bewusst war. Also biss ich die Zähne zusammen und lief weiter.
Und ich kam tatsächlich näher heran! Nach und nach erkannte ich Genaueres: Die Gestalt, die da vor mir aufgetaucht war, war eine Frau, das schloss ich aus der Silhouette. Aber sie lief nicht, sie schwebte. Jedoch nicht wie ein Geist, sondern eher so, als würde sie dennoch die Füße bewegen – als würde sie in der Luft laufen, einige Handbreit über der gefrorenen Schneedecke, mit einem leichten, beschwingten Schritt, so als gäbe es für sie die Kälte nicht, sondern als liefe sie an einem sonnendurchfluteten Sandstrand dahin.
Sie trug ein am Oberkörper eng geschnürtes weißes Gewand, daher war sie aus der Entfernung zuvor kaum auszumachen gewesen. Was ich für einen schwarzen Schleier gehalten hatte, waren die knielangen Haare, die hinter ihr her wehten.
Plötzlich wusste ich, dass das lockende Flüstern in meinem Kopf von ihr stammte. Und aus irgendeinem Grund, der mir nicht bekannt war, musste ich alles daransetzen, sie zu erreichen.
Und das gelang mir auch ...
... fast.
Denn als ich nur noch einen Meter hinter ihr war und wie ein Schiffsbrüchiger nach dem rettenden Floß den Arm nach ihr ausstreckte, löste sie sich plötzlich in eine bläuliche Nebelwolke auf! Meine Hand griff hinein, und ich spürte eisigen Schmerz.
Davon wachte ich auf.
Ich blickte auf die Leuchtziffern des Uhrenradios. Es war 2 Uhr 22 in der Nacht.
Ich fror wie ein Schneider und klapperte mit den Zähnen, konnte mir aber nicht erklären, warum ein Traum eine solche Wirkung erzielen konnte. Aber vielleicht war es ja andersherum: Ich hatte im Schlaf gefroren, und mein Unterbewusstsein hatte gleich entsprechende Traumbilder dazu assoziiert.
Wie auch immer: Die Tatsache, dass mir eiskalt war, ließ sich nicht wegreden. Was auch immer der Auslöser dafür war.
Ich machte Licht, schlug die Bettdecke beiseite und schlüpfte in meine Schlappen. Im Zimmer herrschte trotz der sommerlichen Jahreszeit klirrende Kälte. Zumindest kam es mir so vor. Am liebsten wäre ich wieder unter die Bettdecke gehüpft, aber das hätte ja auch nichts geändert. Ich tappte zur Heizung. Sie war natürlich kalt, aber davon spürte ich kaum was. Meine Finger waren wie eingefroren. Aus Gewohnheit und weil es gesünder ist, ließ ich sie im Schlafzimmer generell ausgeschaltet. Nun drehte ich sie voll auf.
Ein Luftzug streifte mich. Das Fenster war gekippt. Ich schloss es, aber von draußen war die Kälte nicht hereingekommen, dazu war die Nacht zu lau.
Noch immer fröstelnd ging ich in die Küche, setzte den Wasserkessel auf und machte mir eine Wärmflasche.
Und das mitten im Sommer!
Vielleicht war es das ja: eine typische Sommergrippe. Eine andere Erklärung fiel mir nicht ein. Und wenn es mir morgen früh nicht besser ging, würde ich statt ins Büro zu fahren, zum Doc gehen. Es war im Moment sowieso nicht viel los, das bisschen Bürokram würde Suko auch allein schaffen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben musste.
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass sich Erkältungssymptome auch mit heißem Bier lindern ließen. Ich hatte noch eine Flasche im Kühlschrank und erhitzte sie im Wasserbad. Das Zeug schmeckte wie aufgewärmte Füße, aber die Kälte vertrieb es auch nicht.
Zurück im Bett gingen mir die Traumbilder nicht aus dem Kopf. Außerdem ließ sich die Kälte auch mit der Wärmflasche nicht vertreiben. Es war zum Haareraufen! Viel Schlaf, so fürchtete ich, würde ich wohl diese Nacht nicht mehr bekommen.
Irgendwann fielen mir trotzdem die Augen wieder zu.
Und ich befand mich sofort wieder in der eisigen Landschaft ...
Ein Jahr zuvor
»Sie sind allein?« Der Koch, der hinter seiner offenen Küche stand, sah Jiro aufmerksam, aber auch ein wenig skeptisch, an, so als wolle er in seine Gedanken eindringen.
Jiro war der Blick unangenehm, und er bereute schon, das Restaurant überhaupt betreten zu haben.
»Sehen Sie noch jemand anderen außer mir?« Jiro straffte die Schultern. Er hatte es nicht nötig, in Sack und Asche zu gehen. Nicht mehr.
Nicht mehr, seit er einen Entschluss gefasst hatte. Und der war endgültig.
»Nein, entschuldigen Sie. Es ist nur ... hierher kommen meistens die Angestellten aus den umliegenden Büros. Kaum jemand kommt allein ...«
Niemand geht um diese Zeit allein essen, dachte Jiro im Stillen. Er hatte ja recht. Sich abzusondern galt als nicht sozial. Es konnte im Zweifel sogar der Beförderung hinderlich sein. Wer sich nicht als Teil des Teams unterordnete, galt als Sonderling.
Jiro war nie ein solcher gewesen, im Gegenteil. In seiner Zeit als Werbegrafiker in einem Zeitungsverlag war er einer der Geselligsten gewesen. »Deru kui wa utareru« – Ein herausstehender Nagel wird eingeschlagen. Die Redewendung hatte er oft genug von seinem Chef gehört, wenn jemand in seiner Abteilung aus der Reihe getanzt war oder in seine Entwürfe zu viel Individualität entfalten wollte. Jiro hatte sich daran gehalten, schon aus Prinzip. Er war niemand, der das Bedürfnis hatte, herauszuragen. So war er erzogen worden.
Bereits sein Vater hatte zeitlebens in der Frühe das Haus verlassen, um überpünktlich an seinem Arbeitsplatz zu erscheinen. Erst spät abends war er wieder nach Hause gekommen. Stets hatte er einen seiner zwei makellosen grauen Anzüge getragen.
Für Jiro war er immer ein Fremder geblieben. Und dennoch hatte er – ohne dass es ihm bewusst gewesen war – mehr von dem Erbe seines Vaters mitbekommen, als er es sich gewünscht hätte. Auch er verließ seit Jahr und Tag, seit er sein Studium beendet hatte, viel zu zeitig die kleine Wohnung, um erst zwölf oder noch mehr Stunden später heimzukehren.
Yuna erwartete ihn dann stets mit einem Essen, es war immer bereit, wie spät er auch kam. Als sie sich damals auf der Uni kennengelernt hatten, war Yuna dabei gewesen, für ein Lehramt zu studieren. Spanisch und Geografie waren ihre Fächer. Und sie hatte alles mit Begeisterung aufgesogen, war sogar eine der besten ihres Jahrgangs gewesen.
Aber auch sie war im traditionellen Sinne erzogen worden. »Weil du ein Mädchen bist«, war die häufigste Begründung ihrer Eltern gewesen, wenn sie ihr etwas verboten hatten. Oft genug hatte sie sich gefügt, aber was das Studium betraf, hatte sie ihren Kopf durchgesetzt.
Jiro war ein Jahr vor ihr mit seinem Grafikstudium fertig geworden. Sofort hatte er gut verdient. Noch vor Yunas Abschluss hatten sie geheiratet, und es war von Anfang an klar gewesen, dass er die Brötchen verdiente und Yuna ihre traditionelle Rolle als Frau im Haushalt versah.
Seit zwanzig Jahren waren sie nun verheiratet. Natürlich hatte er sich ab und zu gefragt, wie Yuna ihren Tag verbrachte. Sie ging oft spazieren, in den Parks oder Zoos, manchmal besuchte sie auch allein eine Kinovorstellung, und natürlich liebte sie es, zu shoppen. Abends lauschte Jiro interessiert ihren Erzählungen, wo sie gewesen war und was sie tagsüber erlebt hatte, und es war, als sähe er durch ihre Augen, was er versäumt hatte. Ohne dass er das Gefühl hatte, es wirklich versäumt zu haben.
Sie hatten eine Ehe wie Hundertausende andere in Tokio geführt, ohne große Höhen und Tiefen, aber sie waren sich selbst genug und liebten sich noch immer innig. Allein ihr Kinderwunsch hatte sich nie erfüllt.
»Wollen Sie nun etwas essen oder nur etwas trinken?« Der Koch unterbrach seine Gedanken.
»Essen – und trinken.« Jiro war noch immer erstaunt über das Innere des peruanischen Lokals.
Es war ihm, als hätte er tatsächlich einen anderen Kontinent betreten. Eine völlig andere Welt. Die Wände waren über und über dekoriert mit gerahmten Fotos von peruanischen Fußballvereinen und Landschaftsbildern. Und natürlich zeigten einige Bilder auch Perus bekanntestes Wahrzeichen: die Inkastadt Machu Picchu mit der prägnanten Bergspitze des Huayna Picchu im Hintergrund.
Auch in Jiros und Yunas Wohnung hing ein Foto, das die Ruinenstadt zeigte – etwas verkitscht bei Sonnenuntergang, sodass die Mauern als schwarze Schatten vor einem orangeroten Himmel zu sehen waren.
In den Wänden des Lokals befanden sich etliche kleine Nischen, in denen Götterstatuen standen. Jiro waren sie allesamt fremd, aber er war sich sicher, dass Yuna einige gekannt hätte.
Der Koch nickte. »Wollen Sie stehen oder sitzen?«
»Sitzen natürlich.« Er hatte den Tag über genug gestanden und war lange genug herumgelaufen. Ziellos, Kilometer um Kilometer, nur um die Zeit herumzukriegen.
Der Koch wies auf einen der Einzeltische. Es gab tatsächlich nur einen einzigen. Die anderen Tische waren ausnahmslos für mehrere Personen ausgerichtet.
»Haben Sie denn auch eine Karte für mich?«
»Keine Karte. Mittags koche ich nach Lust und Laune. Je nachdem, was ich auf dem Markt finde. Mit vielen frischen Zutaten.«
»Also schön, dann tischen Sie mir meinetwegen auf, was Sie dahaben.«
Der Koch war Jiro eine Spur zu eigenwillig. Und zu selbstbewusst. Aber er schien sein Handwerk zu verstehen, denn noch während er mit Jiro sprach, schnitt er mit atemberaubender Geschwindigkeit das Gemüse.
Jiro schlenderte zu dem ihm zugewiesen Platz und setzte sich. Der Stuhl war klein und unbequem, wie überhaupt alles in dem Restaurant eine Spur zu winzig geraten schien – selbst für japanische Verhältnisse.
Kaum hatte er Platz genommen, servierte ihm ein Mädchen ein Getränk, ohne dass er es bestellt hätte. Das Mädchen war jung, vielleicht sechzehn, und es trug moderne westliche Kleidung: Jeans und ein rotes Shirt, das seine knabenhafte Figur betonte.
Jiro fragte sich unwillkürlich, ob das die Tochter des Kochs war, und wieder dachte er daran, dass er und Yuna kinderlos geblieben waren. Ansonsten wäre ihre Tochter vielleicht jetzt auch in dem Alter gewesen. Der Gedanke versetzte ihm einen leichten Stich. Zusätzlich zu all den anderen düsteren Gedanken.
Die junge Frau interpretierte seinen Gesichtsausdruck wohl falsch und bezog es auf das Getränk.
»Inca Kola«, sagte sie lächelnd. Sie stellte eine Dose und ein Glas vor ihm ab und schüttete ihm ein.
»Das sieht ja aus wie ...« Jiro stoppte sich im letzten Moment und sprach nicht aus, was ihm auf der Zunge lag.
»Wie Lamapisse?« Das Lächeln des Mädchens verwandelte sich in ein breites Grinsen.
»Das ... das wollte ich nicht sagen.« Jiro fühlte sich ertappt. Denn an etwas ähnliches hatte er tatsächlich gedacht. Jedenfalls war das Getränk nicht braunschwarz wie sonstige Cola, sondern gelblich.
»Mein Vater sagt, es sei flüssiges Gold. Golden wie die einstige Goldene Stadt des Inkareichs.«
»Stammt dein Vater aus Peru?«
»Nein, aber meine Mutter.«
»Aha.« Jiro wollte das Mädchen nicht weiter aushorchen. Eigentlich hatte er überhaupt keine Lust auf Konversation, aber das Mädchen plapperte unbefangen weiter.
»Mutter ist vor fünf Jahren gestorben. Bei einem Verkehrsunfall. Zum Glück hat sie Paps vorher das Kochen beigebracht.«
Jiro zeigte in die Runde: »Aber gut zu laufen scheint der Laden nicht, oder?« Kein einziger der anderen Tische war besetzt.
»Oh, das täuscht. Die Mittagspause ist vorbei. Um diese Uhrzeit kommt kaum jemand. Aber abends ist hier die Hölle los. Wenn die Leute wieder aus ihren Büros kommen.«
Jiro nickte und wagte es, einen Schluck der Lamapisse zu probieren. Der Geschmack war gewöhnungsbedürftig und erinnerte an Kaugummi. Aber gut, da musste er durch.
Genau wie durch alles andere an diesem Tag. Denn auch das Essen war nicht nach seinem Geschmack. Aber immerhin schien der Laden authentisch zu sein. Aus den Lautsprecherboxen erklangen Panflötenklänge, und während er ihnen lauschte und dabei die Fotos von Machu Picchu betrachtete, stahl sich zum ersten Mal so etwas wie ein Lächeln auf seine Lippen. Scheißegal, wie es schmeckte, Yuna würde der Laden gefallen. Einmal mehr beglückwünschte er sich zu seiner Idee, ihr einen unvergesslichen Abend zu bereiten.
Einen letzten unvergesslichen Abend.
»Es ist – traumhaft hier!« Yunas Augen leuchteten geradezu.
Wie bei einem kleinen Kind, das zum ersten Mal das Tokyo Disneyland besucht, dachte Jiro. Einem Kind, dem ein lange gehegter Wunsch endlich erfüllt wird.
Zugleich meldete sich sein schlechtes Gewissen. Der Restaurantbesuch war nur ein billiger Ersatz für die Reise nach Peru, von der Yuna vor ihrer Heirat und auch noch lange Jahre danach geträumt hatte. Schließlich war ihr Spanisch perfekt, und in dem südamerikanischen Land wuchsen zu über achtzig Prozent der Bevölkerung damit als Muttersprache auf.
Ohne dass sie je viel darüber gesprochen hatten, hatte sich Yuna nach und nach von dem Traum verabschiedet. Eine Reise in das Land ihrer Träume kostete ein Vermögen – ein Vermögen, für das Jiros Gehalt nie gereicht hatte. Zumal nicht nur das Wohnen in Japans Metropole fast unerschwinglich war. Zumindest wenn man auf eine halbwegs normale Wohnung Wert legte und nicht in einer Bruchbude hausen wollte.
Vielleicht, so hatte Jiro manchmal gedacht, sollten wir uns doch von den alten Zöpfen trennen. Yuna könnte als Lehrerin arbeiten ...
Aber auch das hatten sie nie ausdiskutiert. Wie so vieles andere auch nicht.
»Ja, traumhaft«, antwortete Jiro nun, nachdem er viel zu lange geschwiegen hatte.
Er musste sich zwingen, zu lächeln. Aber Yuna war so euphorisch, dass sie hoffentlich gar nicht mitbekam, dass er mit den Gedanken ganz woanders war.
»Wie bist du überhaupt auf dieses Restaurant gekommen? Ich meine, waren wir überhaupt schon mal hier in Shinjuku?«
»Ein Tipp eines Kollegen«, log Jiro. »Und da dachte ich, ich mache dir eine Freude. Immerhin ist heute unser fünfundzwanzigster Hochzeitstag!«
Yuna machte ein bestürztes Gesicht. Dann schlug sie sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. »Ich Riesenrindvieh! Das habe ich total vergessen.«
Jiro rang sich ein Schmunzeln ab. »Dafür habe ich ja daran gedacht, Liebes.«
Sie lächelte ihn über den Tisch hinweg an. »Das mache ich wieder gut. Der Abend ist ja noch lang. Und die Nacht auch ...«
Sie ist so schön, dachte er voller Schmerz. Diesmal musste er sich nicht verstellen, als er sie bewundernd ansah. Das schwarze, schulterlange Haar glänzte wie Ebenholz. Die gleichmäßigen Gesichtszüge waren noch immer faltenlos. Eine Perlenkette schmückte den schlanken Hals. Das orangefarbene Kleid ließ die schmalen Schultern frei und lockte mit nackter Haut – gerade so viel, dass jeder Mann sie noch begehrenswerter finden musste. Ihm waren die Blicke nicht entgangen, die ihr ab und zu von den Nachbartischen zugeworfen wurden.
Ich habe sie nicht verdient, dachte er bitter.
»Was guckst du denn auf einmal so leichensauer?«, fragte sie verdutzt.
»Ach, nichts, ich ...«