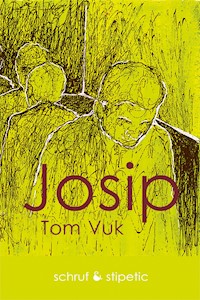
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schruf & Stipetic
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Josip mit einem der ersten Gastarbeiterzüge in Stuttgart ankommt, bringt er außer Speck und Apfelstrudel auch eine eigene Geschichte mit. Seine Vorfahren erlebten den kroatischen Bauernaufstand, den Kampf an der russischen Front im Ersten Weltkrieg, die Gründungen Jugoslawiens und das Leben der Partisanen im Zweiten Weltkrieg. Dabei ist Josip seit seiner Jugend bemüht, sich dem archaischen Leben und den Fehden in seiner Familie zu entziehen. Er verlässt das heimatliche Zagorje; auf seinem Weg liegen eine erste und eine zweite Liebe, eine Wahlfamilie, aber auch Vorbilder, die ihn immer wieder enttäuschen und schließlich dazu zwingen, einen Weg für sich ganz allein zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Tom Vuk
JOSIP
Tom Vuk: Josip
© schruf & stipetic 2022
www.schruf-stipetic.de
© 2022 Tom Vuk
Satz, Layout und Covergestaltung: JBC
Verwendete Illustration: Natalia Borcic
ISBN 978-3-944359-66-3
Das Gedicht Verlorener Glauben von France Preseren wird in der deutschen Übersetzung von Anton Pace von Friedensberg zitiert.
Boris Vians Lied Fais-moi mal, Johnny wird zitiert mit freundlicher Genehmigung der Cohérie Boris Vian, Paris. Einige Zeilen daraus wurden für diese Ausgabe neu ins Deutsche übersetzt.
Das Lied Seit ich ihn gesehen von Robert Schumann ist eine Vertonung von Adelbert von Chamissos gleichnamigem Gedicht.
Vervielfältigung und gewerbliche Nutzung nur nach ausdrücklicher Genehmigung der schruf & stipetic GbR
Inhalt
Widmung
Kapitel Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Danksagung
Über den Autor
Für meine Familie
Prolog
„Wiiiiiiiiii…” Das hysterische Zischen und Pfeifen der Lokomotive riss Josip aus einem unruhigen Schlaf. Er schreckte auf, rieb sich die Augen und blickte verschlafen aus dem Fenster. Die ganze Nacht hatte er versucht, etwas Schlaf zu finden, die Arme auf dem Koffer verschränkt, den er aus Sorge, er könnte gestohlen werden, auf seinem Schoß hielt, seine Jacke als Kissen zwischen Kopf und Abteilfenster. Er verfluchte den Riss im Plastikbezug der Sitzbank, der immer noch seinen Hintern quälte.
Wie eine Kulisse zog im Morgengrauen eine Landschaft an ihm vorbei, die dem heimatlichen Zagorje ähnelte und ihm, dem Fremden in der Fremde ein warmherziges Willkommen zurief. Er konnte es kaum erwarten, endlich anzukommen. Mit zusammengekniffenen Augen sah er aus dem Fenster. Hügel und Wälder in schier unendlichen Variationen von Grün erstreckten sich bis zum Horizont. Sie begrenzten mit weicher Kontur Wiesen, auf denen sich blasse Schleier von Morgennebel allmählich verflüchtigten. Rehe huschten vorbei wie beiläufig auf eine Leinwand geworfene Farbtupfer. Unmittelbar hinter dem Bahndamm glitten verschwommen Maisfelder vorüber, gelb leuchtend in der hinter den Wäldern aufgehenden Sonne. Sie entlockten Josip ein Lächeln. Er entdeckte Weinberge an steilen Hängen, gestützt von massivem Rebmauerwerk, Zeugnis meisterlichen Winzerhandwerks, das ihm Respekt abnötigte. Mohnblüten verzierten wie Blutstropfen das frühmorgendliche Panorama, und Josip erinnerte sich daran, wie er als Kind mit der Mutter am Wegesrand fasziniert Mohnblumen betrachtet hatte, sie befühlt und gerätselt hatte, wie es der Natur nur gelingen konnte, dieses prachtvolle Rot zu erschaffen. „Das ist das Blut der Erde”, hatte die Mutter gesagt und den kleinen Josip ungeduldig weitergezogen.
Im Abteil wurde es lebhaft. Josips Mitreisende kramten in Taschen und Koffern nach einem Frühstück. Auch Josip öffnete seinen Koffer. Er hatte nicht viel mitgenommen. Eine Hose, ein Hemd, einen Pullover, Unterwäsche, Socken und seinen Toilettenbeutel. Dazu noch ein Päckchen, das seine Mutter ihm vor der Abreise geschickt hatte, samt einem Brief, den Josip schon dreimal gelesen hatte und inzwischen auswendig kannte.
Mein Junge, schrieb sie. Ich weiß alles. Vetter Stipe hat mich angerufen. Wie konntest du dich nur so versündigen? Ich bin zur Beichte gegangen und habe dem Pfarrer alles erzählt und ihn um Rat gebeten, damit der Herrgott dir verzeiht. Ich habe eine Kerze in der Kirche für dich angezündet, zu Ehren des heiligen Antonius, und ich soll vierzig Tage lang jeden Tag einen Rosenkranz für dich beten. Dann soll ich nach Marija Bistrica fahren und dort um den Segen der Mutter Gottes bitten. Ich habe dann noch vierhundert Dinar gespendet zum Wohle der Kirche von Bistrica. All das tue ich für dich. Du bereitest mir großen Kummer. Das Leben ist schon schwer genug. Der Hof, die Tiere, der Laden. Manchmal hilft mir der Drago, das Holz zu hacken, oder der Junge von den Kovacevics greift mir im Laden unter die Arme. Aber all das hilft nicht. Meine Glieder schmerzen, sodass ich sie mir manchmal ausreißen mag. Jeden Abend sitze ich in der Stube und weine. Und jetzt tust du mir das auch noch an. Habe ich nicht immer alles für dich getan? Bitte melde dich kurz, wenn du da bist, damit ich weiß, dass du gut angekommen bist. Ich zünde ein Kerzlein für dich an und stelle es ins Fenster. Möge Gott dich behüten auf all deinen Wegen. Deine Mutter.
Außer dem Brief hatte sie ihm eine Salami, einen Ranken Speck und einen Apfelstrudel geschickt. Die Salami duftete nach Knoblauch, Paprika und Pfeffer. Der Speck lag schwer und fettig in seiner Hand. Der Strudel, gefüllt mit Rosinen, Quark und Apfelstücken, versetzte ihn in seine Kindheit zurück. Er atmete den Duft der Köstlichkeiten aus der Heimat ein, schnitt mit einem Taschenmesser feine Streifen von Salami und Speck ab und aß sie langsam und mit Genuss. Zum Nachtisch riss er mit den Fingern Stücke vom Apfelstrudel ab und stopfte sie sich gierig in den Mund. Mit jedem Bissen verzehrte er ein Stück Heimat, kostete die dunkle krümelige Erde, in der der Weizen wuchs, aus dem das Mehl gewonnen, mit dem der Strudel gebacken wurde, schmeckte das Gras, das die Rinder auf den Weiden am Dorfrand fraßen, damit sie wohl gediehen und ihr Fleisch zu herrlicher Salami verarbeitet werden konnte, roch die Buchenholzspäne, über denen der feine Speck geräuchert wurde. Josip schloss die Augen und wurde eins mit der Landschaft des Zagorje. Als wäre er ein Teil des Ivancica, des höchsten Bergs in diesem Landstrich, erwuchs aus ihm eine Eiche, reckte und streckte sich, trieb ihre Wurzeln in die Erde, wand ihre dicken, knorrigen Äste zu einer ausladenden Krone, dem Himmel entgegen.
Es hieß, dass eine Eiche hundert Jahre wächst, hundert Jahre lebt und hundert Jahre stirbt. Josip sehnte sich nach dieser Ewigkeit. Er seufzte, leckte sich die klebrigen Finger ab und verstaute das Päckchen mit den Köstlichkeiten wieder im Koffer, den er in die Gepäckablage wuchtete. Dort gesellte sich sein Koffer zu denen seiner Mitreisenden. Koffer in den verschiedensten Variationen. Lederkoffer, Pappkoffer, Holzkoffer, in allen Farben und Ausführungen, braun, schwarz, grün, rot, mit Riemen, Schnallen und Griffen, mit Holzleisten und Metallbeschlägen. Die Koffer waren so verschiedenartig wie ihre Besitzer und jeder erzählte eine eigene Geschichte.
Gegenüber von Josip, an der Abteiltür, saß ein Mann, der die ganze Zeit rauchte. Er war um die fünfzig, trug einen Anzug mit Hemd und Krawatte, schwarze Lederschuhe und hatte seinen Hut während der gesamten Fahrt nicht abgenommen. Trotz seines stattlichen Äußeren konnte er seine einfache Herkunft nicht verbergen. Seine Fingerkuppen waren ganz gelb vom vielen Rauchen und der gallige Geruch des Nikotins drang aus jeder Pore seiner Haut und jeder Faser seiner Kleidung. Neben seinen ausgeprägten Wangenknochen und der Hakennase bemerkte Josip die schwieligen Hände, die einst beherzt Feldhacke, Sense und Heugabel geführt hatten im Jahreslauf der Natur; von nun an würden sie Maschinen bedienen, am Fließband und in Schichtarbeit, das brodelnde Eisen aus dem Topf in die Gießpfanne ablassen in der unerträglichen Hitze des Hochofens, geblendet vom gleißenden Licht; Beton mischen und Stein auf Stein setzen für Häuser, deren Bewohner er nie kennen würde.
Als der Bauer seinen Koffer öffnete, um sich mit einer weiteren Schachtel Zigaretten zu versorgen, erkannte Josip mehrere Stangen Drina Filter neben einer Flasche Sliwowitz, die zwischen den Kleidungsstücken schimmerte wie eine verlorene Silbermünze im braunen Ackerboden.
Auch der verwegene junge Mann, der Josip gegenüber mit verschränkten Armen in seinem Sitz lümmelte, blickte erwartungsvoll hinüber. In seinem karierten Sakko, Jeans und Lederstiefeln wirkte er wie ein Halbstarker aus Zagreb oder Ljubljana. Große, dunkle Augen, mit denen er sein Gegenüber fixierte, buschige Brauen und ein breiter Kiefer unterstrichen sein draufgängerisches Äußeres. Großzügig bot der Bauer ihm ein Gläschen Sliwowitz an. „Selbst gebrannt”, sagte er, und die beiden prosteten sich zu: „Zivjeli!”
Der Halbstarke nestelte in seiner Sakkotasche herum, fingerte eine Fotografie heraus und hielt sie dem Bauern vor die Nase. „Eine NSU Max 250. Das beste Motorrad, das es gibt. Die kostet zweitausend Deutsche Mark. Die kauf ich mir von dem Geld, das ich in Deutschland verdiene, und dann geht’s wieder nach Hause.” Stolz zeigte er das Bild in die Runde.
Dabei beugten sich die beiden Männer vor, über die junge Frau mit auffälliger Bienenkorbfrisur zwischen ihnen hinweg. Sie trug einen hellen Pullover mit kurzen Ärmeln und einen dunklen Rock, der ihre Knie, die sie übereinandergeschlagen hatte, entblößte. Scheinbar teilnahmslos blätterte sie durch Modezeitschriften. Dabei leckte sie beim Umblättern damenhaft den Zeigefinger an, und Josip fielen ihre rot lackierten Fingernägel auf. Die Bilder in den Zeitschriften, Aufnahmen von mondänen Mannequins, versprachen Schönheit, Eleganz und Extravaganz, ein Leben jenseits der dörflichen Tristesse, der Rückständigkeit von Kopftuch, Kittelschürze und Strumpfhosen. Sie zeigten ein Leben von Welt, in Glück und Schönheit, ein Leben, das kein Leid kennt, kein Alter, keine Krankheit, keinen Tod, ein ewiges Leben.
Nach einer Weile öffnete die junge Frau knisternd eine gold-braun gestreifte Schachtel mit der Aufschrift Bajadera. Andächtig wickelte sie eine Nougatpraline aus und schob sie sich in den Mund. Josip stellte sich das Aroma von Walnüssen, Mandeln und Haselnüssen vor, das ihr auf der Zunge zerging. Als sie die schmachtenden Blicke ihrer Mitreisenden bemerkte, ließ sie mit einem Lächeln die Schachtel herumgehen, und so fanden sich die Fahrgäste vereint in der süßen Erinnerung an Feiertage in der Kindheit, denn nur zu ganz besonderen Anlässen wurde diese Köstlichkeit gereicht.
Neben Josip saß ein weiterer junger Mann, mit vollem, dunklem Haar und ernstem Gesicht. Er trug einen hellblauen Pullover über einem weißen Hemd mit Krawatte und war in ein Buch vertieft. Josip versuchte unauffällig, den Titel zu erkennen, und entzifferte schließlich auf dem Buchrücken in verzierten Lettern Ivo Andric – Die Brücke über die Drina. Das dicke Buch wog bestimmt schwer in den Händen des Bücherwurms. Hunderte Seiten voller Muttersprache, vertrauter Schrift und vertrautem Klang, hier fand sich alles, von den ersten Lauten, die ihm die Mutter beigebracht hatte, über die Kringel und Schleifen, die er in der Volksschule mit Kreide auf eine Schiefertafel gemalt hatte, bis hin zum vielstimmigen Chor des Palavers der Alten auf dem Hof.
Bald würden diese vertrauten Stimmen, die ihm so nah und selbstverständlich waren wie der eigene Herzschlag, verstummen, ein anderer, fremder Klang, hart und unmelodisch, würde an sein Ohr dringen. Aus einem „dobar dan” würde ein „Guten Tag” werden, aus einem „Kako se zoves?” ein „Wie heißt du?” und aus einem „Kako si?” ein „Wie geht’s dir?” Die Welt jenseits des vertrauten Miteinanders seiner Landsleute würde zu einer anderen werden, weil nichts mehr sein würde, was es einmal war.
„Herrgott noch mal, warum versteht mich denn kein Mensch!”, würde der Bücherwurm fluchen. Fremdheit, dein Name ist Sprache. Mit Händen und Füßen, wild grimassierend in einer unbeholfenen Pantomime, gepaart mit unverständlichen Lauten, würde er versuchen, sich verständlich zu machen, und einsam scheitern. Vielleicht würde er sich eines Tages das Geheimnis der fremden Sprache erschließen, vielleicht würde er sie aber auch nie erlernen. Die Muttersprache blieb immer die Muttersprache. Für den jungen Mann würde das Buch zur Muttersprachen-Schatztruhe werden, in der er all die Wörter, Klänge und Bedeutungen verwahrte und behütete, eine Schatztruhe, die er öffnete und die Wörter, Silben, Konsonanten und Vokale freiließ, ihnen verzückt zuhörte, wie sie aufstiegen und entschwebten und eine Melodie formten, die in der Ferne verklang.
Gegenüber dem rauchenden Bauern saß eine junge Frau in einem ärmellosen Kleid mit lockigem Haar und anmutigem Profil, schüchtern bemüht, den derben Blicken ihres Gegenübers auszuweichen. In ihren zarten Händen hielt sie ein Medaillon und betrachtete darin das Bild eines Kleinkindes. Sie sprach leise mit der Frau schräg gegenüber, der mit der Bienenkorbfrisur, und so erfuhr Josip, dass die junge Mutter ihr Kind bei der Großmutter zurückgelassen hatte, um in Deutschland zu arbeiten und Geld zu verdienen. „Und der Vater?”, erkundigte sich die andere. Die junge Mutter zuckte mit den Achseln. Sie wolle in einem Jahr wieder zurück und ihr Kind nachholen, und wenn sie es im Zug nach Deutschland schmuggeln müsse. Alles, was ihr für die Zeit der Trennung blieb, war das Medaillon mit einem hübsch verzierten Rahmen an einer einfachen Halskette und ein Foto, kaum größer als eine Hundert-Dinar-Münze, in das der traurige Blick der jungen Frau tropfte. Sie hielt es wie eine Kostbarkeit. Zurück blieb ein Kind auf dem Schoß der Großmutter, das nicht verstand, wo die Mutter war, und weinte, und die Großmutter liebkoste es, trocknete ihm die Tränen mit ihren Küssen, und das Kind gewöhnte sich daran und ließ sich von der Großmutter zum Trost mit Schnitzel, Kartoffeln und Kuchen vollstopfen, und irgendwann würde es „Mutter” zur Großmutter und „Tante” zur Mutter sagen, und der Mutter würde es das Herz zerreißen.
Sie alle, der rauchende Bauer, die junge Frau mit der Bienenkorbfrisur, der verwegene junge Mann mit dem Motorrad, der Bücherwurm und die traurige Mutter, hatten ihr Zuhause verlassen, hatten Mütter, Väter, Kinder, Freunde, Ehepartner, Verliebte und Verlobte zurückgelassen, um in der Fremde neu zu beginnen. Nun war Josip einer von ihnen.
Mit nichts als einem Koffer, würde es später vielleicht heißen. Doch diese Koffer waren verzaubert. Öffnete man sie, so offenbarte sich eine ganze Welt – Erinnerungen, Geschichten und Träume, Gerüche, Geschmäcker und Farben führten einen Jahrhunderte zurück oder nur einen Augenblick, an unbekannte Orte, zu Menschen, die schon lange tot waren, und sogar zu Menschen, die noch nicht einmal geboren waren.
Dann knisterte der Lautsprecher und eine scheppernde Stimme sprach zu ihnen. Sie verstanden nur das Wort „Stuttgart”. Das reichte, um alle in hektische Betriebsamkeit zu versetzen. Eifrig rafften sie ihr Gepäck zusammen. Der Bauer stopfte die Sliwowitz-Flasche zwischen die Kleidungsstücke und verschloss seinen Koffer, indem er ihn auf seinen Sitzplatz warf und sich daraufsetzte. Die junge Frau mit der Bienenkorbfrisur pickte mit ihren lackierten Fingernägeln einen kleinen Taschenspiegel aus ihrer Handtasche und richtete sich mit prüfendem Blick und geschürzten Lippen Frisur und Make-up. Der Halbstarke zog einen Taschenkamm aus seinem Sakko und brachte seine Frisur in Ordnung. Die junge Mutter legte sich vorsichtig die Kette mit dem Medaillon um und Josip zog die Gurte an seinem Koffer fest. Nur der Bücherwurm las in aller Muße weiter. Schon zogen die Vorboten der neuen Stadt draußen vorbei. Josip und die anderen drückten sich ans Abteilfenster. Pittoreske Häuser mit Gärten, die bis zum Bahndamm reichten. Mütter hängten Kleider an die Leine, die wie bunte Fahnen im Wind flatterten. Kinder rannten dem Zug nach und winkten.
Es folgten prächtige Jugendstilbauten mit verspielten Fassaden, wie sie Josip aus Zagreb kannte, graue Wohnblocks, mit Menschen, die am Fenster lehnten und melancholisch auf die Gleise schauten, moderne Bürogebäude mit vielen Reihen toter Fenster, aber auch vereinzelt Ruinen und Trümmergrundstücke, mit Würstchenbuden und Barackenläden bebaut. Aufgeregt zeigten die Reisenden auf einen imposanten Turm auf einer Erhebung am anderen Ende der Stadt, dessen Spitze wie der Stachel einer Biene den Himmel in den Hintern stach. Schließlich kam der Bahnhof in Sicht, auf dessen Turm ein dreizackiger Stern prangte wie das Kreuz auf einem Kirchturm und die Reisenden andächtig verstummen ließ. Mit offenen Mündern folgte ihr Blick dem Wahrzeichen.
„Der Mercedes-Stern”, flüsterte der Halbstarke und bekreuzigte sich. Als der Zug schließlich im Bahnhof mit quietschenden Bremsen zum Stehen kam, gab es kein Halten mehr, der Halbstarke schob das Abteilfenster auf, und gemeinsam streckten sie die Köpfe raus, strahlten und winkten den unbekannten Menschen auf dem Bahnsteig zu wie heimkehrende Soldaten oder die Gewinner der Fußballweltmeisterschaft. Und so öffneten sich auch die Fenster der anderen Abteile, „Ratsch, Ratsch, Ratsch”, wie ein gewaltiges Domino, ausgelöst durch die Ankunft des Zuges. Köpfe schoben sich heraus, mit Augen, die leuchteten, und Mündern, die lachten, Arme erschienen, mit Händen, die winkten, und Taschentüchern, die flatterten, und Koffern, die herausgereicht wurden, und alles verband sich zu einer wilden Choreografie. Sie alle waren ergriffen von diesem einen Moment, die Zeit stand still, die Welt lag ihnen zu Füßen. Und die Menschen auf dem Bahnsteig teilten diesen Augenblick mit ihnen, winkten zurück, hüpften vor Freude, streckten und reckten sich, um einen Blick auf die Ankömmlinge zu erhaschen.
Dann schoben und drückten sich Josip und seine Reisegefährten aus dem Abteil, riefen aufgeregt durcheinander, lachten und fluchten, drängten mit den anderen Passagieren durch den engen Gang und fielen auf den Bahnsteig wie Kartoffeln aus einer Kartoffelhorde. Hunderte Menschen strömten in entgegengesetzte Richtungen über den Bahnsteig. Die einen versuchten, zur Bahnhofshalle zu gelangen, die anderen zu den Zügen, wieder andere setzen sich auf ihre Koffer und warteten, Männer und Frauen, Väter und Söhne, Mütter und Töchter fielen sich in die Arme, ein Stimmenwirrwarr aus vielen Sprachen wirbelte durch die Menschenmenge, Durchsagen in einem unverständlichen Singsang schepperten blechern. Und irgendwo in diesem Tumult hörte Josip schließlich eine Stimme, die seinen Namen rief.
1
Als Josip vierzehn Jahre alt war, kam er zum ersten Mal einem Mädchen nahe. Es war ein Sommer wie alle Sommer zuvor. In der wenigen freien Zeit spielte er mit den Jungs aus dem Dorf Fußball. Barfüßig in abgetragenen Sandalen kickten sie einen Ball, den sie aus alten Strümpfen ihrer Mütter gewickelt hatten, in den schmalen, vom Regen und von den mächtigen Rädern der Leiterwägen zerfurchten Schotterwegen auf kaum einen Meter breite Tore, die mit Steinen markiert waren. Das Spiel war schnell und ruppig, der Ball sprang unkontrolliert hin und her, Stürze mit bloßen Knien in den Schotter waren schmerzhaft und blutig, aber auf diese Art und Weise lernte man Technik und Zähigkeit.
Nach dem Spiel standen die Jungen dann schweigend hinter einem Stall oder am Rande eines Maisfelds im Kreis, scharrten mit den Füßen im trockenen Boden und ließen eine Morava Filter oder eine Drina Special Filter, die dem Vater aus der Jacke stibitzt worden war und die den Jungen als Zeichen der Männlichkeit und des Erwachsenwerdens galt, herumgehen. Dabei ahmten sie ihre Väter nach. Ihre Väter, die schwiegen, und wenn sie nicht schwiegen, fluchten, ihr „Jebem ti” und „Picku materinu” hinausbellten, die den Rotz mit dem Daumen aus der Nase bliesen und ständig ausspuckten, die ihren Söhnen, wenn sie nicht spurten, den Hintern mit dem Gürtel versohlten, sie mit dem Handrücken ohrfeigten, die rauchten und dabei nie ihre Kippe aus dem Mund nahmen, die Bier aus der Flasche tranken, breitbeinig, die Hände in die Hüften gestemmt.
Es war der erste Tag der Sommerferien, als Dragan Josip und die anderen Spielkameraden um sich scharte.
Dragan war klein und feist. Sein Kopf war groß und rund wie ein Kürbis, er hatte strohiges blondes Haar und trug eine hässliche Brille, die seine Augen wie die eines Karpfens im Aquarium erscheinen ließ. Außerdem bohrte er ständig in der Nase, bewahrte den Ertrag seiner Ernte portionsweise unter der Schulbank auf und aß immer wieder davon. In der Schule war Dragan – außer in Biologie – erbarmungswürdig schlecht. Die Lehrer verzweifelten an ihm, weil sie wussten, dass er im Grunde pfiffig war. Dragan hatte ein morbides Interesse an Tieren, das seinen Altersgenossen unheimlich war, sie aber wie alles Unheimliche auch anzog. Er fing alle Arten von Insekten und Kleintieren, Bienen, Regenwürmer, Mäuse und Frösche, tötete und sezierte sie, um ihr Aussehen, ihren Körperbau und ihre Organe zu untersuchen. Einmal verbrachte Josip einen ganzen Nachmittag mit Dragan an einem Teich, wo sie stundenlang Frösche beobachteten. Dragan kannte sämtliche Froscharten mit lateinischem Namen und erklärte Josip in allen Einzelheiten, wie sich Frösche bewegen, ernähren und fortpflanzen. Dragans Begeisterung für die Tierwelt wurde mit Einsetzen der Pubertät durch ein zwanghaftes und mitteilsames Interesse an Sexualität abgelöst – mit Vorliebe zeichnete Dragan Geschlechtsteile und besonders anstößige Sexualpraktiken, mit der gleichen Detailverliebtheit und chirurgischen Präzision, mit der er Tiere auseinandernahm. Er besaß eine beachtliche lose Blattsammlung solcher illustren Darstellungen, die er gerne, gewissermaßen als Zugabe zur gemeinsam gerauchten Zigarette nach einem Fußballspiel, präsentierte.
„Ihr bekommt eine Chance, wie ihr sie noch nie in eurem Leben hattet”, verkündete Dragan. In aller Ruhe zog er an seiner Zigarette und genoss die Ungeduld der anderen, bevor er das nächste Häppchen servierte. „Meine Cousine Dragica aus Zagreb kommt zu Besuch.”
Die anderen Jungs zappelten herum, fummelten an ihrem Schritt wie kleine Kinder, die pinkeln müssen.
„Ihr dürft euch auf sie drauflegen und sie überall berühren.”
Die Aussicht auf ein derart aufregendes Erlebnis bemächtigte sich in den folgenden Tagen der Fantasie aller und regte die wildesten Vorstellungen an, die nachts einsam in feuchten Delirien halluziniert und tagsüber in der Gruppe großmäulig zum Besten gegeben wurden. Josip schwieg, wenn alle in der Runde zum großen Ergötzen Dragans ihre Fantasien schilderten, er ging ins Maisfeld, stellte sich vor, wie er es mit Dragica trieb, und holte sich einen runter. Das war’s.
Dann war es so weit. Dragica fiel Josip und den anderen schon vormittags beim Fußballspielen auf, als sie erhobenen Hauptes, ohne die Jungen eines Blickes zu würdigen, in viel zu großen hochhackigen Schuhen, mit schmutzigen Knöcheln, wie ein Storch im Salat, aber mit bemühter Eleganz und Koketterie mitten durchs Dorf stolzierte – für Josip und seine Freunde schwebte sie – und die Jungen zu einer Unterbrechung ihres Spiels zwang. Man sah gleich, dass sie aus der Großstadt kam. Ihr blondes Haar, das ihr rundes Gesicht mit den auffallend großen blauen Augen, den fein nachgezeichneten Brauen und den vollen rot geschminkten Lippen säumte, war modisch geschnitten wie bei den Filmstars in den Zeitschriften ihrer Mütter, die die Jungen heimlich durchblätterten und sich daran ergötzten.
Dragica trug einen hellbraunen Rock aus gutem Stoff, der ihr knapp über die nackten Knie reichte, und einen dunkelroten kurzärmligen Pullover mit weitem Ausschnitt, der einen Blick auf ihr Dekolleté ermöglichte und die erstaunliche Größe ihrer Brüste andeutete. In ihrem Windschatten verbreitete sie den betörenden Duft eines extravaganten Parfüms, in eigenartigem Widerspruch zu dem vertrauten bäuerlichen Gestank nach Heu, Mist und Hühnerscheiße. Ein Duft, der sich der Jungen bemächtigte und sie in eine andere Welt entführte, weg von den geduckten Bauernhäusern, den kaputten Wegen, den fliegenumschwärmten Misthaufen, hinaus in die Welt der Großstadt, die sie nur von Bildern kannten, mit ihren prächtigen Jugendstilbauten, den Boulevards, auf denen sie Dragica flanieren sahen, wie sie jungen Männern in gepflegter Kleidung den Kopf verdrehte, hin zu den Parks, bevölkert von jungen Pärchen, die sich Hand in Hand unter Kastanienbäumen verträumt in die Augen schauten, den Cafés und Restaurants mit ihrer bedächtigen Betriebsamkeit, voller junger Menschen, die sich bei Kaffee und Limonade unterhielten und entspannt in die Sonne blinzelten. Und für einen Moment stand die Welt still. Dann entschwand Dragica auch schon hinter einem Haus und der Zauber war verflogen. Die Jungen schauten an sich herab, auf ihre geflickten Hosen, die blutigen Knie und schmutzigen, verschrammten Füße in zerschlissenen Sandalen und erröteten vor Scham. Außer Dragan, der grinste schamlos. Die anderen rempelten sich an und kicherten. Josip dribbelte ungeduldig und teilnahmslos mit dem Ball.
„Lasst uns weiterspielen”, blaffte er die anderen an.
Dragans Grinsen strotzte nur so vor Genugtuung, er wusste, was in ihnen vorging. Er hatte mit den ausgewählten Glückspilzen abgesprochen, dass sich jeder zu einer bestimmten Uhrzeit, die er festgelegt hatte, vor dem Haus seiner Großmutter einfinden sollte. Er wollte auf jeden Fall vermeiden, dass sich alle gleichzeitig vor dem Haus rumtrieben und so Aufsehen erregten. Deshalb hatte er auch die Mittagszeit ausgewählt, in der die meisten Dorfbewohner in ihren kühlen Häusern blieben.
Als sich Josip in der Mittagshitze dem Haus näherte, stand es wie ein Trugbild in der flirrenden Luft. Nichts bewegte sich. Nur ein warmer Wind strich um die Häuser und raschelte leise in den Baumkronen. Irgendwo klapperte jemand mit Geschirr. Es roch nach Bratkartoffeln. Ein Rind brüllte in einem nahen Stall. Neben der Haustür stand eine Holzbank, auf der Dragans Großmutter oft saß und Bohnen schnitt, einem geschlachteten Huhn die Federn ausriss oder Strümpfe stopfte. Dabei unterhielt sie sich mit den Frauen aus dem Dorf, die vom Feld kamen, mit großen Körben voller Heu auf dem Rücken, die sie ächzend absetzten, froh über eine kleine Rast. Lautstark wurden Neuigkeiten, Gerüchte und Beschwerden ausgetauscht. Klagen, Fürbitten und Verschwörungen wurden zum Himmel geschickt mit der den Frauen des Zagorje so eigenen Modulation. An der weiß getünchten Hauswand bahnten sich Weinreben ihren Weg zum strohgedeckten Dach. Im Sommer waren die Trauben noch mattgrün und fest wie rohe Erbsen, die Kinder pflückten sie und bewarfen sich damit, bis Dragans Großmutter aus dem Haus stürmte und ihnen fluchend Steine hinterherwarf. Aber im Herbst, da glänzten sie saftig und prall, und die Kinder kletterten auf die Bank, zupften auf Zehenspitzen die Trauben ab, rieben kurz den Staub ab und ließen sie sich in den Mund kullern.
Mit langsamen Schritten steuerte Josip die schwere Haustür an, die einen Spalt breit offenstand und ganz leicht knarrte. Unter Josips Sandalen sprangen einzelne Steinchen weg, er schaute auf seine Füße. Seine Zehen waren schmutzig, seine Knöchel verschrammt. Schmerzhaft brannte die Sonne auf seinen gespannten Nacken. Einen Schritt nach dem anderen setzte er auf die zwei Steinstufen zur Tür, hinter dem schmalen Spalt war es finster.
Dragan hatte ihm gesagt, er solle sich direkt nach rechts wenden, zum Schlafzimmer der Großmutter. Im Haus war es dunkel und kühl, alle Fensterläden waren geschlossen. Josip tastete sich an der kühlen Wand entlang. Als er die Tür erreicht hatte, zögerte er, ging in die Knie und blickte mit zusammengekniffenem Auge durchs Schlüsselloch. Im Dämmerlicht erkannte er das Fußende eines Bettes. An der Wand über dem Kopfende erahnte er den Ausschnitt eines Bildes, am rechten Rand seines Blickfelds einen Holzstuhl, auf dem Kleidungsstücke abgelegt waren. Er richtete sich wieder auf, öffnete die Tür und trat ein. Der Boden knarzte und Josip hielt inne. Durch die Schlitze der geschlossenen Fensterläden drangen Streifen von Licht, die sich ihren Weg quer durch das Zimmer bahnten. In diesen Strahlen wirbelte Staub wie Schwärme von Insekten in der Abendsonne. Josips Augen waren noch geblendet vom Tageslicht und gewöhnten sich erst langsam an die Dunkelheit. Allmählich hellte sich der Raum auf und Bilder tauchten aus der Dunkelheit auf. Es erschien ihm ein bärtiger Jesus Christus mit langem, gewelltem Haar im hellen Gewand, der wie zum Segen die rechte Hand erhoben hatte. Aus seinem leuchtenden Herzen strömte wärmendes Licht in das Zimmer. Josip erschrak und bekreuzigte sich.
„Er meint es gut mit mir”, dachte er. „Wenn Gott die Menschen gemacht hat, dann hat er auch ihre sündigen Gedanken gemacht, und ich muss mich nicht dafür schämen.”
Sein Blick wanderte durch den Raum. Es roch süßlich nach Schweiß. Auf dem Bett konnte er einen Schatten ausmachen. Er vernahm Dragicas leises Atmen. In den Lichtstreifen, die das Bett unterteilten, erkannte er ihren Oberkörper, sie trug den weinroten Pullover, ein Stück weiter ihre Hüften in dem braunen Rock, ihre Knie und blassen Waden auf einem weißen Laken. Josips Herzschlag beschleunigte sich. Er schluckte und schlich seitlich an das Bett heran. Der Boden knarzte erneut unter seinen Füßen. Dragica hatte die Augen geschlossen. Ihre Arme lagen auf der Seite und sie war barfuß. Ihm schien, als ob sie schliefe. Ihr betörender Parfümduft vermischte sich mit ihrem Schweißgeruch. Er erinnerte Josip an den Geruch seiner Mutter, wenn sie geschwitzt hatte und ihn umarmte. Doch Dragicas Geruch war anders, in ihm steckte der Geruch dieses Sommers. Josip streifte mit den Füßen die Riemen seiner Sandalen ab. Die Holzdielen piekten an seinen nackten Füßen. Dann kniete er sich mit dem linken Knie auf das Bett, das gespannte Laken gab nach, Josip bedauerte das, weil es gespannt so schön und makellos ausgesehen hatte, er zog das rechte Bein nach, stützte sich vorsichtig mit beiden Händen ab und legte sich auf Dragica. Sein Kopf sank in das weiche Kissen ihrer Brust. Sein Bauch tauchte in ihren Schoß, mit seinen Zehen spürte er ihre Beine. Er bemerkte das Auf und Ab ihres Oberkörpers und konnte ganz deutlich ihren Herzschlag hören, ein mächtiges Trommeln, das einem eigenartigen Takt folgte. In ihren Achselhöhlen entdeckte er aus dem Augenwinkel die Schatten ihres Schweißes auf dem Pullover, kleine Monde, die nur für ihn schienen. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er seine Arme unbeholfen von sich gestreckt hatte. Er zog sie heran und ließ sie unter Dragicas Schultern gleiten. Seine Hände streiften durch ihr Haar und er dachte kurz an Bilka mit dem goldenen Haar aus dem Märchen, das seine Mutter ihm oft erzählt hatte. Dann verharrte er. Er hörte das Ticken des Weckers auf dem Nachttisch, die Feder sprang mit jeder Bewegung des Sekundenzeigers schwirrend hin und her. An seinem Kinn fühlte Josip den Büstenhalter unter Dragicas Pullover. Es war eigenartig, so etwas Hartes, Unbequemes in diesem üppigen Weich zu spüren. Er verfolgte die Spur des Büstenhalters bis zu den Riemchen, die sich um ihre Schulterblätter spannten, und begann mit seinen Fingern daran zu schnippen. In diesem Moment verspürte er ein unruhiges Lupfen, ein Zeichen wie ihm schien, das ihm sagen wollte, die Zeit sei um. Josip glitt langsam von Dragica herunter und rutschte mit beiden Füßen auf den Boden. Noch einmal betrachtete er sie. Alles sah aus wie bei seiner Ankunft, nur das Laken war zerknittert. Er tapste zur Tür und drehte sich aus dem Zimmer, drückte ganz sachte auf die Klinke und schloss langsam die Tür. Dann schlich er auf Zehenspitzen aus dem Haus. Das Licht sprang ihm ins Gesicht, die Hitze versetzte ihm einen Schlag. Er rannte los. Hinter dem Plumpsklo am Maisfeld, holte er sich einen runter. Erst dann fiel ihm auf, dass er seine Sandalen bei Dragica vergessen hatte.
Dragica verließ Geckovec nach wenigen Tagen und kam nie wieder. Die Jungen sprachen noch einige Zeit über ihre Erlebnisse an jenem heißen Sommernachmittag, schwärmten von Dragicas Kurven, ihrem Duft, ihrem Liebreiz. Dann geriet sie allmählich in Vergessenheit, es gab andere aufregende Dinge. Doch jeder von ihnen bewahrte seine ganz persönliche Erinnerung an Dragica, mancher ein Lebtag lang.
2
Die Josics waren wie die meisten Familien im Zagorje über Generationen Bauern gewesen. Josips Urgroßeltern, Franjo und Milka, hatten noch die Leibeigenschaft erlebt. Sie hatten ein mühsames Leben geführt, mussten als Untertanen hohe Steuerabgaben leisten, waren dazu verpflichtet, Getreide, Obst und Wein abzugeben und Fronarbeit zu verrichten, vier Tage im Sommer, drei Tage im Winter, tagtäglich während der Erntezeit. So glich das Dasein, der Lauf eines Jahres, der Lauf der Jahre eines Lebens, über Jahrhunderte hinweg dem der Vorfahren.
Das Einzige, was sich über die Jahrhunderte änderte, waren die Namen der Feudalherren. Die Dörfer, Güter, Wälder, Grund und Boden des Besitzes Ivanec, zu dem Geckovec gehörte, wurden verkauft, vererbt und verteilt wie Handelsware, die Ländereien waren Spielball im Ränkespiel der Mächte zwischen den adligen Familien, den Petheös de Gerse, Erdödys und Krajacics, die sich das nahmen, von dem sie glaubten, dass es ihnen zustand. Die Bauernfamilien nahmen ergeben hin, wem sie untertan waren. Fron blieb Fron, ganz gleich, wie der Name der Herrschaft auch lautete.
Nachdem die Leibeigenschaft Mitte des 19. Jahrhunderts abgeschafft worden war, hatten die Josics, wie viele Familien, Haus und Land ihren ehemaligen Grundherren abgekauft. Doch die Schulden, die sie dafür aufnehmen mussten, zwangen sie, ihr Eigentum aufzuteilen. Vom Land blieb immer weniger übrig und allmählich löste sich ihre Gemeinschaft, die über Jahrhunderte Bestand gehabt hatte, auf. So erging es nicht nur den Josics, sondern auch vielen anderen Bauernfamilien. Die Menschen im Zagorje konnten bald von der Landwirtschaft nicht mehr leben.
Josips Vater pachtete den Gemischtwarenladen im Ort, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Das Leben seiner Familie richtete sich fortan nicht mehr nach dem immergleichen, natürlichen Rhythmus der Tages- und Jahreszeiten, sondern nach Öffnungszeiten, Warenlieferungen, Preisvorgaben und der Geißel der alles verschlingenden Bürokratie. Josips Vater war nicht mehr sein eigener Herr, worauf er immer stolz gewesen war. Das neue Leben ließ ihn entwurzelt, zerrissen und wie ausgespuckt zurück. Mit der Strenge und Verbitterung des Entwürdigten führte Dragec Josic das Geschäft, immer unter dem Druck der Vorgaben und der Willkür der Apparatschiks.
Josip war gerade mal so groß, dass er über die Ladentheke blicken konnte – ein wuscheliger Haarschopf, ein Paar misstrauisch zusammengekniffene Augen – da musste er bereits im Konsum mit anpacken. Seine Mutter Milena weckte ihn morgens um halb fünf. Es war noch dunkel und kalt in der Kammer, wenn sie ungeduldig an seiner Bettdecke zerrte und er sich schlaftrunken und unter Ächzen aus dem Bett wand. Eine Stunde später stand er gewaschen und mit einer Milchsuppe gestärkt im Laden und half beim Auspacken und Einsortieren der Waren, ging dann – im Sommer barfüßig, im Winter in einem alten, löcherigen Paar Schuhe – den Weg zur Schule, für den er, ohne zu trödeln, eine Dreiviertelstunde benötigte, und war mittags nach einer kräftigenden Mahlzeit wieder zur Stelle. Danach lieferte er auf einem klapprigen Fahrrad bis in den frühen Abend Waren aus und half anschließend noch in der Landwirtschaft. Die Josics besaßen noch immer einen kleinen Hof mit Vieh, etwas Ackerland und einen kleinen Weinberg – die mageren Reste des Besitzes ihrer Vorfahren, ein unansehnlicher Flickenteppich mehr oder weniger fruchtbaren Bodens. Sie bauten Mais, Kartoffeln, Kohl und Karotten an. Was die kümmerliche Landwirtschaft hervorbrachte, wurde verspeist, eingemacht und eingelagert, was übrigblieb, und das war nicht viel, verkauften sie im Laden und auf dem Wochenmarkt in Ivanec.
Josip mistete die Ställe aus, molk die Kühe, trieb sie auf die Weide, war beim Schlachten dabei und beim Verarbeiten des Fleisches, erntete auf den Feldern, und als er zwölf Jahre alt war, stand er bereits allein am Stand auf dem Markt und verkaufte das Gemüse, während sein Vater in der Gostilna mit Kameraden beim Bier saß. Am liebsten half Josip im Weinberg hoch über Geckovec, inmitten der sanften Hügel des Zagorje, das saftige Grün der Wiesen und Wälder bis zum Horizont um sich herum. Im Frühjahr, beim Biegen und Binden der Reben, ebenso wie im Herbst bei der Weinlese, verlor er sich in der Zeit. Das Binden erforderte sein ganzes Geschick, damit die Rebe nicht brach. Bei der Weinlese wiederum galt es, die Beeren sorgsam vom Stiel zu trennen. Nach getaner Arbeit saßen er und sein Vater dann auf einer Bank, blickten über die Weinreben auf das Dorf hinab und schwiegen.
Überhaupt sprach Josips Vater nicht viel, nicht im Weinberg und nicht zu Hause. Und wenn er sprach, dann waren es meist Zurechtweisungen und wüste Beschimpfungen, „Tu dies nicht!”, „Tu das nicht!”, „Du Hornochse, wie kannst du nur!” Ein „gut gemacht” gab es nie. Josip konnte es seinem Vater nie recht machen, egal, wie sehr er sich auch anstrengte. Dabei wollte er nichts anderes, als seinem Vater gefallen. Josip hätte sich gewünscht, dass sein Vater mehr mit ihm sprach. Aber auch die Väter seiner Freunde sprachen nicht viel. Sie fraßen ihren Gram in sich hinein und machten die Dinge mit sich selbst aus. Josip konnte sich das nicht erklären. Zum Glück war seine Mutter von einem ganz anderen Wesen. Wenn Josip nach einem langen Tag seiner Mutter in der Küche zur Hand ging, dann plapperte sie stets munter drauflos, erzählte dies und das, mit wem welche Nachbarin gerade wieder Streit hatte, wer gestorben war, wer ein Kind bekommen hatte. Josips Mutter kümmerte sich neben ihrer Familie auch aufopferungsvoll um Hilfsbedürftige in der Nachbarschaft. Sie ging einkaufen für die alte Lucija, brachte der kranken Franka Suppe vorbei und kümmerte sich um Verica, die frisch entbunden hatte. Und sie konnte gut zuhören. Ihren Mitmenschen tat es gut, Sorgen und Glück mit Milena zu teilen. Doch auch Milena sehnte sich nach Aufmerksamkeit. Und weil Dragec ihr nicht zuhörte, teilte Milena ihre Erlebnisse eben mit Josip. Für Josip spielte es keine Rolle, ob die Neuigkeiten von Bedeutung waren oder ob er den oft verschlungenen Pfaden ihres Erzählflusses folgen konnte. Hauptsache, er hörte ihr munteres Tremolo. Besonders mochte Josip, wenn seine Mutter Märchen erzählte – von Hexen und Tieren, Königen und Soldaten, Müttern und Töchtern, Vätern und Söhnen. Am liebsten mochte er das Märchen vom Schweinehirten Jozo und dem Ferkel Bilka, das eigentlich ein wunderschönes Mädchen mit goldenem Haar war.
Josips Mutter dachte sich aber auch selbst gerne Geschichten aus, erschuf aus dem Stegreif eine fantastische Welt, in der sich verwunschene Prinzen und Prinzessinnen, Geister und Bösewichte in den dunklen Wäldern des Bergs Ivancica tummelten. Besonders gerne hörte Josip die Geschichte von Katalin, der Tochter des Grafen von Milengrad.
Vor langer Zeit lebte in Milengrad das Mädchen Katalin. Sie war die Tochter des Grafen, eines herrischen Menschen und strengen Vaters. Aus Sorge um das Wohl seiner Tochter verbot er ihr, die Burg zu verlassen. So verbrachte Katalin die meiste Zeit in ihrer Kammer im Turm mit Blick auf die Hügel und Wälder des Zagorje und durfte sich nur im Burghof frei bewegen. Doch Katalin gelang es immer wieder, die Wachen zu überlisten und sich nach draußen zu stehlen. Dann streifte sie durch die Wälder rund um Milengrad, trippelte barfuß über das waldfeuchte Moos, lehnte sich verträumt an Bäume, legte sich ins Laub und spürte den weichen Boden an ihrer rosigen Wange. Doch ihr Vater erfuhr von ihren Streifzügen, er bemerkte feine Erdkrümel an ihren nackten Füßen und drohte ihr damit, sie für eine Nacht in den dunklen Wäldern des Ivancica auszusetzen, um ihr eine Lektion zu erteilen.
Als er sie wieder einmal nach einem ihrer Streifzüge ertappte, machte er seine Drohung wahr. Zwei Büttel des Grafen verbanden Katalin die Augen und geleiteten sie abends im Nachtrock auf den Berg, wo sie das Mädchen an einer verabredeten Stelle zurückließen. Als sie tags darauf zurückkamen, war Katalin verschwunden. Die Büttel mussten unverrichteter Dinge zurückkehren und dem Grafen die Nachricht vom Verschwinden seiner Tochter überbringen. Der Graf wurde krank vor Gram und Schuld und starb bald. Doch was war mit Katalin geschehen? Sie hatte sich in jener Nacht in einer Höhle versteckt, in der sie fortan lebte, um nicht von ihrem Vater und seinen Schergen gefunden zu werden. Tagsüber streifte sie durch den Wald, sammelte Pilze und Kräuter, von denen sie sich ernährte, und sprach mit den Rehen, Füchsen und Eulen, die ihr bald vertraute Gefährten wurden. Manchmal, wenn sie doch die Gesellschaft von Menschen vermisste und die Stille ihr zu schaffen machte, setzte sie sich auf einen Felsen vor der Höhle und begann zu singen, um eine Stimme zu hören, wenn es auch nur die eigene war. Ihr wunderschöner Gesang erfüllte den ganzen Berg und hallte zurück, ließ die Tiere des Waldes verstummen und lockte eines Tages auch den jungen Jagdgesellen Mio an. Katalin sah in seine blauen Augen und wollte fortan nicht mehr alleine sein. Sie erzählte ihm ihre Geschichte und Mio versprach ihr, sie zur Frau zu nehmen und mit ihr den Wald zu verlassen. Doch zuvor musste er noch einmal alleine in sein Dorf. Auf dem Weg stürzte er in eine Felsspalte und zerschmetterte am Grund. Katalin wartete vergeblich auf Mio und so beschloss sie, niedergeschlagen vor Kummer und Enttäuschung, in die Höhle zu gehen und sie nie wieder zu verlassen. Doch wenn der Wind durch die Bäume des Ivancica strich, glaubte man ihren Gesang zu hören, und immer wieder wurde behauptet, man hätte im Wald ein junges Mädchen im Nachtrock beobachtet. Der Geist von Katalin, er spukt noch heute auf dem Berg Ivancica.
Josips Mutter beteuerte zwar stets, dass die Geschichten sich tatsächlich so zugetragen hätten, doch Josip erkannte an ihrem Gesichtsausdruck, dass sie ihrer Fantasie entsprungen waren. Gleichwohl lag ihm selbst daran, die kühne Vorstellung nicht zu zerstören, und er spielte die Schimäre gerne mit. So standen Mutter und Sohn Seite an Seite in der Stube, Mutter schälte Kartoffeln, Josip spaltete Holzscheite und schob sie in den Ofen, es duftete nach Zwiebeln und Schmalz, die Erzählungen erfüllten den Raum, bis Josips Vater in die Stube stapfte und augenblicklich Stille einkehrte.
Saß Dragec dann missmutig am Tisch und stopfte sich mit einem großen Löffel schmatzend die Bratkartoffeln in den Mund, senkten Milena und Josip die Köpfe über ihren Tellern, sprachen kein Wort und wagten es nicht, ihm in die Augen zu schauen. Erst nachdem er die Stube wieder polternd verlassen hatte, kehrte das Leben zurück und Milena reichte Josip ohne große Worte ein Stück frischen Strudel zum Nachtisch. Manchmal sagte sie dann: „Vater meint es nicht so, er meint es nur gut.” Oder: „Vater war nicht immer so.” Oder: „Du musst ihn verstehen.” Josip konnte nicht wirklich etwas damit anfangen.
Nur einmal hatte er eine Ahnung davon bekommen, worauf sein Vater sein Leben und seine Entscheidungen gründete. Damals hatten Josip und sein Vater andächtig vor der Matija-Gubec-Linde neben der Kirche in Gornja Stubica gestanden und Dragec hatte stolz erklärt, dass Attila Josic, ein Vorfahre, an der Seite des berühmten Bauernführers Matija Gubec gekämpft hatte. Josip hatte sich an den Knien gekratzt und sich gefragt, warum die Menschen einen so alten Baum verehrten. Als ob der Vater den Gedanken seines Sohnes gelesen hätte, sagte er: „Sieh nur, sie ist zäh und unzerstörbar wie die Bauern des Zagorje. Hier ist unser Platz, hier gehören wir hin, was immer auch kommen mag.”
3
Eine aufgekratzte Menschenmenge trieb Attila Josic am 15. Februar 1573 durch die engen Gassen Zagrebs zum Platz des heiligen Marko. Die Menschen rannten, schoben, stolperten, trampelten übereinander hinweg wie panisches Vieh. In ihren fiebrigen Augen spiegelten sich Aufregung, Angst und Geifer. Der Geruch hitziger Erregung peitschte sie voran.
Attila drängte sich durch das Körperknäuel, er schob sich den Hut ins Gesicht, um nicht erkannt zu werden, als könnte man an seinem von der Feldarbeit ledrigen Gesicht, an seiner krummen Nase und den schief stehenden Augen den aufständischen Bauern erkennen. Die Hahnenfeder, das Zeichen des Aufstands, hatte er natürlich abgelegt.
Der Platz des heiligen Marko bebte. Die Menge hatte den Ort in einen bedrohlich brummenden Bienenstock verwandelt. Die meisten Anwesenden konnten nicht sehen, was sich in der Mitte des Platzes abspielte, sie reckten gierig die Köpfe, manch Ungeduldige kletterten auf die kahlen Bäume, die den Platz säumten, Väter hievten ihre Kinder auf die Schultern, andere hatten Leitern an die Häuserwände gelehnt und waren daran hochgeklettert, um einen Blick auf das Geschehen zu erlangen.
Eine düstere Sinfonie aus Schreien, ungläubigem Stöhnen, bizarrem Stimmengewirr schwoll in Wellen an, kroch die Fassaden empor und legte sich einer düsteren Glocke gleich über den Platz. Beißender Rauch stieg aus der Mitte auf und verbreitete den ätzenden Geruch von verbranntem Fleisch. Attila rieb sich die tränenden Augen, er stellte sich auf die Zehenspitzen und konnte zwischen den sich reckenden Köpfen vor ihm ein unheimliches Schauspiel beobachten.
Eine zerlumpte Gestalt, eingespannt in einen Pranger, wand sich brüllend unter einer rotglühenden Krone, die ihm maskierte Schergen aufgesetzt hatten. Die Folterknechte ließen nicht ab und malträtierten den Geschundenen mit glühenden Zangen, ließen seinen Körper zucken wie einen frisch gefangenen Fisch. Ein Vogt verlas eine Erklärung und verhöhnte das Opfer: „Seht nur, den König der Bauern, seht nur seine Krone!” Etliche Zuschauer johlten, zeigten mit dem Finger auf den Angeprangerten und feuerten die Peiniger an. Andere betrachteten schweigend die schaurige Szenerie. Frauen, die Gesichter in Kopftücher gehüllt, bekreuzigten sich, murmelten Gebete und drückten ihre Kinder an ihren Schoß, auf dass sie das Ungeheuerliche nicht mit ansehen mussten. Als der Körper des Gekrönten blutig und leblos im Pranger hing, hieben ihn zwei Scharfrichter mit ihren Schwertern in vier Teile.





























