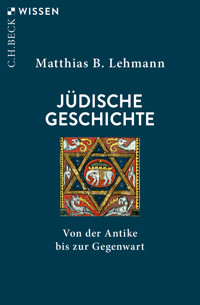
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die jüdische Geschichte reicht rund 2500 Jahre zurück und ist von Anfang an eine Geschichte von Exil und Diaspora. Matthias B. Lehmann erläutert, wie sich die jüdische Religion herausbildete. Er beschreibt die Blüte der jüdischen Kultur im islamischen und im christlichen Mittelalter, Vertreibungen im Spätmittelalter, neue Zentren in Osteuropa und im östlichen Mittelmeer und den Übergang in eine Moderne, die Emanzipation versprach, aber neue Verfolgung brachte. Aus ihr sind mit den USA und Israel neue Zentren jüdischen Lebens hervorgegangen. Der souveräne Überblick lässt eine Religion, Kultur und Nation neu entdecken, die Orient und Okzident wie keine andere Minderheit geprägt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Matthias B. Lehmann
JÜDISCHE GESCHICHTE
Von der Antike bis zur Gegenwart
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Widmung
Karte: Wanderungen und Vertreibungen im Mittelalter
Karte: Der Ansiedlungsrayon
1. Zwischen religiösem und nationalem Selbstverständnis
2. Tora, Tempel und Diaspora
Das Zeitalter des Zweiten Tempels
Juden und Griechen
Diaspora und Exil
3. Spätantike und rabbinisches Judentum
Juden und Christen
«Schriftliche» und «mündliche» Tora: Das rabbinische Judentum
Vorschriften, Geschichten und Deutungen: Der Talmud
4. Juden in der islamischen Welt
«Schriftbesitzer» und «Schutzbefohlene»
Von Babylonien nach al-Andalus
Die Welt der genisa und das jüdische Mittelmeer
5. Juden im christlichen Mittelalter
Stadtbewohner und «Kammerknechte»
Jüdische Kultur zwischen Aschkenas und Sepharad
Gewalt und Vertreibung
6. Jüdische Lebenswelten in der Frühen Neuzeit
Die sephardische Diaspora
Frühneuzeitliche Netzwerke
Chassidismus und Haskala
7. Welt im Umbruch
Emanzipation und ihr Preis
Reformjudentum und orthodoxes Judentum
Antisemitismus als politisches Programm
8. Ein globales Zeitalter
Emigration und eine neue jüdische Identität in Amerika
Philanthropie und Kolonialismus
Selbstemanzipation und Zionismus
9. Das zwanzigste Jahrhundert
Der Erste Weltkrieg als Zeitenwende
Die Schoah
Israel und der Nahostkonflikt
10. Die jüdische Welt heute
Weiterführende Literatur
Überblicksdarstellungen
Antike und Spätantike
Mittelalter
Frühe Neuzeit und Neuzeit
Zionismus und Israel
Antisemitismus und Schoah
Bild- und Kartennachweis
Personenregister
Zum Buch
Vita
Impressum
Widmung
In Memoriam Habbo Knoch (1969–2024)
Karte: Wanderungen und Vertreibungen im Mittelalter
Karte: Der Ansiedlungsrayon
1. Zwischen religiösem und nationalem Selbstverständnis
Was ist jüdische Geschichte? Eine Geschichte der Juden? Oder des Judentums? Die Geschichte eines Volkes oder die Geschichte einer Religion? Eigentlich ist das eine ohne das andere nicht wirklich greifbar. «Nationale» und «religiöse» Identität überschneiden sich und sind weder in der vormodernen noch in der neuzeitlichen jüdischen Geschichte ohne weiteres voneinander abzugrenzen. Schon die Hebräische Bibel beschreibt die Juden einerseits als eine Abstammungsgemeinschaft, deren Vorvater Abraham seine Heimat in Mesopotamien verließ, um sich im Land Kanaan – dem heutigen Israel – niederzulassen, andererseits als ein Volk, dessen Existenz überhaupt mit dem Auftrag, Gott im Sinne der Tora zu dienen, unauflöslich verbunden ist.
Man kann das komplexe, sich gegenseitig bedingende Verhältnis der «religiösen» und der «nationalen» Dimension des Judentums gut daran zeigen, wie zwei der herausragenden Gelehrten des jüdischen Mittelalters – Maimonides in Ägypten und Raschi in Nordfrankreich – die Frage bewerteten, welche Konsequenz sich aus einer religiösen Konversion zum Judentum beziehungsweise aus ihm zu einer anderen Religion für die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk ergibt. So schreibt Maimonides, ein Nichtjude, der zum Judentum übertrete, sei «wie ein neugeborenes Kind», und «die Blutsverwandten, die er als Nichtjude … hatte, gelten nicht mehr als seine Blutsverwandten». Daher könne ein Konvertit nach biblischem Gesetz sogar seine Mutter oder seine Schwester heiraten, wenn auch diese übertreten, weil das Verbot von Inzest in diesem Fall nicht mehr zum Tragen käme. Allerdings, schränkt Maimonides ein, ist dies nur eine theoretische Möglichkeit, da die Rabbiner eine solche Verbindung dennoch nicht erlauben (Mischne Tora, Isurei Bi’ur, Kap. 14). Mit anderen Worten, die Konversion ist für Maimonides nicht allein ein «religiöser» Akt, sondern ändert die Volkszugehörigkeit des Betroffenen – gewissermaßen seine Genealogie.
Auf der anderen Seite urteilt Raschi im Fall einer jüdischen Witwe, deren Schwager ein Apostat, also zum Christentum übergetreten ist. Gilt auch in diesem Fall das biblische Gebot der Schwagerehe, die zu vollziehen ist, wenn der verstorbene Ehemann keine Kinder hatte, beziehungsweise das chaliza-Ritual, durch das sich der Schwager seiner Verpflichtung entzieht, die Frau seines verstorbenen Bruders zu heiraten? Nach Raschis Meinung ist es unerheblich, dass der Schwager die jüdische Religion verlassen hat: «Der Apostat gilt als Jude … denn es heißt: ‹Israel hat gesündigt› [Jos. 7, 11], und obwohl er gesündigt hat, bleibt er doch [ein Teil von] Israel …» (Teschuwot Raschi, Nr. 173). In diesem Fall löst auch die religiöse Konversion nicht die «nationale» Zugehörigkeit zum jüdischen Volk auf, und ein Jude, «obwohl er gesündigt hat», bleibt doch ein Jude. Und so bewegt sich auch die jüdische Geschichte bis in die Gegenwart immer in einem Spannungsfeld zwischen «religiösem» und «nationalem» Selbstverständnis.
Im biblischen Buch Deuteronomium ist die Vorschrift überliefert, jedes Jahr zum Wochenfest (Schawuot) die ersten geernteten Früchte in den Tempel nach Jerusalem zu bringen und bei der Gelegenheit dort Folgendes zu rezitieren: «Mein Vater war ein umherirrender Aramäer. Er zog nach Ägypten, lebte dort als Fremder mit wenigen Leuten und wurde dort zu einem großen, mächtigen und zahlreichen Volk. Die Ägypter behandelten uns schlecht, machten uns rechtlos und legten uns harte Fronarbeit auf. Wir schrien zum Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr hörte auf unser Schreien und sah unsere Rechtlosigkeit, unsere Arbeitslast und unsere Bedrängnis. Der Herr führte uns mit starker Hand und hoch erhobenem Arm, unter großem Schrecken, unter Zeichen und Wundern aus Ägypten. Er brachte uns an diese Stätte und gab uns dieses Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließen.» (Deut. 26,5–9)
Mit diesen Versen ist ein biblisches Gründungsnarrativ beschrieben, das die Entstehung des jüdischen Volkes im Spannungsfeld von Wanderung, Exil und Heimkehr verortet. Auch heute werden diese Verse zitiert, jedoch aus Anlass eines anderen jüdischen Feiertages, nämlich als Teil des Sederabends am Pessach-Fest, an dem des Auszugs der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten unter der Führung von Mose und Aaron gedacht wird. Allerdings fehlt im heutigen Pessach-Ritual der letzte Vers, der sich auf die Ankunft im Land Israel, «ein Land, in dem Milch und Honig fließen», bezieht, und der Seder selbst endet mit der Formel, «nächstes Jahr in Jerusalem». Damit wird die in der Bibel formulierte Erklärung bei der Darbringung der ersten Früchte, die auf das Land Israel als zentralem Identitätsmerkmal zugespitzt ist, zum Ausdruck einer Exilerfahrung, die das jüdische Selbstverständnis seit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer im Jahr 70 n.d.Z. maßgeblich geprägt hat.
Die Hebräische Bibel beschreibt, wie sich nach dem Auszug aus Ägypten aus einer tribalen Gesellschaft (die Bibel spricht von den zwölf Stämmen Israels) ein Königreich herausbildet, das seine Glanzzeit unter König David und seinem Sohn Salomo erlebt, unter dessen Herrschaft der Tempel in Jerusalem entstand. Nach dem Tod Salomos wurde das Reich geteilt; aus ihm ging das nördliche Königreich Israel mit der Hauptstadt Samaria und das südliche Königreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem unter der Dynastie des Hauses David hervor. Außerbiblische Quellen – zeitgenössische Inschriften aus benachbarten Kulturen oder archäologische Befunde – zeichnen oft ein anderes Bild als jenes, das in der biblischen Erzählung vermittelt wird. Die Existenz eines Kollektivs mit dem Namen «Israel» im antiken Kanaan ist auf jeden Fall bereits durch die Siegesstele des ägyptischen Pharaos Merenptah von 1208 v.d.Z. belegt, der historische Kontext jedoch unklar. Über das Königreich Davids und Salomos wissen wir aus außerbiblischen Quellen nichts, aber immerhin bezeugt eine aramäische Inschrift der Stele von Tel Dan (ca. 830) die parallele Existenz eines Königreichs Israel sowie eines «Königs aus dem Haus Davids» in Juda. Das nördliche Königreich fand sein Ende mit der Eroberung durch die Assyrer im Jahr 722, wonach ein großer Teil seiner Bevölkerung in andere Regionen des Assyrischen Reiches zerstreut wurde. Das Königreich Juda bestand noch ein gutes Jahrhundert länger, wurde seinerseits aber durch den babylonischen Herrscher Nebukadnezzar besiegt. Die Babylonier zerstörten 586 v.d.Z. Jerusalem und seinen Tempel und verbannten die Oberschicht der Bevölkerung Judas ins Exil.
Das sogenannte babylonische Exil endete 539 mit dem Aufstieg des Persischen Reiches unter Kyros II. Die neuen persischen Herrscher erlaubten die Wiedererrichtung des Jerusalemer Tempels. Viele Religionshistoriker sprechen für die Zeit vor dem Exil, als Königtum und Kult eng miteinander verbunden waren, noch nicht vom Judentum, sondern von der Religion des Alten Israel, wobei das Exil eine wichtige Übergangszeit bildet. Die vorliegende Darstellung beginnt daher in der persischen Epoche und dem Zeitalter des «Zweiten Tempels».
Bereits in der persischen und dann vor allem seit der hellenistischen Zeit im 3. und 2. Jahrhundert v.d.Z. lebten Juden nicht nur in ihrem angestammten Heimatland, sondern bildeten eine weitverzweigte Diaspora. Eine besondere Herausforderung in der Darstellung der jüdischen Geschichte ist deshalb, wie mit der Vielfalt jüdischer Lebenswelten, die von ganz unterschiedlichen Umgebungskulturen geprägt waren, umzugehen ist. Soll diese Geschichte gewissermaßen «aus einem Guss» erzählt werden, besteht die Gefahr, die Unterschiede zwischen den jüdischen Diasporakulturen einzuebnen oder sich mit Tunnelblick auf einen zentralen Entwicklungsstrang zu konzentrieren. Werden dagegen, um der Vielfalt gerecht zu werden, lokale, regionale oder nationale Geschichten nebeneinandergestellt, verliert sich sehr schnell, was diese verschiedenen jüdischen Subkulturen eigentlich miteinander verbindet. Jüdische Kulturen entwickelten sich durch die Jahrhunderte immer in einer Wechselwirkung von Anpassung an die nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaften und Widerstand gegen sie, aber ebenso im stetigen Austausch zwischen den verschiedenen Zentren jüdischen Lebens untereinander. Im Folgenden wird daher versucht, die Mannigfaltigkeit der jüdischen Geschichte als die Geschichte einer globalen Diaspora im Blick zu behalten, dabei aber immer wieder die Beziehungen, die die unterschiedlichen Teile der jüdischen Welt miteinander verbanden, zu betonen.
2. Tora, Tempel und Diaspora
Das Zeitalter des Zweiten Tempels
Nach seinem Sieg über Babylonien im Jahr 539 v.d.Z. erließ der persische Herrscher Kyros II. (der Große) ein Edikt, das auf einem heute im Britischen Museum in London zu besichtigenden Tonzylinder in akkadischer Keilschrift festgehalten wurde. Der babylonische Gott Marduk, heißt es darin, habe Kyros wegen seiner Gerechtigkeit «zum Herrscher über das gesamte All» berufen. Die «Götter von Sumer und Akkad», die «zum Zorn der Götter nach Babylon» gebracht worden waren, ließ Kyros nun «auf Befehl Marduks in ihren Heiligtümern einen Wohnsitz der Herzensfreude beziehen», und ihre Anhänger «versammelte [er] und brachte sie zurück zu ihren Wohnorten». Ähnlich berichtet das biblische Buch Esra, dass Kyros auch das Exil der Einwohner Judas, die nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem 586 v.d.Z. nach Babylonien verschleppt worden waren, beendete.
Nach der biblischen Erzählung beruft sich Kyros freilich nicht auf Marduk, sondern auf den Gott Israels, und erklärt, dieser selbst habe ihm aufgetragen, «ihm ein Haus bauen zu lassen in Jerusalem in Juda. Wer unter euch von seinem Volke, mit ihm möge sein Gott sein, dass er nach Jerusalem in Juda ziehe, zu erbauen das Haus des Herrn, des Gottes Israels, das ist der Gott von Jerusalem». Siebzig Jahre nach der Zerstörung des Tempels Salomos wurde 516 der wiederaufgebaute Tempel von Serubbabel – Enkel des letzten Königs von Juda und nun persischer Statthalter in Jerusalem – eingeweiht. Die persische Vorherrschaft endete 333 mit dem Siegeszug Alexanders des Großen, der auch Judäa in den Einflusskreis der hellenistischen Kultur brachte. 164 v.d.Z. kam es für ein Jahrhundert noch einmal zu einem unabhängigen judäischen Königreich, dann wurde Judäa 63 v.d.Z. Teil des Römischen Reiches, und die judäische Revolte gegen Rom, die 66 n.d.Z. ausbrach, führte schließlich zu einer erneuten Zerstörung des Tempels, dieses Mal durch die Römer, im Jahr 70.
Das Buch Esra schildert seinen Protagonisten als «Schriftgelehrten (sofer), kundig im Gesetz des Mose», der «sein Herz darauf richtete, die Lehre des Herrn zu erforschen und auszuüben, auch zu lehren in Israel Satzung und Recht». Im Buch Nehemia wird berichtet, dass Esra die Bewohner Jerusalems, «Mann und Frau, alle, die verstehen konnten … auf dem Platz vor dem Wassertor» versammelte, wo «sie lasen in dem Buche, in der Lehre (tora) Gottes und übersetzten sie, so dass sie verstanden, was gelesen wurde». So bedeutete das Ende des babylonischen Exils einen Neuanfang, der sich nicht auf den Wiederaufbau des Tempels beschränkte. Neben dem auf Jerusalem fokussierten Tempeldienst war die Tora – die Lehre und das Gesetz des Mose – die Grundlage, auf der das Leben in Judäa unter persischer Oberherrschaft neu organisiert wurde. Nun wurden ältere Bücher, die später in die Bibel eingingen, redigiert und kommentiert, neue Bücher entstanden, und es bildete sich die endgültige Version des Pentateuchs, der fünf Bücher Mose bzw. der Tora, heraus. Bis zum Ende der hellenistischen Vorherrschaft wurde der Kanon der prophetischen Bücher mit den «vorderen Propheten» (die Bücher Josua, Richter, Samuel und Könige) und den «hinteren Propheten» (Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die weiteren «zwölf Propheten») vollendet. Neben dem «Gesetz» und den «Propheten» bildete sich als dritter kanonischer Teil der Hebräischen Bibel, wahrscheinlich bis zum 2. Jahrhundert n.d.Z., eine Sammlung von «Schriften» heraus, die als wichtigsten Teil die Psalmen enthielten.
Das Schließen des biblischen Kanons war der Ausgangspunkt für einen bis in die Gegenwart andauernden Prozess der Auslegung des von allen als verbindlich akzeptierten Textes. Die Interpretation der kanonischen Schriften durch Übersetzung, Paraphrase und Kommentar erlaubte es, den Texten treu zu bleiben und gleichzeitig auf sich verändernde historische Umstände zu antworten. So stellte die Durchdringung des östlichen Mittelmeerraumes, einschließlich Judäas, durch den Hellenismus ab dem 4. Jahrhundert v.d.Z. eine Herausforderung dar, die auch grundlegende philosophische und theologische Fragen aufwarf. Beispielsweise sagt die Tora nichts über die Unsterblichkeit der Seele, dennoch fand die griechische, insbesondere platonische Vorstellung von einer individuellen Seele, die unabhängig vom physischen Körper des Menschen existiert, auch ins jüdische Denken Eingang. Laut Flavius Josephus’ Jüdischen Altertümern lag hierin ein Unterschied zwischen der Schule der Pharisäer, die «glauben, dass die Seelen unsterblich sind und dass dieselben, je nachdem der Mensch tugendhaft oder lasterhaft gewesen, unter der Erde Lohn oder Strafe erhalten», und der Schule der Sadduzäer, nach deren Lehre «die Seele mit dem Körper zu Grunde [geht]».





























