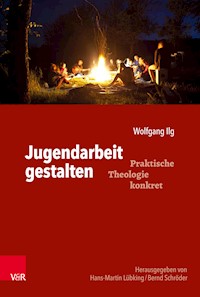
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Praktische Theologie konkret
- Sprache: Deutsch
Jugendarbeit als Beziehungsraum gestalten. Was heißt das für die evangelische Kinder- und Jugendarbeit, auch hinsichtlich sich verändernder Bedingungen? Das Buch gibt dazu Impulse und Hinweise für die Praxis. Wolfgang Ilg stellt die Situation kirchlicher Jugendarbeit vor und benennt theologische sowie pädagogische Grundlagen. Ein praktisch-theologisches Update bietet Perspektiven zu aktuellen Themen wie Inklusion, Migrationsgesellschaft oder digitalen Formen der Jugendarbeit. Im anschließenden praxisbezogenen Teil werden klassische Arbeitsformen – Gruppenarbeit, offene Angebote –, aber auch innovative Modelle wie schulbezogene Jugendarbeit oder Fresh X beschrieben und mit konkreten Anregungen verbunden. Auch besondere Themen wie Kinderschutz oder der Neustart der Jugendarbeit vor Ort werden aufgegriffen. Ein Anhang mit Materialempfehlungen rundet das Buch ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Praktische Theologie konkret
Herausgegeben vonHans-Martin Lübking und Bernd Schröder
Band 4
Wolfgang Ilg
Jugendarbeit gestalten
Mit einer Abbildung
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2021 Vandenhoeck & Ruprecht, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, Verlag Antike und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: © SkyLine/Adobe Stock
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99439-0
Inhalt
Vorwort der Herausgeber
Vorwort
Einleitung – Jugendarbeit als Beziehungsraum
1 Die Situation kirchlicher Jugendarbeit
1.1 Drei Szenen aus der Praxis
1.2 Junge Menschen und die evangelische Kirche
1.3 Halbierte Zahlen – ganze Menschen: demografische Perspektiven
1.4 Jugendliche Lebenswelten
2 Theologische und pädagogische Grundlagen
2.1 Theologie für, mit und von Jugendlichen
2.2 Bildung – auch im non-formalen Bereich
2.3 Jugendarbeit als Beziehungsraum gestalten
2.4 Das Ich am Du entwickeln – Unterstützung bei der Persönlichkeitsbildung
2.5 Beziehungen untereinander ermöglichen – die Gruppe als Ausgangspunkt
2.6 Beziehung zu Gott – Spiritualität stärken
3 Update zu Rahmenbedingungen und Themen
3.1 Strukturelle Verortung in Kirche und Verband
3.2 Rechtliche Rahmenbedingungen
3.3 Partizipative Leitung durch Ehrenamtliche und Hauptamtliche
3.4 Sozialpädagogische Handlungsprinzipien der Jugendarbeit
3.5 Demokratiebildung und Gemeinwesenorientierung
3.6 Genderthemen
3.7 Inklusion
3.8 Jugendliche in der Migrationsgesellschaft
3.9 Digitale Formen der Jugendarbeit
3.10 Kooperationen
4 Anregungen für die Praxis
4.1 Die Konfi-Arbeit als Nahtstelle
4.2 Regelmäßige Gruppenangebote
4.3 Offene Angebote
4.4 Schulbezogene Jugendarbeit
4.5 Freizeiten und internationale Jugendbegegnungen
4.6 Jugendgemeinden, Jugendkirchen, Fresh Expressions of Church
4.7 Gewinnung, Qualifikation und Begleitung von Ehren- amtlichen
4.8 Musik – Lobpreis als neue Monokultur?
4.9 Die Fülle der Arbeitsformen – Kunst, Kultur, Sport, Erlebnispädagogik & Co
5 Besondere Herausforderungen
5.1 Jugendliche in Krisensituationen begleiten
5.2 Kinderschutz und Prävention sexualisierter Gewalt
5.3 Mit der Jugendarbeit bei null anfangen – auch in der »Nach-Corona-Zeit«
6 Zehn goldene Regeln
7 Anhang – Materialempfehlungen für die Praxis
7.1 Eine kleine Jugendarbeitsbibliothek
7.2 Liederbücher und Fundgruben für Musik
7.3 Institutionen und Newsletter
Literatur
Vorwort der Herausgeber
Die Reihe »Praktische Theologie konkret« will Pfarrer*innen, Diakon*innen sowie Mitarbeitende in Kirche und Gemeinde mit interessanten und innovativen Ansätzen in kirchlich-gemeindlichen Handlungsfeldern bekannt machen und konkrete Anregungen zu guter Alltagspraxis geben.
Die Bedingungen kirchlicher Arbeit haben sich in den letzten Jahren zum Teil erheblich verändert. Auf viele heutige Herausforderungen ist man in Studium und Vikariat nicht vorbereitet worden und in einer oft belastenden Arbeitssituation fehlt meist die Zeit zum Studium neuerer Veröffentlichungen. So sind interessante neuere Ansätze und Diskussionen in der Praktischen Theologie in der kirchlichen Praxis oft kaum bekannt. Der Schwerpunkt der Reihe liegt nicht auf der Reflexion und Diskussion von Grundlagen und Konzepten, sondern auf konkreten Impulsen zur Gestaltung pastoraler Praxis:
– praktisch-theologisch auf dem neuesten Stand,
– mit Informationen zu wichtigen neueren Fragestellungen,
– Vergewisserung über bewährte »Basics«
– und einem deutlichen Akzent auf der Praxisorientierung.
Die einzelnen Bände sind von Fachleuten geschrieben, die praktisch-theologische Expertise mit gegenwärtiger Erfahrung von konkreter kirchlicher Praxis verbinden. Wir erhoffen uns von der Reihe einen hilfreichen Beitrag zu einem wirksamen Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis kirchlicher Arbeit.
Dortmund/Göttingen
Hans-Martin Lübking und Bernd Schröder
Vorwort
Gelingende Jugendarbeit – vieles scheint dagegen zu sprechen: Jugendkulturen wandeln sich rasch und werden immer unübersichtlicher. Kirchliche Jugendarbeit wirkt mancherorts verstaubt, die Jahrgangsstärken evangelischer Jugendlicher sinken beständig. Manche Engagierten kennen das Gefühl der Resignation, weil Jugendliche nur schwer zu erreichen sind und die klassischen Angebote nicht automatisch »laufen«.
Und doch: Für eine gelingende Jugendarbeit braucht es gar nicht viel. Jugendliche sehnen sich danach, ernst genommen und verstanden zu werden. Dazu muss man nicht das Lexikon der Jugendsprache auswendig können, sondern braucht eine innere Haltung von Zuwendung und Interesse. Junge Menschen stecken voller Ideen und Initiative, manchmal benötigen sie nur einen Raum und das Vertrauen von Erwachsenen, um selbst aktiv zu werden. Bereits Kinder haben Fragen und Sorgen, Anliegen und Hoffnungen, für die das Evangelium einen Resonanzraum bietet. Bei genauer Betrachtung finden sich etliche Anknüpfungspunkte, bei denen junge Menschen gern und in großen Zahlen mit der Kirche in Kontakt sind. Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist also sinnvoll, notwendig und möglich.
Dieses Buch will dazu ermutigen, Jugendarbeit mit frischen Ideen zu gestalten. Manches kann wiederentdeckt, anderes sollte mutig neu ausprobiert werden. Dort, wo kirchliche Jugendarbeit sich an eigene Traditionen fesselt, die einengen, statt zu öffnen, darf fröhlich losgelassen werden – im Vertrauen darauf, dass Gott Menschen auf immer neuen Wegen erreichen und begleiten wird.
Wie wertvoll eine gelingende Jugendarbeit für das eigene Leben sein kann, habe ich selbst dankbar erlebt. Als Teilnehmer und ehrenamtlicher Mitarbeiter in verschiedensten Praxisfeldern (insbesondere bei Freizeiten!), als Landesschülerpfarrer in Württemberg und seit 2018 als Professor für Jugendarbeit an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg bleibe ich dankbar für den reichen Beziehungsraum, der sich mir durch die Jugendarbeit öffnete.
Dieses Buch entstand im intensiven Dialog mit Menschen, die mir zu wichtigen Wegbegleiter*innen geworden sind. Eine erste Fassung konnte ich mit Mitarbeitenden und Studierenden meines Forschungsteams an der EH Ludwigsburg diskutieren, die mich bei der Erstellung immer wieder unterstützt haben: Judith Gross, Manuela Hees, Anika Hintzenstern, Carolin Keller, Marlene Kühner, Mirjam Rutkowski und Sabrina Schaal. Für Anregungen und Überarbeitungshinweise zu ausgewählten Kapiteln danke ich Yasin Adigüzel, Björn Büchert, Reinhold Krebs, Michael Krimmer, Andrea Mohn, Peter Schmidt, Michael Schofer und Henrik Struve, die als Hauptamtliche im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg einen Blick aus der Fachpraxis einbrachten. Eine kritische Durchsicht des Manuskripts und wertvolle Diskussionen verdanke ich zudem folgenden Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis: Mike Corsa, Günter Kistner, Friedrich Schweitzer, Marc Sieper, Martin Weingardt und Anika Weinsheimer. Die verschiedenen Perspektiven taten nicht nur dem Buch sehr gut, sondern zeigten mir einmal mehr, wie wichtig mir in fachlicher und persönlicher Hinsicht die Beziehungen zu diesen Menschen sind. Den Reihenherausgebern Hans-Martin Lübking und Bernd Schröder sowie Jana Harle vom Verlag danke ich herzlich für die Begleitung beim Entstehen des Buchs.
Ludwigsburg, im Juli 2021
Wolfgang Ilg
Einleitung – Jugendarbeit als Beziehungsraum
Jugendarbeit als Beziehungsraum: Dieser Ansatz bildet das Leitbild der vorliegenden Darstellung zur evangelischen Kinder- und Jugendarbeit. Wenn in den Mittelpunkt nicht Programme, Events oder Themen, sondern vielmehr Beziehungen gestellt werden, entspricht das den positiven Erfahrungen vieler junger Menschen. Jugendarbeit ist für sie attraktiv, weil sie dort anderen begegnen und dabei auch die eigene Identität ausbilden können. Zugleich erweist sich der Beziehungsschwerpunkt als anschlussfähig für eine christliche Sicht auf Jugendarbeit: Der Mensch ist von der Schöpfung her darauf angelegt, zu sich selbst, zu anderen Menschen und zu Gott in Beziehung zu treten. Vielfach wird in der Jugendarbeit folgerichtig von der »Beziehungsarbeit« gesprochen, um die es im Wesentlichen gehe. Dieser Begriff birgt allerdings eigene Probleme, transportiert er doch das Missverständnis, dass Beziehungen sich herstellen, quasi »erarbeiten« lassen könnten. Sowohl für die Beziehungen unter Menschen als auch für die Beziehung zwischen Mensch und Gott gilt jedoch, dass sie nur unter der Bedingung von Freiheit wachsen und sich entfalten können. Das Bild vom »Beziehungsraum« erscheint mir daher passender: Ein Raum bietet Gelegenheiten, er ist Schutzhülle und Rahmung, erzwingt aber nichts. Der Beziehungsraum Jugendarbeit lädt zu Begegnungen ein. Geeignete Impulse und Programmangebote können dazu anregen, dass Beziehungen entstehen und dass an einem guten Miteinander gearbeitet wird – und doch bleiben Beziehungen unverfügbar, entziehen sich menschlicher Machbarkeit.
Das Bild vom Beziehungsraum verhilft zudem dazu, die Aufgabe von Verantwortlichen zu beschreiben: Sie sind – um im Bild zu bleiben – zunächst einmal Gastgebende, schaffen also eine Umgebung, in der man gern Beziehungen knüpft. So mancher Raum der Jugendarbeit muss von Spinnweben befreit werden, braucht eine Loslösung von den örtlichen Traditionen, um der jeweils nächsten Generation eigene Spielräume zu eröffnen. Haupt- und Ehrenamtliche agieren dabei nicht nur als Ermöglicher*innen für die Gemeinschaft einer Gruppe von jungen Menschen, sondern können selbst als Bezugspersonen bedeutsam für Jugendliche werden.
Das vorliegende Buch versteht sich als Ermunterung, den Beziehungsraum Jugendarbeit mitzugestalten. Da ein Raum nicht losgelöst von seiner Umgebung wahrgenommen werden kann, bietet Kapitel 1 zunächst eine Einbettung in die aktuelle Situation kirchlicher Jugendarbeit. Der Blick auf Beziehungen bestimmt im 2. Kapitel die theologischen und pädagogischen Grundlagen für gelingende Jugendarbeit. Noch stärker als viele andere kirchliche Felder ist die Lebenswelt Jugendarbeit einem permanenten Wandel unterworfen – Kapitel 3 enthält ein Update zu veränderten Rahmenbedingungen und Themen. Ganz konkret wird es in den Anregungen für die Praxis des 4. Kapitels. Unter den besonderen Fällen und Themen in Kapitel 5 geht es um Seelsorge in Krisensituationen, Kinderschutz und den Neustart »bei null«. Zehn goldene Regeln sowie einige der für das Feld der Jugendarbeit reichlich vorhandenen Praxismaterialien werden im abschließenden Anhang vorgestellt.
Der hier unternommene Versuch, in knapper Form einen praxisorientierten und zugleich wissenschaftlich fundierten Überblick über die evangelische Kinder- und Jugendarbeit zu bieten, füllt eine Lücke bisheriger Publikationen zur Jugendarbeit. Er richtet sich einerseits an Studierende und engagierte Ehrenamtliche, andererseits auch an Pfarrer*innen, Diakon*innen und Gemeindepädagog*innen, die sich einen Überblick verschaffen wollen, ohne dabei alle Komplexitäten auszuloten.
Eine notwendige Klärung betrifft die verwendeten Begriffe: Vielfach wird im Folgenden zur sprachlichen Vereinfachung nur von Jugendarbeit gesprochen, auch wenn damit zumeist die evangelische Kinder- und Jugendarbeit insgesamt gemeint ist. Im Blick auf das Altersspektrum steht im vorliegenden Buch die Arbeit mit Jugendlichen, also den 14- bis 17-Jährigen, im Fokus. Viele Impulse des vorliegenden Buchs lassen sich aber auch auf die Arbeit mit Kindern ab dem Schulalter (ca. 6 bis 13 Jahre) und jungen Erwachsenen (18 bis 26 Jahre) übertragen. Die Bestimmung als evangelische oder kirchliche Jugendarbeit ist dort gesetzt, wo der spezifisch theologische Aspekt besonders relevant ist, viele Hinweise zur Jugendarbeit gelten auch für die allgemeine Jugendarbeit außerhalb der Trägerschaft von Kirche oder christlichen Jugendverbänden. Auf Abgrenzungen zwischen evangelischer und katholischer Jugendarbeit wird nur wenig Wert gelegt, weil der konfessionelle Charakter in der Praxis zunehmend an Gewicht verliert.
Da das Buch vorwiegend auf die Praxis zielt, sind Literaturverweise zurückhaltend gesetzt – das Literaturverzeichnis ab S. 126 bietet dennoch eine Sammlung der zentralen aktuellen Veröffentlichungen und lädt zur Vertiefung der notwendigerweise kurzen Kapitel ein.
1
Die Situation kirchlicher Jugendarbeit
1.1 Drei Szenen aus der Praxis
1)
»Wenn es den Teenclub nicht gäbe – mein Leben wäre deutlich einsamer.« Die 15-jährige Lara sitzt nachdenklich auf einer Mauer und schaut vom Campingplatz aus auf den See, in dem der Großteil der Gruppe begeistert einem Wasserball nachjagt. Am Ende der Kleingruppenzeit, in der es heute um Erfahrungen in der Familie ging, waren ihr die Tränen gekommen. Antonia, ehrenamtliche Leiterin der Freizeit, hatte es bemerkt und sie in einem ruhigen Moment gefragt, ob sie noch mehr erzählen will. Nun berichtet Lara, wie ihr die Trennung ihrer Eltern und die schlechten Noten in der Schule zu schaffen machen. »Wenn ich montags befürchte, dass ich die Woche nicht durchhalte, denke ich an den Freitagabend. Da ist Teenclub im Gemeindehaus, in dem ich mich einfach wohlfühle. Irgendwie herrscht da eine besondere Atmosphäre. Ich muss mich nicht so verstellen, kann auch mal über Schwächen reden. Die Lieder, die wir singen, geben mir Kraft und helfen mir, meinen Glauben an Gott nicht zu verlieren. Das Programm ist auch gut, aber am wichtigsten ist einfach, miteinander Zeit zu haben für Blödsinn und ernste Themen. Und dass du, Antonia, mir immer wieder zuhörst und mich jetzt zur Freizeit eingeladen hast, tut mir gut. Danke, dass ich in der Jugendarbeit einfach die sein kann, die ich bin.«
2)
Leon und Stanislav stehen frustriert im Kirchenraum. Heute Abend sollte die Bandprobe für den Jugendgottesdienst stattfinden. Es war schwierig genug, über die Whatsapp-Gruppe alle zum Kommen zu motivieren. Jetzt stehen zwar die vier Bandmitglieder und eine neue Konfirmandin (E-Bass, endlich!) im Altarraum. An eine Probe ist aber nicht zu denken. Von der Empore her füllen Orgelklänge den Raum. »Ich übe immer freitagabends, das weiß man doch«, zeigte sich die Organistin der Gemeinde pikiert, als die jungen Leute eintrafen. Die Bandprobe hatte der Pfarrer wohl mal wieder nicht in den Gemeindekalender eingetragen. »Mir reicht’s«, sagt Leon und packt seine Sachen. »Schon seit drei Jahren warten wir darauf, dass wir zumindest mal ein kleines Mischpult bekommen, während für die Orgelrenovierung ein eigener Förderverein gegründet wurde. Was wir hier machen, interessiert doch sowieso niemanden. Dann überlassen wir die Kirche halt ganz den Alten!«
3)
»Jugendliche erreichen« lautete der Titel des Fortbildungsabends, zu dem sich Gemeindepädagogin Birgit angemeldet hat. Neben ihr sitzt die ehrenamtliche Leiterin der Jugendblaskapelle des örtlichen Musikvereins. Beim Austausch merken beide, wie ähnlich ihre Probleme sind: Was sie anbieten, scheint nicht unbedingt im Trend zu liegen, die Jugendlichen lassen sich nur schwer ansprechen, schon gar nicht für regelmäßige Aktivitäten. Als der Referent jedoch beim Thema »Ressourcen zur Gewinnung Jugendlicher« darum bittet, in einer Eigenarbeitsphase einige Fragen für die eigene Organisation zu beantworten, kommt Birgit ins Nachdenken: »Gibt es eine hauptamtliche Struktur in Ihrer Institution?« – Naja, Pfarrer, Gemeindepädagogin und Sekretariatsanteile, das ist mehr als nichts, der Musikverein kann davon nur träumen. »Welche Zugänge haben Sie zur örtlichen Schule?« – Während die Leiterin der Jugendblaskapelle hier einen dicken Strich zieht, muss Birgit nicht lange überlegen: Sie unterrichtet ja selbst einige Stunden Evangelische Religion an der örtlichen Schule. »An welchen Punkten kommen Sie in Kontakt mit ›neuen‹ Jugendlichen?« – Die Musikerin nebenan freut sich über die bis zu fünf jungen Menschen, die beim jährlichen »Schnupperabend« reinschauen, wenn dieser intensiv beworben wird. Birgit denkt an die zwanzig Konfirmand*innen, die letzte Woche erstmals das Gemeindehaus betreten haben. »Vielleicht«, so resümiert Birgit nach diesem Abend, »haben wir doch ganz gute Voraussetzungen für eine gelingende Jugendarbeit – könnten wir daraus nicht mehr machen?«
Drei Szenen, die Lust und Frust der Jugendarbeit exemplarisch abbilden. Chancen und Herausforderungen liegen in diesem Feld nahe beieinander. Mancherorts überwiegen Erfahrungen wie im Beispiel von der Bandprobe: Jugendliche erleben Kirche zuweilen als wenig jugendfreundlich und wenden sich ab. Das vorliegende Buch will solche Probleme nicht ignorieren, lädt aber zu einem Perspektivenwechsel ein: Auch wenn die Jugendarbeit mancherorts nur schleppend zu laufen scheint, gibt es ungeahnte Möglichkeiten zu entdecken. Die Voraussetzungen der Kirche, Jugendliche zu erreichen, sind im Blick auf äußere Voraussetzungen (Räume, Personal, Finanzen, Strukturen) hervorragend. Allerdings ist Jugendarbeit eine Chance nicht in erster Linie für die Kirche, sondern für junge Menschen. Was alle Aktivitäten der Jugendarbeit antreibt, sind Erfahrungen, wie sie die 15-jährige Lara im ersten genannten Beispiel erzählt:
Gute kirchliche Jugendarbeit bietet einen Raum für Beziehungen und Gemeinschaft, und sie lädt dazu ein, die Menschenfreundlichkeit Gottes zu entdecken.
1.2 Junge Menschen und die evangelische Kirche
Wenn im Folgenden von kirchlicher Jugendarbeit die Rede ist, dann ist damit im engeren Sinne eine Arbeitsform nach § 11 des Achten Sozialgesetzbuchs gemeint (vgl. zu den rechtlichen Rahmenbedingungen Kapitel 3.2). Allerdings gestaltet sich die Beziehung zwischen Kirche und jungen Menschen wesentlich weiter als nur im klar beschriebenen Feld der Jugendarbeit. Daher soll zunächst ein Blick auf das nicht immer ganz einfache Wechselverhältnis zwischen jungen Menschen und der evangelischen Kirche geworfen werden, und zwar aus beiden Perspektiven.
Die traditionelle Perspektive der Kirche: evangelisch von Anfang an
Für die meisten Kirchenmitglieder in Deutschland begann ihre Beziehung zur Kirche zu einem Zeitpunkt, an dem sie darüber nicht selbst bestimmen konnten: Mit der Taufe vollzieht sich nicht nur ein geistliches Geschehen, sondern auch die Aufnahme in die Institution Kirche. Auch wenn sowohl die absoluten Zahlen getaufter Menschen als auch der Anteil evangelischer Eltern, die sich für die (Säuglings-)Taufe ihres Kindes entscheiden, sinken, gilt für den überwiegenden Teil der Kirchenmitglieder, dass sie sich nicht an eine Zeit erinnern können, in der sie kein Kirchenmitglied waren. Anders als bei vielen anderen Mitgliedschaftsverhältnissen, beispielsweise einem Fitnessstudio, beschäftigt man sich bei der Kirche nicht zunächst mit ihren Inhalten und Angeboten, um sich dann bewusst zur Mitgliedschaft zu entscheiden. Die eigene Kirchenmitgliedschaft ist immer schon da und droht zuweilen sogar in Vergessenheit zu geraten, da dieses Mitgliedschaftsverhältnis auch dann unbeschadet fortgeführt werden kann, wenn kein direkter Kontakt zur Kirche und ihren Aktivitäten besteht.
In der Säuglingstaufe wird dieser Umstand mit bedacht. Verbunden mit der Frage an Eltern und Pat*innen, ob das Kind getauft werden soll, versprechen diese, das Kind mit Glauben und Kirche bekannt zu machen. Eine Kirche, die (aus guten Gründen) kleine Kinder tauft, muss daher Sorge dafür tragen, dass Heranwachsende in altersgemäßer Form nachvollziehen können, womit sie inhaltlich und institutionell am Taufstein verbunden wurden. Dass die Kirche also altersgemäße Angebote für Kinder und Jugendliche bereithält, ergibt sich nicht zuletzt aus einer theologisch verantworteten Praxis der Säuglingstaufe.
Die konkreten Formen kirchlicher Angebote junger Menschen ziehen sich durch alle Lebensbereiche: Sie beginnen bei der Krabbelgruppe, haben einen wichtigen Bezugspunkt in den evangelischen Kindertagesstätten (ein Drittel der Kitas in Deutschland befinden sich in kirchlicher Trägerschaft) und setzen sich fort in Angeboten wie Kindergottesdienst, Jungschargruppen, Kinderbibelwochen oder der Christenlehre. Zur (bislang eher geringen) Vernetzung all dieser Angebote finden sich Anregungen in Kapitel 3.10, einen Überblick zu gemeindepädagogischen Angeboten bietet Bubmann u. a. (2019).
Eine besondere biografische Rolle im Aufwachsen eines evangelischen Kirchenmitglieds spielt die Konfirmation, die im Alter der Religionsmündigkeit, also mit 14 Jahren, angesetzt ist. Im feierlichen Gottesdienst bekräftigen die Jugendlichen, dass sie den Weg mit Glauben und Kirche, den ihre Eltern für sie in der Kindheit gewählt hatten, weitergehen wollen. Die Konfi-Arbeit stellt mit über 150.000 Jugendlichen pro Jahr eines der größten non-formalen Bildungsfelder dar. Allerdings bedeutet das Ende der Konfi-Zeit zugleich eine Sollbruchstelle für viele Jugendliche in ihrem Bezug zur Kirche: Nur die wenigsten besuchen nach Ableistung der vielerorts üblichen (und, wie in Kapitel 2.1 ausgeführt wird, eher schädlichen) Gottesdienstpflicht noch die Sonntagsgottesdienste. Aber auch die Übergänge in Jugendgruppen oder eine eigene Mitarbeit gelingen nur dort, wo geeignete Konzepte bewusst umgesetzt werden. Über die evangelische Jugendarbeit kann jedenfalls ohne den Bezug zur Konfi-Arbeit kaum sinnvoll nachgedacht werden, beide Arbeitsfelder profitieren stark von einer gut geklärten Kooperation (zu praktischen Aspekten vgl. Kapitel 4.1).
Neben der Konfi-Arbeit bietet der evangelische Religionsunterricht in den meisten Bundesländern ein in der Breite wahrgenommenes Begegnungsfeld mit dem christlichen Glauben und auch mit der Institution Kirche. Der in Artikel 7 des Grundgesetzes festgelegte Status des konfessionellen Religionsunterrichts als »ordentliches Lehrfach«, das »in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt« wird, ermöglicht (und erwartet!) seitens der Kirchen eine Bildungsverantwortung auch im Bereich der öffentlichen Schule. Nicht nur über die Inhalte der kirchlich verantworteten Bildungspläne, sondern auch über das Lehrpersonal bietet der Religionsunterricht eine Kontaktfläche zum evangelischen Glauben, die bei Verantwortlichen für die gemeindliche Jugendarbeit überraschend wenig im Blick ist.
Über die genannten Stationen – Säuglingstaufe, gemeindepädagogische Angebote für Kinder, Konfi-Arbeit, Religionsunterricht – ergibt sich für die evangelische Kirche also nach wie vor eine intensive Präsenz im Leben der jungen Kirchenmitglieder. Nach der Konfirmation lassen diese Kontakte jedoch zumeist nach. Bei jungen Erwachsenen herrscht im Blick auf geregelte Kontakte mit der Kirche oftmals Fehlanzeige, sodass für viele Kirchenmitglieder erst die Familiengründung mit kirchlicher Trauung und der Taufe eigener Kinder wieder einen konkreten Kontakt zur Kirchengemeinde mit sich bringt. Gelingende Angebote der Jugendarbeit sollten daher für die Kirche als äußerst bedeutsam angesehen werden.
Die Perspektive junger Menschen: Kirche als irrelevante Größe – oder als Raum gestaltbarer Möglichkeiten
Nachdem der vorherige Abschnitt von der »kirchlichen Standardbiografie« ausgeht, erweisen sich die Dinge als grundlegend anders, wenn man Kirche aus der Perspektive junger Menschen zu betrachten versucht. Stärker als in früheren Jahren bestimmen Diskontinuitäten das Leben von Heranwachsenden. Regionale oder institutionelle Verwurzelungen verlieren ihre Selbstverständlichkeit, die Lebensgestaltung wird beweglicher und kurzfristiger. Die Idee eines parochial planbaren »Gesamtkatechumenats«, bei dem der junge Mensch einen kirchlich abgesteckten Weg von der Wiege bis zur Bahre im Umfeld seiner Kirchengemeinde absolviert, wirkt wie aus der Zeit gefallen. Auch wenn noch immer etwa die Hälfte der jungen Menschen in Deutschland einer der beiden großen Kirchen angehört, hat sich das Verhältnis zur Institution Kirche deutlich gewandelt.
Empirische Jugendstudien zeichnen ein skeptisches, allerdings nicht nur negatives Bild der jugendlichen Sicht auf die Kirche. In den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts hat den jüngsten Shell-Jugendstudien zufolge die subjektiv empfundene Wichtigkeit des Glaubens sowohl bei katholischen als auch bei evangelischen Jugendlichen deutlich nachgelassen. In der Shell-Jugendstudie 2019 stuft nur jede*r vierte evangelische Befragte für sich als wichtig ein, an Gott zu glauben, während diese Quote bei muslimischen Jugendlichen dreimal so hoch liegt (Deutsche Shell 2019, 153). Eine differenziertere Studie zu jugendlichem Glauben konnte zeigen, dass für Jugendliche vor allem die Selbstbeschreibung als »religiös« abgelehnt wird, während sie sich deutlich eher als »gläubig« bezeichnen. Darin wird eine zunehmende Entfremdung gegenüber kirchlichen Institutionen sichtbar, die aber nicht gleichgesetzt werden darf mit dem Abschied von Glaubens- und Sinnfragen (Schweitzer u. a. 2018, 70– 72). Die V. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD bescheinigt den Jugendlichen vor dem Hintergrund der Individualisierungstheorie und der (allerdings zurecht umstrittenen) Säkularisierungsthese eine geringe Kirchenverbundenheit, die vor allem mit dem »›Abflauen‹ der religiösen Sozialisation« erklärt wird (Pickel 2015, 150).
Dabei zeigen die Studien auch, dass die meisten Jugendlichen keine grundsätzliche Abneigung gegen Kirche hegen, ihnen wird vielfach nur nicht deutlich, was diese Kirche mit ihnen zu tun haben sollte. Die fehlende Relevanz der Kirche ergibt sich dabei aus einer doppelten Wahrnehmung: Zum einen erscheinen die Inhalte, für die Kirche steht, als eher verstaubt und unverständlich. Zum anderen gelingt es der Kirche nicht, jungen Menschen zu verdeutlichen, welche konkrete Bedeutung sie für deren Leben haben könnte. Sofern der Kirchensteuerbescheid beim Eintritt in das Erwerbsleben das einzige wahrnehmbare Kommunikationsgeschehen zwischen Kirche und Kirchenmitglied darstellt, erscheint ein Kirchenaustritt, der oft in dieser Phase erfolgt, durchaus plausibel.
Die distanzierte Beziehung zwischen jungen Menschen und Kirche trifft nicht auf die gesamte junge Generation zu. Ein anderes Bild stellt sich da ein, wo Jugendliche im kirchlichen Bereich Räume finden, die sie mitgestalten und sich aneignen können. Wenn sie Freiheiten zur eigenständigen Gestaltung erleben und sich dabei auf ihre Weise mit Lebens- und Glaubensfragen auseinandersetzen können, erweist sich Kirche als ein Ort der Möglichkeiten. Junge Menschen bevölkern dann im Sommer den Pfarrgarten, gestalten aus eigener Initiative gemeinsame Wochenenden, arbeiten beim Konfi-Camp mit und setzen sich für Klimaschutz oder geflüchtete Menschen ein. Wo dies gelingt, wird Kirche als ein weites Dach wahrgenommen, unter dem junge Menschen sich mit eigenen Themen für das Gemeinwesen einbringen können. Genau diese Form der Mitgestaltung der eigenen Lebenswelt bezeichnet das Kinder- und Jugendhilferecht als »Jugendarbeit«. Manchen Untergangsannahmen zum Trotz bildet die kirchliche Jugendarbeit nach dem Sport aktuell den größten Bereich, in dem junge Menschen an einer Gruppe teilnehmen. Laut dem 16. Kinder- und Jugendbericht sind 19 % der 12- bis 17-Jährigen in einer kirchlichen oder religiösen Gruppe aktiv, und damit mehr als in Musikvereinen, den »Blaulichtorganisationen« (Feuerwehr, THW, DLRG) oder Umweltgruppen (BMFSFJ 2020, 377).
1.3 Halbierte Zahlen – ganze Menschen: demografische Perspektiven





























