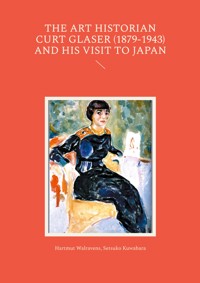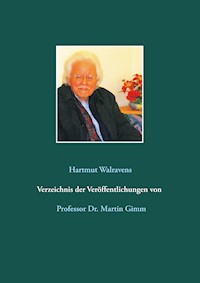Julius Kurth (1870-1949): "Autogramme" und Fabulae für Börries Frhr. von Münchhausen E-Book
Hartmut Walravens
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Berliner Pfarrer und Universalgelehrte Julius Kurth (1870-1949), besonders bekannt durch seine ägyptische und seine Japanholzschnittsammlung, ist im Jahre 2017 durch eine umfassende Ausstellung im Museum Lichtenberg und durch mehrere Publikationen gewürdigt worden. Auch wurde seine Korrespondenz mit dem Balladendichter Börries von Münchhausen (1874-1945), dem er freundschaftlich verbunden war, veröffentlicht. Im Nachtrag dazu werden hier Kurths "Autogramme", bibliophile Geburtstagsgaben für Münchhausen veröffentlicht, die großenteils in mit viel Geschick und Sorgfalt angefertigten eigenhändigen Briefen von Beethoven, Goethe, Friedrich d. Gr., E. T. A. Hoffmann, Dürer usw. bestehen und teils mit "unveröffentlichten" historischen Zeichnungen geschmückt sind. Dazu kommen einige lateinische gereimte Fabeln, die sich wie Verse von Wilhelm Busch lesen. Die Autogramme beweisen nicht nur Kurths sprachliches und künstlerisches Feingefühl, sie liefern auch kleine Ergänzungen zu seiner Biographie. Die Briefe bedeutender Persönlichkeiten wie auch Zeichnungen sind faksimiliert wiedergegeben, während andere Texte nur in Transkription gedruckt sind. Auch ein graphologisches Gutachten von Ludwig Klages ist beigegeben. Mit Einleitung und Register.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 66
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Umschlagillustration zeigt zum Vergleich eine fast 20 Jahre später entstandene Handschriftenprobe Friedrichs d. Gr., zitiert nach Aegyptiaca und Papyri der Sammlung Julius Kurth. Bearbeitet von Theresa Steckel und Henryk Löhr. Dresden: Sandstein Verlag, 2014, S. 25.
Leicht korrigierte Ausgabe.
Inhalt
Abkürzungen
Vorwort
B. von Münchhausen: Ein fabelhafter Mann
J. Kurth: „Autogramme“
J. Kurth: Fabulae
Namenregister
Abkürzungen
NDB Neue Deutsche Biographie
ÖBL Österreichisches Biographisches Lexikon
Vorwort
Das vorliegende Büchlein war gänzlich ungeplant, denn gerade war die Ausgabe der Briefe Julius Kurths an seinen Freund Münchhausen erschienen:
Julius Kurth (1870–1949): Briefe an den Dichter Börries von Münchhausen
(1874–1945).
Norderstedt: BoD 2017. 135 S.
und damit schien die Veröffentlichung der Kurth-Materialien zunächst abgeschlossen. Da stieß der Herausgeber auf die bereits als vermißt betrachteten „Autogramme“ Kurths, d.h. Briefe im Stile Goethes, Friedrich d. Gr., E. T. A. Hoffmanns und anderer, die als Geburtstagsgaben für Münchhausen verwendet wurden und die der Autor als „Schnurrpfeifereien“ charakterisierte. Diese bibliophilen Scherze wie auch die lateinischen Fabeln, von denen sich acht erhalten haben, während die Reinschrift aller 20 Fabeln mit deutscher Übersetzung wohl verloren ist, verdienen eine Publikation, zumal Münchhausen selbst die Autogramme in seiner Skizze Kurths „Ein fabelhafter Mann“ in den Mittelpunkt seiner Darstellung gerückt hat. Dabei wurde dann aber auch die Wiederholung der kurzen biographischen Skizzen im Vorwort wie auch ein erneuter Abdruck von „Ein fabelhafter Mann“ notwendig, um den Leser nicht ohne den notwendigen Kontext zu lassen.
Biographisches
Julius Kurth (Berlin 15. Mai 1870–23. Mai 1949 in Gerbstedt) wurde als Sohn des Rektors Julius Kurth (1842–1891) und seiner Frau Emma Marie Clausnitzer in Berlin-Kreuzberg geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums zum Grauen Kloster studierte er seit 1890 evangelische Theologie sowie christliche Archäologie in Berlin und promovierte mit einer archäologischen Arbeit in Heidelberg. Dank Stipendien konnte er in der Folge eine Mittelmeerreise wie auch eine Studienreise nach Griechenland und Italien unternehmen, was seine ägyptologischen und archäologischen Interessen sehr förderte. Er war durch publizistische Projekte seinem Lehrer Hermann L. Strack weiterhin verbunden; von 1900 bis 1910 war er als Assistent (Stadtvikar) des Berliner Generalsuperintendenten Wilhelm Faber (1845–1916) tätig, der ihm mehr Mentor und Freund denn Vorgesetzter war. Von 1910 bis zu seiner Pensionierung 1935 amtierte er als Pfarrer an der Taborkirche in Berlin-Hohnschönhausen. Trotz wachsender Dienstgeschäfte – seine Pfarre wuchs während seiner Amtszeit von etwa 4000 auf über 20000 Seelen – arbeitete er intensiv an seinen künstlerischen und wissenschaftlichen Hobbies: er sammelte ägyptische Altertümer wie auch Keilschriftobjekte und bearbeitete sie; seit etwa 1900 sammelte er intensiv japanische Holzschnitte, lernte weitgehend autodidaktisch Japanisch und veröffentlichte eine Reihe geschätzter Monographien zum Thema. Er verfaßte Dramen, schrieb Gedichte, komponierte und zeichnete ... Für nähere Informationen sei auf die folgenden Publikationen verwiesen:
Aegyptiaca und Papyri der Sammlung Julius Kurth. Bearbeitet von Theresa Steckel und Henryk Löhr. Dresden: Sandstein Verlag, 2014. 432 S., 516 farb. Abb. (Bestandskatalog. Archäologisches Museum der Universität Halle-Wittenberg 1.)
Der Band enthält eine gute Biographie und dokumentiert Kurths ägyptische Sammlung, begleitet von vorzüglichen Photographien.
H. Walravens: „Ich habe gearbeitet für fünf Menschen!“ Julius Kurth (1870– 1949) als Sammler und Erforscher japanischer Farbholzschnitte.
Ostasiatische Zeitschrift N.S. 33.2017, 44–54.
Der Beitrag konzentriert sich auf Kurths Arbeiten zu japanischen Farbholzschnitten, von denen er eine stattliche Sammlung besaß.
H. Walravens: Julius Kurth (1870–1949). Berliner Japansammler, Gelehrter und Pfarrer. Mit seinem unveröffentlichten Sharaku-Schauspiel. Wiesbaden: Harrassowitz 2017. 226 S.
(Asien- und Afrika-Studien der Humboldt-Universität zu Berlin 51.)
Das Buch versucht eine Gesamtdarstellung von Kurths Arbeiten anhand seiner Publikationen (mit Ausnahme von Ägyptiaca), veröffentlicht Kurths ungedrucktes Schauspiel über den bedeutenden Holzschnittmeister Sharaku sowie Briefe des Zeichners und Exlibris-Künstlers Marquis Franz von Bayros (1866–1924) an Kurth; außerdem werden Informationen über die nicht mehr erhaltene Holzschnittsammlung Kurths geboten. Setsuko Kuwabara würdigt im selben Band Kurth als Exlibriskünstler.
Im Rahmen einer im Museum Lichtenberg gezeigten Kurth-Ausstellung hat der Förderverein Schloß Hohenschönhausen eine handliche, reich illustrierte Darstellung von Kurths Leben und Werk bearbeitet:
500 Jahre Reformation. Dr. Julius Kurth, Gelehrter, Pfarrer, Künstler. Die Strahlkraft von Wissen und Glauben.
Berlin: Museum Lichtenberg 2017. 80 S.
Zusätzlich erschien:
Zeichnungen und Texte für Kinder von Julius Kurth.
Berlin: Museum Lichtenberg 2017. 63 S. (Farbtaf.)
Kurths Korrespondenzpartner war der als Balladendichter bekannt gewordene Baron Börries von Münchhausen (Hildesheim 20. März 1874–16. März 1945 Windischleuba), ein Nachkomme des als „Lügenbaron“ in die Literatur eingegangenen Hieronymus von Münchhausen (1720–1797), dessen Geschichten durch Gottfried August Bürger in Deutschland verbreitet wurden. Seine Mutter war Clementine von der Gabelentz (1849–1913), deren Vater als bedeutender Linguist berühmt war1. Ihr Bruder Georg (Poschwitz 18. März 1840–11. Dez. 1893 Berlin), also Münchhausens Onkel, war Professor für ostasiatische Sprachen in Leipzig und dann Berlin.2 Münchhausen studierte Jura, heiratete eine wohlhabende Frau und verwaltete seine Güter. Er war deutschnational eingestellt, wurde aber bekannt durch seine Liedersammlung Juda, die von Ephraim Moses Lilien (1874–1925) kongenial illustriert wurde. Seine anfängliche Judenfreundschaft, wohl gefördert durch homoerotische Beziehungen, wandelte sich später zu deutlichem Antisemitismus; er gliederte sich in das NS-System ein, gründete eine völkische Dichterakademie und wurde noch 1944 von Hitler in die Liste der „Gottbegnadeten“ Künstler aufgenommen. Er beging kurz vor Kriegsende Suizid. Wurde Münchhausen lange als Volks- und Balladendichter geschätzt, so sind sein Leben und Wirken in den letzten Jahren genauer erforscht und seine literarische und politische Tätigkeit kritisch neubewertet worden.
Hier sei insbesondere die umfangreiche Studie von Henning Gans: „Ich laß hier alles gehn und stehn ...“ Börries von Münchhausen, ein Psychopath unter drei Lobbyismokratien. Leipzig: Universitätsverlag 2017. 655 S., genannt.
Die vorliegende Publikation stützt sich auf einen Manuskript-Sammelband der Universitätsbibliothek Göttingen (Cod. B. v. Münchhausen VIII,156: J. Kurth. Autogramme), der sich früher in der Universitätsbibliothek Jena befand. Daraus wurden die graphisch und bibliophil relevanten Stücke faksimiliert, Briefe und ähnliches schriftliches Material transkribiert. Wenn nötig, wurden Anmerkungen beigefügt. Den Kontext liefert, wie gesagt, Münchhausens Würdigung Julius Kurths.
Doch beschränkt sich die Bedeutung des gebotenen Materials nicht auf bibliophile Scherze. Es finden sich mancherlei ergänzende Informationen zu den bisherigen Veröffentlichungen über Julius Kurth:
So liefert Kurth eine Liste seiner verschiedenen Sammlungsgebiete mit kurzen Charakteristiken, darunter Fossilien, ausgestopfte Tiere, Kulinaria, ein Herbarium, Glas und Porzellan sowie Stoffproben aus aller Welt. Seine Erotica wollte Kurth dem Berliner Völkerkundemuseum übereignen, was den Erben wohl nicht bekannt war; die Sammlung ist leider vernichtet worden.
Kurth beschreibt, wie er mit Münchhausen in Kontakt kam – Ausgangspunkt war die Bitte um ein Autogramm des verehrten Dichters.
Ein im Briefwechsel erwähntes Gutachten des Graphologen Ludwig Klages über Kurth findet sich im Sammelband.
Nur eine lateinische Fabel lag dem Briefwechsel bei; hier werden nun 8 Fabeln, nach der Fassung von 1930, aber ohne die später angefertigte deutsche Übersetzung, gegeben. Die Sammlung war bis 1941 auf 20 Stücke angewachsen und bildet ein ähnliches Lesevergnügen wie Knittelverse von Wilhelm Busch.
Von Interesse ist auch Kurths Bericht über seinen „Besuch in Windischleuba“, in dem er Münchhausen zu charakterisieren sucht.
Eine weitere, unveröffentlichte und wohl verschollene Arbeit wird erwähnt: Das mittelalterliche Tierepos
Ysengrimus
in deutscher Übersetzung.
1 Hans Conon von der Gabelentz, Altenburg 13. Okt. 1807–3. Sept. 1874 Lemnitz, Politiker und Linguist. Vgl. Martin Gimm: Hans Conon von der Gabelentz und die Übersetzung des chinesischen Romans Jin Ping Mei. Wiesbaden: Harrassowitz 2005. 203 S. (Sinologica Coloniensia 24.)
2 Vgl. Martin Gimm: Georg von der Gabelentz zum Gedenken. Materialien zu Leben und Werk. Wiesbaden: Harrassowitz 2013. 140 S. (Sinologica Coloniensia 32.)
Ein fabelhafter Mann
Von Börries Frhrn. v. Münchhausen