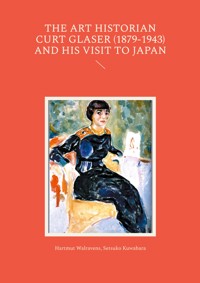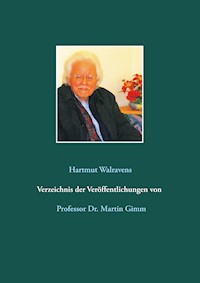Neue Rückschau auf ein arbeitsreiches Leben Hartmut Walravens zum 75sten: Thematisches annotiertes Schriftenverzeichnis Mit Einleitung und Registern E-Book
Hartmut Walravens
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In der Einleitung blickt der Autor auf sein Leben und seine Arbeiten zurück. Das Schriftenverzeichnis ist nach Themen angeordnet: 16 Kapitel führen von Bibliographie und Bibliotheken über Ostasien zu China, Japan nach Zentralasien und Rußland - insgesamt etwa 1300 Eintragungen. Das letzte Kapitel verzeichnet Beiträge, die sich im Druck befinden oder in Arbeit sind. Zahlreiche Aufnahmen sind erläutert oder kommentiert und einige auch illustriert. Register erschliessen den Inhalt. Gegenüber dem früheren, rein chronologisch angeordneten Verzeichnis sind in den letzten Jahren 300 Eintragungen hinzugekommen; die sachliche Ordnung macht ebenso wie Anmerkungen die Information besser auffindbar. Der Autor war als Bibliothekar tätig, zuletzt als Ltd. Bibliotheksdirektor an der Staatsbibliothek zu Berlin, Privatdozent an der Freien Universität, Lehrbeauftragter an der Humboldtuniversität, Direktor der Internationalen ISBN Agentur und der Internationalen ISMN Agentur. Beruflich hat er sich für den Ausbau der Zeitschriftendatenbank und die Erfassung der verstreuten umfangreichen Zeitungsbestände eingesetzt. Jahrelang war bei der IFLA Vorsitzender des Runden Tisches für Zeitungen und für zahlreiche internationale Zeitungskonferenzen verantwortlich, deren Ergebnisse er in zehn Sammelbänden veröffentlicht hat. Im Bereich der Standardnumerierung hat er durch die Verbreitung der ISO-Standards für Bücher und für Noten wesentlich zur Rationalisierung des Buch- und Musikhandels beigetragen. Weitere Schwerpunkte sind Ostasien und ostasiatische Büchersammlungen, die Orientalisten und ihre Biographien, Korrespondenzen und Veröffentlichungen. Als rares Spezialgebiet kommt die Mandschuliteratur hinzu - Mandschu und Chinesisch waren die Amtssprachen des Reiches, in dem zwei der bedeutendsten Kaiser regierten, die es je hatte: Kangxi und Qianlong, die in Europa Bewunderung erregten und als Vorbild galten. Nicht nur nahmen die Mandschus das chinesische Reich gewissermaßen im Handstreich ein und regierten es 250 Jahre lang, sie schufen auch eine Schrift und eine eigene Literatur - geradezu fabelhaft! Ein spannendes Forschungsgebiet. Viele verzeichnete Publikationen befassen sich mit Wissenschaftsgeschichte, sind Biobibliographien und wissenschaftliche Briefeditionen. Die neuesten Bücher behandeln Johann Redowskys Expedition nach Kamtschatka (1806-1807), die Arbeiten des Berliner Pfarrers und Japansammlers Julius Kurth sowie Nachschlagewerke zur Erotica-Bibliographie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Abkürzungen
Vorwort
Bibliographie, Bibliothekswesen
Zeitschriften
Zeitungen
Standardnumerierung
Erotica
Orientalistik, allg.
Ostasiatische Sammlungen
Ostasien - Bibliographie
Ostasien - Biographie
China
Japan
Korea
Altaica, Mandschurica, Mongolica
Tibet
Rußland
Sonstiges - Publikationen in Vorbereitung
Namenregister
Abkürzungen
AOH
Acta Orientalia Hungarica
BSOAS
Bulletin of the School of Oriental and African Studies
CAJ
Central Asiatic Studies
CDNL
Conference of Directors of National Libraries
CEAL
Committee on East Asian Libraries
CLEAR
Chinese Literatur: Essays, Articles, Reviews
DCG
Deutsche China-Gesellschaft
DFW
Dokumentation, Information: Zeitschr. für Allgemein- u. Spezialbibliotheken, Büchereien u. Dokumentationsstellen
HOL
Hefte für Ostasiatische Literatur
IAOL
International Association of Orientalist Librarians
ICBC
International Cataloguing and Bibliographical Control
IfB
Informationsmittel für Bibliotheken
IFLA
International Federation of Library Associations
ISBN
International Standard Book Number
ISMN
International Standard Music Number
JAH
Journal of Asian History
JAOS
Journal of the American Oriental Society
JH
Japonica Humboldtiana
JRAS
Journal of the Royal Asiatic Society
KMG-M
Karl May Gesellschaft, Mitteilungen
LGB
Lexikon des gesamten Buchwesens
MN
Monumenta Nipponica
MS
Monumenta Serica
NDB
Neue Deutsche Biographie
NOAG
Nachrichten der Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens
OE
Oriens extremus
OLZ
Orientalistische Literaturzeitung
PIAC
Permanent International Altaistic Conference
RBS
Revue bibliographique de sinologie
RO
Rocznik orientalistyczny
SBB
Staatsbibliothek zu Berlin
SBPK
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz
TP
T'oung Pao
UAJb
Ural-altaische Jahrbücher
WZKM
Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes
ZAS
Zentralasiatische Studien
ZDMG
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
ZfBB
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie
Vorwort
Wie wird man Bibliograph? Bibliophiler? Bibliothekar? Dozent? Eine pauschale Antwort gibt es wohl nicht. Jede Geschichte ist anders. Daher ein kurzes Vorwort.
Kriegsbedingt im Sauerland geboren, habe ich keine Beziehung zum Geburtsort, den ich nur später einmal auf der Durchreise besucht habe. Nach dem Krieg zog die Familie nach Köln, wo mein Vater, von Beruf Schlosser, Arbeit bei den Stadtwerken gefunden hatte – genauer, bei den Wasserwerken. Und so kam es, daß ich an einem Wasserwerk am nördlichen Stadtrand Kölns aufwuchs. Aus heutiger Sicht ein idyllischer Wohnort, mitten in den Feldern. Die beiden Geschwister waren wesentlich älter, und so war ich so ziemlich auf mich selbst angewiesen. Herumstreifen in der Natur schärfte das Interesse an der Pflanzenwelt. Und ich konnte es kaum erwarten, lesen zu lernen und mir eine neue Welt zu erschließen. Niemand hatte Zeit (und Lust) mir vorzulesen. So dauerte es nur wenige Wochen, bis ich nicht mehr fragen mußte, was für ein Buchstabe ist das? Freilich waren Bücher knapp – die Eltern hatten nur einige Möbel über den Krieg retten können, sonst nichts. So gab es Grimms Märchen, die Bibel und Heiligenlegenden (all das in Fraktur gedruckt). Aber das machte nichts. Alles wurde verschlungen. Die Dorfschule, damals noch im Landkreis gelegen und für kurze Beine etwa eine halbe Stunde entfernt, bot nicht viel Neues, da die meisten Mitschüler im dreiklassigen System viel zu lange im Kampf mit dem Alphabet lagen. So konnte ich schon drei Jahre später das (naturwissenschaftliche) Humboldt-Gymnasium beziehen, und da wurde es schon interessanter. Biologie, Chemie, Physik waren mir am liebsten. Der Chemielehrer war leicht geschockt, als er hörte, daß ich mich für Sinologie als Studienfach entschieden hatte. Aber eigentlich war die Wahl zwischen Physik (wovon ich am wenigsten verstand und mich sehr hineinknien mußte) und Ostasien. Die Entscheidung brachte der Zufall – ich guckte mir das Ostasiatische Seminar in Köln an. Es bestand im wesentlichen aus einem großen Bibliotheksraum, und an den Lehrveranstaltungen nahmen gewöhnlich nicht mehr als drei Studenten teil. Das gefiel mir.
Wie es zu Ostasien kam? Im Jahr vor dem Abitur hatte ich Wanderferien in Österreich gemacht und dabei mir die Lyrik des Ostens als Lektüre mitgenommen. Die chinesischen Gedichte, meist von Günter Eich und Günther Debon übersetzt, sprachen mich sehr an. Und als ich bald darauf das Ostasiatische Seminar besuchte, traf ich Günther Debon, der Privatdozent dortselbst war...
Walter Fuchs, Professor für Sinologie in Köln
Lehrstuhlinhaber war Walter Fuchs, ein sympathischer, korrekter Herr, den man auf ersten Blick als einen Beamten eingeschätzt hätte. Ich bemerkte bald, daß ihm der Unterricht (Lektüre der Klassiker, schriftsprachliche Texte) wenig Spaß bereitete. Man konnte ihn leicht durch Fragen vom Thema ablenken, wenn man die Lektion nicht ausreichend vorbereitet hatte. Nach einigen Jahren bekam Debon einen Ruf auf die Professur in Heidelberg, und mein (älterer) Kommilitone Lutz Bieg folgte ihm. Er war im Nebenfach Germanist und spezialisierte sich auf Literatur. Ich blieb – schon aus finanziellen Gründen – in Köln. Schwerpunkte waren nun Geschichte und Geographie (Fuchs) und Literatur, Theater, Musik (Martin Gimm). Gimm hatte eine fulminante Dissertation über ein Werk der Musikamtslieder (Yuefu zalu) verfaßt, und kam nach längerem Aufenthalt in Taiwan nach Deutschland zurück. Beiden Herren gemeinsam war die Neigung zur mandschurischen Sprache und Literatur, die man in Köln als Nebenfach wählen konnte – die einzige Universität in Deutschland, die so etwas bot. Neben der Sinologie machte ich die Runde durch die philosophische Fakultät – etwas Arabisch, Hebräisch, Türkisch, Rechtsgeschichte, Germanistik, Theaterwissenschaft, Politikwissenschaft ... und natürlich Kunstgeschichte und Ethnologie. Es gab eine Abteilung für ostasiatische Kunst am Kunsthistorischen Institut, und sie wurde vom Direktor des Museums für Ostasiatische Kunst betreut, anfangs dem temperamentvollen Werner Speiser, der bald starb, gefolgt von Roger Goepper, bei dessen Lichtbilder-Vorlesungen ich Schwierigkeiten hatte, die Augen aufzuhalten. Er war indessen ein netter Mensch, solider Wissenschaftler und guter Museumsmann, den ich sehr schätzen lernte. In der Slavistik machte ich das Proseminar Altkirchenslavisch, da ich mir Gedanken über ein passendes Nebenfach machte. Als ich jedoch hörte, daß der Ordinarius, Reinhold Olesch, gute Kenntnisse von drei slavischen Sprachen erwartete, ließ mein Eifer nach, und ich wandte mich der Ethnologie zu. Ordinarius war Helmut Petri, Spezialist für Australien sowie Großwildjäger, wie es hieß. Diese Gebiete interessierten mich weniger, dafür um so mehr die Lehrveranstaltungen von Karl Anton Novotny, der ein gestandener Museumsmann (Wien) und Amerikanist war. Es stellte sich bald heraus, daß seine Lehrveranstaltungen ein Dreierkollegium waren – der Professor selbst, ein Richter vom Kölner Appellationsgericht und ich. Ein Erlebnis war 1968, als eine großer Anzahl von Studenten, so etwa 80, zum Seminar kam: „Herr Professor, wir müssen diskutieren!" „Ja, bitte schön, worüber denn möchten Sie diskutieren?" "Ja, über die Universität, die Wissenschaft, die politische und soziale Situation und ... und ..." „Ja, bitte gerne! Doch vorher möchte ich bitte eines klären, verehrte Kolleginnen und Kollegen – Entweder kann man logisch denken – oder man kann es nicht!" Das war absolut liebenswürdig gesagt, und die Studenten verstanden es offenbar. Fünf Minuten später war das Dreierkollegium wieder allein.
Werner Speiser, Direktor des Museums für Ostasiatische Kunst
Fuchs hatte in Berlin studiert und vertrat die Tradition von Wilhelm Schott und vor allem Wilhelm Grube, der wiederum in St. Petersburg bei V. P. Vasil'ev und Anton Schiefner sowie Georg von der Gabelentz in Leipzig gelernt hatte. Und das bedeutete: neben Chinesisch auch Mandschu, Mongolisch und Tibetisch, etwas Sanskrit (Buddhismus!) und natürlich Japanisch einzubeziehen. Als ich einmal im Unterricht zugeben mußte, nichts präpariert zu haben, mit der vagen Ausrede, ich hätte viel für das Japanische zu tun gehabt, sagte Fuchs gelassen: „In Berlin haben wir damals mit 4 Sprachen angefangen" [d.h. Chinesisch, Mandschu, Mongolisch und Tibetisch] und fügte dann, wie nebenbei hinzu: „Damals konnte ich auch ganz gut Türkisch". Da war ich doch ziemlich beschämt. Um meinen Rückstand wenigstens etwas aufzuholen, hörte ich Türkeitürkisch bei Manfred Götz in Köln. Im ersten Semester waren 15 Studenten da – im 2. Semester nur ich. Götz wollte den Kurs daher ausfallen lassen, aber ich konnte ihn bewegen, mit mir Texte zu lesen, so sinologische Texte von Wolfram Eberhard, der 1938 nach Ankara gegangen war und von dem zahlreiche Arbeiten auf Türkisch erschienen waren. Darüber hinaus zog es mich nach Bonn – dort gab es das bekannte Zentralasiatische Seminar, das Walther Heissig aufgebaut hatte, ein Mekka der Zentralasienwissenschaftler. Dort lernte ich die Anfangsgründe des Tibetischen bei Klaus Sagaster und des Mongolischen bei Michael Weiers und hörte Alttürkisch und Uigurisch bei Annemarie von Gabain. Nikolaus Poppe lernte ich kennen, hörte aber nicht bei ihm, weil er im Unterricht nach seinen Büchern vorging, sodaß ich voreilig schloß, das könne ich ja selbst nachlesen (was ich nie getan habe). Frau von Gabain war sehr nett zu mir, und nachdem ich mich zwei Semester mit gutem Willen, aber bescheidenem Erfolg abgeplagt hatte, sagte sie mir nette Worte darüber, wie ich mich doch so gut eingearbeitet hätte. Das habe ich ihr nie vergessen, obwohl sie den guten Willen für den Lernerfolg nahm. Aber Motivation ist ja das A und O des Studiums, und man braucht eben Ermutigung. Bei Heissig direkt habe ich nie gehört, ihn freilich öfter getroffen. Einmal kam ich ins Geschäftszimmer, als ein Anruf der Universitätsverwaltung eintraf. Es muß etwas Ernsthaftes und Ungewöhnliches gewesen sein, denn Heissig schrie den Mitarbeiter so an, daß Frau Müller-Grote, die erprobte Sekretärin, vor Schreck zurückfuhr, an ein großes gerahmtes Bild stieß, das zu Boden polterte, das Glas splitterte. Heissig nahm keine Notiz davon – als er mit dem Beamten fertig war (der offenbar eingeknickt war), sagte er beiläufig, „So muß man mit den Leuten umgehen, wenn sie nicht verstehen, worum es geht!" Auch das war eine Lehre.
1969 wurde es klar, daß Fuchs im Frühjahr 1970 in den Ruhestand treten würde. Das sorgte für einen Adrenalinschub. Meine Promotion stand an, und so war plötzlich Druck da, nachdem sich Fuchs bisher nur gelegentlich freundlich erkundigt hatte: „Na, geht es gut weiter?"
Nun wurde das gesammelte Material in einer Gewaltaktion innerhalb eines halben Jahres aufgearbeitet, wieder und wieder abgeschrieben und eingereicht. Die Promotion fand dann 14 Tage vor Fuchs' Eintritt in den Ruhestand statt. Danach stellte sich die Frage: „Wie wird es weitergehen?" Mein älterer Kommilitone Erling von Mende hatte ein Jahr vor mir promoviert und hatte insofern die beste Aussicht, Assistent zu werden, denn Martin Gimm wurde Fuchs' Nachfolger. Es folgten DFG-Stipendien – so ein Projekt über den Kölner Berthold Laufer (1874–1934), einen der bedeutendsten Orientalisten seiner Zeit, sowie eine Reise in die USA, denn es ging auch um die Erfassung von mandschurischen Texten. Jemand sagte mir, als Orientalist könne man auch in den Bibliotheksdienst gehen. Also suchte ich den Direktor am Bibliothekar-Lehrinstitut in Köln auf, Ludwig Sickmann. Er war sehr freundlich, warnte mich aber, daß Kandidaten aus den Naturwissenschaften und der Medizin bevorzugt würden. Ich müsse also abwarten. Ich hörte lange nichts und hatte die Option bereits abgeschrieben, als ich unvermittelt ein Schreiben von Dr. Sickmann bekam, ob ich denn noch interessiert wäre. Ich war nicht beglückt darüber und ließ die Anfrage unbeantwortet. Wieder einige Wochen später kam ein erneutes Schreiben, wenn möglich noch freundlicher, in dem angedeutet wurde, daß man mich sehr gern aufnehmen würde. Ich war immer noch nicht überzeugt, fand es aber höchst unhöflich, nicht zu antworten. Ich wurde vorgeladen, und ich begann mein Referendariat. Die Ausbildung dauerte zwei Jahre, ein praktisches Jahr an der Kölner Universitätsbibliothek, bei dem ich alles gelernt habe, was den praktischen Beruf ausmachte. Das theoretische Jahr, am Institut, fiel demgegenüber stark ab, weshalb ich es meist schwänzte, ohne daß dies einen merklichen Einfluß auf das Prüfungsergebnis gehabt hätte. Wenn man sich sein (kurzes) Leben ständig mit Büchern befaßt hatte, war einem vieles ohnehin bekannt.
Nach der Prüfung stand wieder die Frage im Raum: Was tun? Diesmal war die Antwort einfacher, da es definitiv um eine Bibliotheksstelle ging. Eine Reihe von Bewerbungsschreiben wurden auf den Weg geschickt, und bald kam die Antwort – die Bibliothek der neugegründeten Hochschule der Bundeswehr in Hamburg war interessiert.
Vorher jedoch fand die erwähnte USA-Reise statt, die sich statt auf 3 auf 6 Monate erstreckte, denn in Chicago ergab sich die Möglichkeit, einen Katalog der Lauferschen Sammlung von Inschriften (in Form von Steinabklatschen) herauszugeben. Die grundlegenden Forschungsarbeiten waren getan, doch mußte das Material redigiert und in Buchform zum Druck gebracht werden. Das war eine doppelte Herausforderung, nämlich wissenschaftlich, da ich bald merkte, daß die nichtchinesischen Inschriften kaum bearbeitet waren, und praktisch, nämlich vom Gesichtspunkt der Buchherstellung. Konzeption, Gestaltung, Vorwort, Formatierung, Register, all das war eine wichtige Erfahrung. Darüber hinaus bot die Reise, abgesehen vom Projektgegenstand, die Möglichkeit viele erfahrene Kollegen kennenzulernen, Max Loehr, Francis Cleaves und Achilles Fang in Harvard, Leo Mish in New York, Frederick Mote in Princeton, Harrie Vanderstappen, T. H. Tsien und H. G. Creel in Chicago, Hellmut Wilhelm und Ruth Krader in Seattle sowie Richard C. Rudolph in Los Angeles. Sie alle haben Einfluß auf meine weiteren Arbeiten gehabt. Überdies habe ich auf der Reise meine spätere Frau kennengelernt.
Die Vorstellung beim Verteidigungsministerium entbehrte nicht der Komik. Die Auswahlkommission befragte mich eindringlich, insbesondere nach meiner Einstellung zur Bundeswehr. Antwort: „Keine. Ich habe bislang keine Erfahrungen gemacht." „Aber Sie haben doch gedient?" „Nein!" Lauernder Blick: „Ah, Kriegsdienstverweigerer?" „Nein!" „Aber Sie sind doch gemustert worden?" „Nein." Da war man mit dem Latein am Ende, und ich erklärte, daß dies der Wahrheit entspreche (das Wasserwerk war bei den Ordnungsämtern etwas kontroverses Territorium, was die Zuständigkeit anging) und ich annahm, man ließe mich erstmal mein Studium abschließen und würde dann auf mich zukommen. Und so sei ich ja jetzt freiwillig gekommen!! Gegen soviel Einfalt mochte man nicht anrennen, und so bekam ich den Bescheid, ich möge mich zum 2. Dez. 1974 am Holstenhofweg 85 in Hamburg zum Dienstantritt einfinden.
Empfangen wurde ich in Hamburg von einem etwa gleichaltrigen, sehr sympathischen Kollegen, Jurist und Musikwissenschaftler, der als vorläufiger Leiter der Bibliothek fungierte, aber bald einem Bibliothekar des Deutschen Krebsforschungsinstituts weichen mußte. Die Arbeit war insofern interessant, als die Bibliothek noch aufzubauen war, also auch reichlich Erwerbungsmittel vorhanden waren. So war die Bibliothek bald für ihre guten Bestände aktueller Literatur in den technischen Fächern wie auch der Jura und den Sozialwissenschaften bekannt und viele Studenten der Universität kamen als Leser, zumal der Bestand freihand aufgestellt war. Allerdings verfiel man als Bibliothekar schnell der Routine. Lichtblicke waren der Historiker Eckart Opitz (Spezialist für Schleswig-Holstein), ungemein anregend, der mit seinen Studenten Exkursionen machte; auch der katholische Theologe, Nagel, ein Hüne, der ein Institut für Theologie und Frieden gründete.
Die Beziehungen zu den Kollegen der Staatsbibliothek waren herzlich, so Georg Ruppelt, mit dem ich mehrere Ausflüge nach Wolfenbüttel unternahm, um von Paul Raabes Erfahrung und Charisma zu profitieren. Ruppelt regte auch die Gründung einer Hamburger Bibliothekszeitschrift (Auskunft) an, für die ich heute noch Beiträge liefere. Ein interessanter Kollege war auch Ralph Lansky, Bibliothekar am Juristischen Max Planck-Institut, der aus seiner Kinderzeit in Riga erzählte und mir schon damals die Neigung zum Baltikum verstärkte. Freundlich und korrekt war Horst Gronemeyer, Klopstock-Experte, der Direktor der Bibliothek.
Während der Hamburger Zeit war ich regelmäßiger Besucher der Frankfurter Buchmesse und lernte viel über das Verlagswesen. Praktikanten und Auszubildende nahm ich gern mit zum Antiquariat Paul Hennings, wo Rüdiger Fritsche sehr entgegenkommend war. Auch das Hamburger Antiquariat von Ulrich Keip wurde besucht. Es war mir bald klar, daß der bibliothekarische Nachwuchs in der Ausbildung sonst kaum etwas über das Verlagswesen und den Buchhandel, erst recht den Antiquariatshandel und Auktionen hörte, was eigentlich ja eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Natürlich habe ich selbst viel bei diesen Kontakten gelernt, sodaß ich später nicht unvorbereitet in die Laufbahn als internationaler Verlagsberater schlüpfte.
Das Jahr 1986 brachte zwei Höhepunkte: Zum einen fand in Hamburg der (damals noch existierende) Internationale Orientalistenkongreß statt, zu dem viele Kollegen aus aller Welt eintrafen. Das Organisationskomitee regte eine entsprechende Buchausstellung an, die viel Arbeit bedeutete, aber eine wertvolle Erfahrung war. Bei den zahlreichen Beiträgern und der relativ geringen Vorlaufzeit kamen manche Texte relativ spät, und schließlich waren nur noch 4 Wochen für die Herstellung übrig. Der Franz Steiner Verlag, im Orientalia-Bereich wohlbekannt, erklärte, die Zeit sei zu knapp; und so wandte ich mich an Otto Zeller, der einen sprachwissenschaftlichen, hauptsächlich Nachdruckverlag in Osnabrück führte, um Hilfe. Dank seines Engagements kam dann der Katalog rechtzeitig heraus.
Der andere Höhepunkt war ein Anruf von Generaldirektor Ekkehard Vesper von der Berliner Staatsbibliothek, der bei meiner Frau anfragte, ob sie gegebenenfalls bereit wäre, nach Berlin zu ziehen. Sie sagte prompt ja, obwohl damals West-Berlin ja eine Insel und der Wohnsitz mit einigen Einschränkungen verbunden war. Herr Vesper reagierte auf meine Bewerbung bei der Staatsbibliothek in der richtigen Erkenntnis, daß eine entsprechende Entscheidung sehr stark von der Ehefrau des Kandidaten abhing. So wurde ich Leiter der Abteilung Überregionale Bibliographische Dienste. Die Staatsbibliothek war mir als große Universalbibliothek auch für meine privaten Interessen sehr angenehm, insbesondere die Orientalia und Ostasiatica, und vor allem Rainer Krempien war mir ein lieber Freund und Anreger. Schon seinen Vorgänger, Wolfgang Seuberlich, hatte ich geschätzt; er besuchte uns gelegentlich in Hamburg.
Auch die Versetzung nach Berlin verlief nicht ohne Komplikationen. Das übliche amtsärztliche Gutachten monierte einen stark erhöhten γGT-Wert, was nach damaligem populärem Verständnis den Patienten zum Alkoholiker stempelte. Auf ärztlichen Rat enthielt ich mich monatelang jeglichen Tropfens Alkohol - daraufhin stieg der Wert noch! Was tun? hieß schon wieder die Frage. Auf den Rat eines Internisten wurde eine Leberbiopsie gemacht, deren Ergebnis den vermuteten Alkoholismus ausschloß.
Die Stelle in Berlin war interessant. Sie umfaßte damals folgende Aufgaben: Leitung und Ausbau der Zeitschriftendatenbank, eines weltweit einmaligen Gesamtkatalogs von Zeitschriften und Serien in deutschen Bibliotheken; einer Normdatei von Körperschaften, die für die ZDB notwendig war; eine Bibliographie der Bibliographien (als Zettelkatalog) und einer ebensolchen für Fortschrittsberichte (ebenfalls Zettelkatalog); darüber hinaus, für eine Bibliothek eher ungewöhnlich, die Internationale ISBN Agentur für die Leitung und Verbreitung des internationalen Buchnummernsystems. Eine kleine Arbeitsstelle war noch das SAZI, Standortverzeichnis von ausländischen Zeitungen und Illustrierten. Auf den ersten Blick erscheint dieses Arbeitsfeld recht übersichtlich; es erwies sich aber als recht komplex, da sich die Bibliothek (samt der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die als Träger fungierte) nicht zu einer eigenen umfassenden Datenverarbeitung entschließen mochte. So mußten die IT-Aufgaben, die fast täglich an Bedeutung gewannen, in Verhandlungen mit dem Deutschen Bibliotheksinstitut abgeklärt, geplant und ausgeführt werden (das wurde später nicht viel einfacher, nachdem das Institut wegrationalisiert wurde, und erst Göttingen, dann die Deutsche (National-) Bibliothek in Frankfurt Partner wurden). An äußeren Ereignissen kam bald die deutsche Vereinigung hinzu, die die Staatsbibliothek vor eine komplizierte Integrationsaufgabe, die Abteilung dagegen zusätzlich vor die Betreuung der neuen Bundesländer stellte. Hier leisteten die Mitarbeiter Enormes, und stellvertretend für alle sei Günter Franzmeier genannt. Mir lag die Verbesserung und Ausweitung der ZDB sehr am Herzen, und hier boten sich dank der zunehmenden Automatisierung neue Möglichkeiten. Bis dahin umfaßte die ZDB Westdeutschland mit Ausnahme Bayerns - Bayern hatte mit den Arbeiten etwas früher angefangen und nach einer etwas älteren Fassung des Regelwerks gearbeitet, weshalb man die bayerischen Daten nicht einfach in die ZDB integrieren konnte. Zwei große Datenressourcen nebeneinander zu betreiben, war aufwendig und unnötig. Aber langjährige Verhandlungen mit München waren frustrierend und ergebnislos verlaufen, die Deutsche Forschungsgemeinschaft sah sich nicht zuständig, da schon reichlich Mittel in den Aufbau der Ressourcen geflossen waren. Bei einem Gespräch mit Generaldirektor Richard Landwehrmeyer sagte dieser mir, weitere Bemühungen seien überflüssig und nicht aussichtsreich. Als ich insistierte und darauf hinwies, daß der neue Münchener Direktor Hermann Leskien sehr pragmatisch sei, meinte er, ich könne gern mein Glück versuchen. Was ich tat, und es kamen positive Signale aus München. Die Arbeiten erstreckten sich über einige Jahre, da sie im wesentlichen als Eigenleistung erbracht werden mußten. Nach 1989 wurde umgehend der Kontakt zu den größeren Bibliotheken der DDR aufgenommen und in Gesprächen mit den Kollegen darauf hingewiesen, daß möglichst schnell mit der Zusammenarbeit mit der ZDB angefangen werden müßte, um Doppelarbeiten zu vermeiden. So wurde die ZDB das erste flächendeckende Bibliotheksprojekt. Eine weitere wichtige Aufgabe war die Kooperation mit Österreich, wo die Lage ähnlich war wie in Bayern - es bestand eine weitgehend nach ZDB-Konventionen geführte Datenressource, und auch hier war die Integration eine Geduldsarbeit, die jedoch von beiden Seiten mit gutem Erfolg betrieben wurde. Ein weiterer Ausbau der ZDB, besonders Richtung Osten, wurde getestet (so in Litauen), scheiterte aber an den fehlenden Ressourcen (insbesondere im IT-Bereich) in Berlin.
Mit der Reorganisation der Staatsbibliothek und dem generellen technischen Fortschritt wurden die Mittel knapper, und so wurde entschieden, die Dokumentationsarbeit der Abteilung einzustellen. Zettelkataloge weiter auszubauen, war ohnehin nicht zeitgemäß, die mit viel Aufwand erstellten Dateien aber zu entsorgen, wäre unverantwortlich gewesen. So schien es mir am sinnvollsten, die Daten in Buchform als abgeschlossenes Unternehmen zu publizieren, wobei Klaus Saur, ein klarsichtiger, zupackender, risikobereiter Verleger, bereit war, die Internationale Bibliographie der Bibliographien in 11 Quartbänden zu publizieren, der Verlag Vittorio Klostermann die Fortschrittsberichte in einem Band.
So blieb als ein wichtiges Arbeitsgebiet, das besondere Förderung benötigte, die Zeitungen (ursprünglich SAZI) mit seiner fleißigen und begeisterten Bearbeiterin Marieluise Schillig. Hier sind große Fortschritte gemacht worden, so in der Erfassung der Bestände der (vereinigten) Staatsbibliothek und der umfangreichen Sammlungen der SAPMO (Parteipresse der DDR) dank der Förderung durch die DFG. Ein nationales Projekt auf die Beine zu stellen gelang jedoch nicht, da die Partikularinteressen zu stark waren. Zwar half die Arbeitsgemeinschaft Zeitungen, die ich ins Leben gerufen hatte, das Bewußtsein für die Vorteile der Zusammenarbeit zu schärfen, doch als endlich eine gemeinsame Basis geschaffen war und ein Förderungsantrag gestellt wurde, hatte sich die DFG bereits anderen Projekten zugewandt und für eine solch teures Unternahmen keine Mittel (und wohl auch kein Interesse) mehr.
Zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit hatte ich mich frühzeitig in der IFLA engagiert und diente etliche Jahre als Vorsitzender des Komitees für Fortlaufende Sammelwerke und knapp 20 Jahre als Vorsitzender des Runden Tisches für Zeitungen (heute: Section for Newsmedia). Die erstere Aufgabe brachte mich in Zusammenarbeit mit dem Centre ISDS (heute: ISSN International Centre), das eine etwa gleichgroße Datenbank wie die ZDB unterhält, aber zu bibliographischen Zwecken, ohne Besitznachweise. Diese Kontakte führten zu einer Nachführung der zahlreichen inzwischen vergebenen ISSN (Standard-Seriennummern) in der ZDB, um die Titelaufnahmen international verknüpfen zu können (DFG-Projekt). Die im Rahmen der IFLA geleistete Zeitungsarbeit ist dokumentiert in einer eigenen Publikation Newspapers on the Mind. Es war eine kleine, aber höchst aktive und motivierte Arbeitsgruppe, die innerhalb kurzer Zeit eine ziemliche Wirkung entfaltet hat. Mir schien von Anfang an, daß es nicht ausreichend sei, während der jährlichen Generalversammlung einige Zeitungsvorträge anzubieten. Die Arbeit müßte intensiver werden. So schlug ich regionale Zeitungskonferenzen im Frühling vor, und ein erster Versuch wurde in Ottawa gemacht, wo die Mitarbeiter der Nationalbibliothek Interesse äußerten, Näheres über die Arbeit der Gruppe zu erfahren. So wurden in den folgenden Jahren 2-3tägige Konferenzen abgehalten, von Santiago de Chile bis Shanghai, und vom Polarkreis bis Kapstadt. Die wichtigsten Beiträge wurden in zehn Sammelbänden (meist als IFLA Publications) veröffentlicht, teils sogar zweisprachig (spanisch, russisch). Es war vergleichsweise einfach, die Konferenzen zu realisieren - als ständiger Gast der Conference of Directors of National Libraries (auf Grund meiner anderen Aufgaben) hatte ich es leicht, Kollegen anzusprechen und für eine Konferenz zu gewinnen. So waren die lokalen Organisationskosten abgedeckt, und die Teilnehmer mußten sich selbst um die Bestreitung der Reisekosten kümmern. Es gab durchaus Teilnehmerzahlen von 100 Personen. Ein wichtiger Faktor war die erwähnte Publikation von Beiträgen; diese Praxis ist leider von der Sektion nicht fortgeführt worden, sodaß sich die Auswirkung solcher Tagungen auf die Teilnehmer beschränkt.
Und schließlich die letzte (oder vielmehr vorletzte) Aufgabe, die Verbreitung und Verwaltung der weltweiten ISBN (Standard-Buchnummer). Dieser Identifikator wurde in den 1966er Jahren konzipiert, bald als ISO-Standard approbiert und seit etwa 1972 von einer Internationalen Agentur geleitet. Daß sich diese Agentur in West-Berlin befand, war eine Entscheidung des ISO TC46 auf Vorschlag des Sekretariats, das damals vom DIN (Sitz: West-Berlin) betreut wurde. Wegen der prekären politischen Situation war West-Berlin an internationalen Organisationen sehr interessiert. Als ich die Leitung der Agentur übernahm, gab es gleich ein politisches Ereignis: Die DDR hatte jahrelang Kontakte zur Staatsbibliothek (vorher: Westdeutsche Bibliothek in Marburg) abgelehnt, weil es sich ja um Bücher handelte, die eigentlich Unter den Linden stehen sollten. Nun war man aber unter dem Druck der Verlage entgegenkommender geworden – es stellte sich heraus, daß die Buchdistribution sich schnell auf die ISBN umgestellt hatte, und um die ISBN zu bekommen, mußte also die DDR einen Antrag an die Internationale Agentur stellen, die just bei der gescheuten Bibliothek ansässig war. 1987 fand daher die Jahresversammlung der ISBN in Leipzig statt - sehr erfolgreich. Die DDR-Verlage bekamen ISBN, sie konnten ihre Veröffentlichungen nun im Verzeichnis lieferbarer Bücher siegeln und waren der westlichen Vertriebskette angeschlossen. Eine nationale Agentur wurde bei der Deutschen Bücherei in Leipzig eingerichtet.
Neben der Standardsbetreuung waren jährlich Anwendertreffen zu organisieren, außerdem Fortbildungsseminare in verschiedenen Ländern. In den zwanzig Jahren meiner Leitung kamen die meisten lateinamerikanischen, afrikanischen und asiatischen Länder hinzu, auch die postsowjetischen Republiken, sodaß heutzutage fast keine Möglichkeit mehr besteht, ein Buch ohne ISBN zu verkaufen. Der Vertrieb ist schneller und billiger geworden, und so ist dieser Standard erziehungs- und kulturpolitisch von großer Bedeutung. Nach meinem Eintritt in den Ruhestand wanderte die Internationale Agentur nach London, von wo sie ihre Tätigkeit erfolgreich fortsetzt.
Ein Sproß der ISBN Ist die ISMN (Internationale Standard Musikaliennummer); der Standard wurde 1993 verabschiedet und identifiziert Musikalien (Noten), unabhängig vom Medium. Im Prinzip hätte man die Identifikation mit der ISBN leisten können - technisch war das kein Problem. Aber es stellte sich heraus, daß einige ISBN-Agenturen es ablehnten, Musikalien zu verwalten, es war doch ein ganz anderes Medium, mit einer eigenen Sprache, die viele nicht lesen konnten. Auch die Musikverlage und Musikaliendistribution war anders organisiert, die Musikverleger fühlten sich mehr als Künstler und Kulturschaffende und „konnten" nicht mit den „geldgierigen" großen Buchverlagen. Insofern schloß der ISBN-Standard (ISO 2108) Musikalien ausdrücklich aus. Auch die Bibliotheken betrachteten die Musikalien als etwas anderes, genau wie die Orientalia - sie wurden in gesonderten Katalogen und Abteilungen geführt. So wurde also parallel zur ISBN die ISMN geführt; allerdings wurde sie später von London nicht mit übernommen und blieb bis heute in Berlin. Die Seele des Geschäfts ist Carolin Unger. Allerdings soll dieses Jahr 2019 einen Generationswechsel bringen.
Wichtig für beide Agenturen war die Pflege eines Verzeichnisses (dann: Datenbank) der vergebenen Verlagsnummern und der Metadaten; früher wurden sie von Klaus Saur in stattlichen Bänden jährlich veröffentlicht; inzwischen liegen die Daten nur noch online auf.
Beim Blättern im folgenden Verzeichnis gibt es etliche Sparten, die keiner weiteren Erklärung bedürfen – Bibliographie, Bibliothekswesen, Buch- und Druckgeschichte gehören ja zum Beruf; und wenn der Autor einen orientalistischen Hintergrund hat, so konzediert man ihm auch die Anwendung in diesem Bereich. Auffällig ist die große Anzahl von Beiträgen, die sich mit Leben und Werk von Gelehrten, Edition von unpubliziertem Material, Manuskripten und Briefen befaßt. Wie kam es dazu? Mein Lehrer Fuchs (1902–1979) wußte sehr fesselnd von seiner Zeit in China (22 Jahre!) zu erzählen, von den anderen Gelehrten dort, seinen Bekannten und seinen Erlebnissen. Bald wurde das ein eigenes spezielles Interessengebiet, zumal sich damals kaum jemand ernsthaft damit befaßte. Es kam hinzu, daß innerhalb des Faches einschlägige Arbeiten zwar gern genutzt wurden, aber sie qualifizierten nicht und waren einer Karriere eher schädlich. Ausnahmen wurden nicht gemacht: In einem Fall wollte sich ein Kollege mit Zustimmung und Förderung seines (durchsetzungsfähigen) Betreuers mit einer exzellenten Studie zur Sinologiegeschichte habilitieren – die Fakultät stellte sich geschlossen dagegen. Man konnte sich solche Arbeiten eben nur erlauben, wenn man im Fach nicht reüssieren wollte. So hatte ich ein riesiges potentielles Arbeitsfeld – nur die Zeit fehlte.
Bei dieser Arbeit ergaben sich immer wieder Überraschungen; so sei hier nur das Beispiel von Hauptmann F. M. Trautz (1877-1952) genannt, der sich Anfang des 20. Jahrhunderts in Kriegsgeschichte qualifizierte. Nachdem Japan Rußland seine militärische Überlegenheit gezeigt hatte, lernte Trautz Japanisch, besuchte die Schlachtfelder und plante, das japanische Generalstabswerk zu übersetzen. Der Ausgang des Weltkriegs machte seine früheren Berufspläne zunichte, und er promovierte in Japanologie - da es Japanologie als Fach an der Berliner Universität nicht gab, sprang der Direktor am Völkerkundemuseum F.W.K. Müller, ein Linguist und Museumsmann von hohen Graden, als Gutachter und Betreuer ein. Als ich in Bonn Japanisch bei Prof. Herbert Zachert hörte, erfuhr ich, daß sich der Nachlaß dieses Japanologen, der später Leiter des Berliner Japaninstituts geworden war, im Institut befand, genauer: im Schrank im Direktorzimmer. Als ich mein Interesse kundtat, wurde mir großzügig erlaubt, alles durchzusehen. Besonders ins Auge fiel mir ein umfangreiches Konvolut (aus japanischen Heften), das (mit zahlreichen handschriftlichen Korrekturen versehen) eine Übersetzung der großen Biographie (etwa 1500 Seiten) des bedeutenden Japanforschers Philipp Franz von Siebold enthielt. Autor war der japanische Arzt KURE Shûzô (1865-1932), der bei seinem Hinscheiden Trautz gebeten hatte, diese Aufgabe zu übernehmen, was dieser denn auch, mit Hilfe einiger Mitarbeiter, tat und 1938 abschloß. Das Werk ging in Japan in Druck, allerdings waren davon nur etwa 80 Korrekturfahnen zu finden; wegen des Kriegs mußte das Unternehmen abgebrochen werden. Ein enormes, sorgfältig bis ins Detail ausgearbeitetes Werk – was für ein Schatz von Informationen! Die Übersicht über den Nachlaß und über Trautz' Schriften druckte das Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung, aber das umfängliche Sieboldwerk, nein, da winkten alle Verlage ab; da halfen auch keine Gutachten, die ich besorgt hatte, so von Joseph Needham (1900-1995), dem Historiker der ostasiatischen Naturwissenschaften, und von Hanno Beck (1923-2018), dem bedeutenden Geographen. Erst das Siebold-Jubiläum 1996 brachte eine Wende: Josef Kreiner, damals Direktor des nach Siebold genannten deutschen Forschungsinstituts in Tokyo, griff das Projekt auf, und pünktlich konnte das Werk in 2 stattlichen Bänden vorgelegt werden. Als Dankeschön wurde ich nach Tokyo zu einem Siebold-Vortrag eingeladen - mein erster Besuch in Japan (damals noch etwas Besonderes). In der Folge gelang es mir, die als verschollen betrachtete Dissertation Trautz', von der nur 1 Exemplar existierte, ausfindig zu machen und daraus seine Beiträge über japanische Stûpas (Pagoden) nach den Forschungen des japanischen Architekten ITÔ Chûta (1867-1954) zu publizieren. Dadurch rückte Trautz in die Reihe der Pioniere der Erforschung der japanischen Stûpas. Dank eines weiteren umfassenden Nachlaßteils im Archiv des Auswärtigen Amtes konnte Trautz' Rolle als Gründungsdirektor des Deutschen Forschungsinstituts Kyôto dokumentiert werden; weiteres Material gab Auskunft über seine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Eine 2011 für ein Bonner Symposium konzipierte kompakte Darstellung von Leben und Werk Trautz' erschien vor einigen Monaten.
Eine andere interessante Persönlichkeit war der in Wien geborene Joseph Francis Rock (1884-1962), der als abenteuerlustiger junger Mann in die USA emigrierte, schließlich in Honolulu ankam und dort bei der Fortverwaltung Arbeit fand. Er machte sich gut und veröffentlichte schließlich Standardwerke zur hawaiianischen Botanik (als deren zweiter Vater er gilt, nach Wilhelm Hillebrand, 1821-1886); als man den jungen Mann fragte, wo er denn seine stupenden botanischen Kenntnisse erworben habe, sagte er selbstbewußt, er habe schließlich an der Universität Wien promoviert. Freilich gibt es dafür aus heutiger Sicht keine Anhaltspunkte. Und so wurde Rock Professor für systematische Botanik in Hawaii. Rock wurde Hawaii bald zu eng, und so ging er auf botanische Forschungs- und Sammelreisen nach Burma und China, wo er sich in der Provinz Yunnan in einem Naxi-Dorf niederließ, einer ethnischen Minderheit mit einer eigenen Kultur und Ritualen, die in einer speziellen Bilderschrift (gänzlich verschieden von der chinesischen Schrift) niedergeschrieben wurden. Rock wurde unversehens zum Pionier der Naxi-Forschung, er sammelte etwa 10000 Handschriften, übersetzte eine Reihe mit Hilfe einheimischer Priester und veröffentlichte ein zweibändiges enzyklopädisches Naxi-Wörterbuch ... Rock erwies sich als eine faszinierende Persönlichkeit – er schrieb interessante Reiseberichte, war ein ausgezeichneter Photograph, hatte umfangreiche botanische und ornithologische Sammlungen angelegt und seinen Nachlaß schließlich zwei Institutionen vermacht, dem Kgl. Botanischen Garten in Edinburgh und der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, die das Material der Berliner Staatsbibliothek weitergab. Aber auch das Hunt Institute of Botanical Documentation (Pittsburgh) besaß Rockiana, so die University of Washington in Seattle, das Bishop Museum in Honolulu usw., sodaß die vordringlichste Aufgabe darin bestand, erst einmal eine Grundlage zu legen und Information über die verschiedenen Nachlaßteile zusammenzustellen. Auf einen ersten Band in den Supplementen zum Verzeichnis der orientalischen Handschriften folgten dann weitere, von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften publizierte Bände, darunter eine Phytogeographie West-Chinas, ein Werk, das Rock für die Royal Horticultural Society geschrieben hatte, die dieses aber dann doch nicht veröffentlichen mochte, weil man sich mehr auf schöne Bildbände für die Kaffeetafel kaprizieren wollte.
Ein Gelehrter von Rang war auch der in Petersburg an der Akademie der Wissenschaften tätige Anton Schiefner (1817–1879), der in Reval geboren, zunächst Jura studierte, dann aber seiner Neigung folgend, Philologie in Berlin, wo er sich mit namhaften Gelehrten befreundete. Er unterhielt ein weitgespanntes Netzwerk in Europa, sodaß die erhaltenen Korrespondenzen einen lebendigen Eindruck von der Geschichte der Linguistik während etwa 30 Jahren bieten. So führte er eine umfangreiche Korrespondenz mit dem Berliner Indologen Albrecht Weber, er arbeitete in Petersburg mit dem Embryologen Karl Ernst von Baer, dem Indologen Otto Böhtlingk und dem Kulturhistoriker Victor Hehn zusammen, war in engem Kontakt zu dem Arzt Friedrich Reinhold Kreutzwald, einem der Väter der estnischen Literatur und des „Nationalepos" Kalewi-poeg, er schuf die erste deutsche Übersetzung des Kalewala nach dem Manuskript von Elias Lönnrot, eine metrische Übersetzung der Heldenlieder der Minussinsker Tataren, dabei war er hauptamtlich für die Akademiebibliothek sowie das Referat Tibet zuständig, gab eine deutsche Ausgabe der Werke des Forschungsreisenden M. A. Castrén heraus und bearbeitete und übersetzte die linguistischen Forschungen des Barons von Uslar über die Kaukasusvölker. Die lange ignorierten Briefwechsel erwiesen sich als hoch interessant, sodaß auf den ersten Band inzwischen zwei weitere folgten; ein vierter ist gerade durch die Begutachtung gegangen, und das Material für einen letzten, fünften, liegt bereit und kann hoffentlich auch, Deo volente, publiziert werden.
So könnte man vieles erzählen von einzelnen Persönlichkeiten, von überraschenden Funden, von interessanten Kontakten ....
Faszinierend fand ich auch das Mandschu, eine tungusische Sprache mit eigener Literatur, die Muttersprache des letzten in China regierenden Kaiserhauses. Ohne Kenntnis dieser Sprache läßt sich so manches in der Geschichte der Dynastie nicht verstehen – eine Erkenntnis, die sich allerdings erst in den letzten Dezennien allmählich durchgesetzt hat. Das Forschungsfeld ist übersichtlich – es gibt kaum mehr als 20 ernsthafte Forscher weltweit, wobei in Europa ein Generationswechsel zu bemerken ist. Schon der historische Hintergrund ist faszinierend: Einige tungusische Stämme im Norden Chinas wurden von einem charismatischen Häuptling zusammengeführt – er forderte das chinesische Reich heraus und innerhalb weniger Dezennien gelang es den Eroberern nicht nur, in China festen Fuß zu fassen, sondern dem Reich auch zwei seiner bedeutendsten Kaiser zu schenken, den Kangxi- und seinen Enkel, den Qianlong-Kaiser, die beide 60 Jahre lang regierten und eine Blütezeit herbeiführten, die selbst in Europa nicht unbeachtet blieb. Innerhalb weniger Dekaden wurde eine Schrift eingeführt und eine eigene Literatur begründet - das Mandschu und das Chinesische waren beide Reichssprachen, und die Verwaltung wurde zweisprachig geführt. Auf dieses spannende Gebiet wurde ich durch meinen Lehrer Fuchs geführt, der 1925 als Deutsch- und Lateinlehrer in Mukden (heute: Shenyang) tätig wurde und sich bald für die noch vorhandenen, damals wenig geschätzten Mandschu-Bücher interessierte. Seine Abhandlung über die Mandschubibliographie und Literatur (Tokyo 1936) ist bis heute ein wertvolles Standardwerk. In der Folge habe ich, ähnlich wie auch Martin Gimm und Giovanni