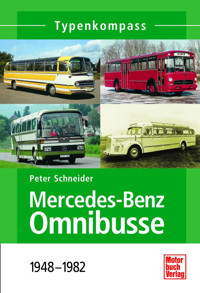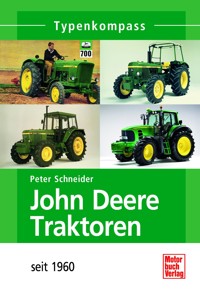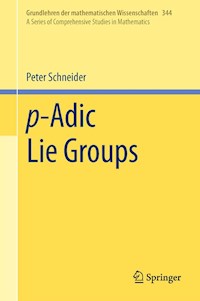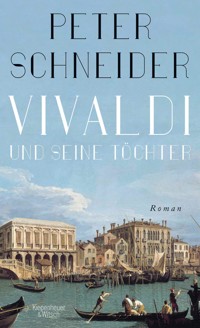23,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
‹Die old, die hard› – älter zu werden macht keine Freude. Das gilt für manche schon mit 22, andere haben erst Mühe damit, wenn die Gicht sie plagt. Aber irgendwann, ob mit 45 oder 65, spüren alle, wie das Leben die Richtung wechselt: Es geht nicht mehr scheinbar endlos vorwärts, sondern auf das Ende zu. Der Psychoanalytiker Peter Schneider und die Journalistin Andrea Schafroth unterhalten sich über die kleinen und grossen Dinge, die einem beim Älterwerden passieren: Sind wir alt, wenn wir uns über Software-Updates ärgern? Gibt es einen ‹guten› Tod? Wird die Menopause überschätzt? Warum haben wir keine Lust aufs Altersheim? Ist Sex mit 80 noch empfehlenswert? Wie in ihrem ersten Dialogbuch ‹Cool down – wider den Erziehungswahn› werfen sie Klischees über Bord, hinterfragen fixe Vorstellungen und vermeiden einfache Antworten. Das ist mal lustig, mal nachdenklich, mal überraschend, mal schonungslos – und manchmal auch altersmilde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Titel
Vorwort – oder warum wir fast forward von der Kindheit zum Alter gesprungen sind
I. Der Anfang
Wann bin ich alt?
Vom «U-» zum «Ü-» und bis zum goldenen Plus
Was kommt nach dem «Gold»?
Erste Altersanzeichen: Müdigkeit und Matratzen-Talks
Senile Feuchtgebiete
Je schneller desto langsamer
Die liebe Mühe mit der Technik
Von Macken und Nostalgie
II. Das Ende
Der Anfang vom Ende
Helfen Ruhm und Ehre?
Der Sinn des Lebens
Zurückblicken statt nach vorne
Begrenztheit des Lebens – Zumutung oder ein Glück?
Zwischen den Welten
Wenn das Sterben alltäglich wird
Aktivierung gegen den Altersblues?
Gibt es einen wünschenswerten Tod?
Exit oder der Wunsch nach Selbstbestimmung
Vorkehrungen für das eigene Ableben
III. Und alles dazwischen
Am Anfang steht die Menopause
Kleiner Knigge fürs Alter?
Sex im Alter
Spuren verwischen: Botox und Co.
Wenn Gesundheit nicht mehr der Normalfall ist
Wie teuer darf das Alter sein?
Die Alten, marktwirtschaftlich betrachtet
Altersdiskriminierung
Länger arbeiten – aber keiner will dich
Pensionierung – was nun?
Altersweise oder lächerlich?
Die Alten regieren die Welt
Macht das Alter konservativ?
Wohnen im Alter(sheim)
Selbstbestimmung versus Bevormundung
Daheim bleiben – koste es, was es wolle
Wie altersgerecht sind altersgerechte Wohnformen?
Hommage ans Alter
Leicht ist es nicht
Niemals reif fürs Alter
Massaker oder Erleuchtung?
Was wir tatsächlich gewinnen
Hommage an die wirklich Alten
P.S. Glücklich alt werden
Über die Autoren
Backcover
Andrea Schafroth/Peter Schneider
JUNGBLEIBEN IST AUCH KEINE LÖSUNG
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016 – 2020 unterstützt.
© 2020 Zytglogge Verlag,Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Ladina Fessler
Andrea Schafroth/Peter Schneider
JUNGBLEIBENIST AUCH KEINELÖSUNG
Ein Buch übers Älterwerden
Für Ruth, Heinz und Samuel
Für meinen Vater, Paul Schneider (PS)
Vorwort – oder warum wir fast forward von der Kindheit zum Alter gesprungen sind
Dies ist unser zweites gemeinsames Buch. Das erste erschien vor genau zehn Jahren ebenfalls in diesem Verlag. Mit dem Titel ‹Cool down. Wider den Erziehungswahn› haben wir uns damals in einen Diskurs eingemischt, der uns beiden gehörig auf die Nerven ging: Es war der Höhepunkt des pädagogischen Diskurses der «Grenzen setzen!»-Imperative, der Warnungen vor Tyrannenkindern und der Klagen über den Niedergang der Disziplin, den die 68er-Generation angeblich verursacht hatte. Vieles, was in den damals erschienenen Erziehungsratgebern und warnenden Pamphleten verkündet wurde, war offenkundig absurd und realitätsfremd, dennoch verkauften sich diese wie warme Weggli.
Es war die Zeit der pädagogischen Horrorstorys, der Geschichten darüber, was passiert, wenn Kinder nicht die Strenge, die Rituale und die die Belohnungs- und Bestrafungssysteme bekommen, die sie von Natur aus brauchen. Zucker und Bildschirmzeit wurden zur Bedrohung erklärt und als Gefahr für die Gesundheit und Zivilisation gebrandmarkt. Im Kinderzimmer wurde nichts Geringeres als die Zukunft der Menschheit verhandelt und ausgefochten. Was uns angesichts dieser Gefahren drohte, konnte man im Fernsehen sehen, wenn die «Super-Nanny» die Suppe auslöffeln musste, die sich die bildungsferne Unterschicht mit ihren Bälgern eingebrockt hatte, weil sie nicht aufgeklärt war über die Risiken von Fastfood, Computerspielen und Disziplinlosigkeit.
Inzwischen hat sich die Drohgebärde in der Erziehung zum Commonsense verfeinert. Es ist heute völlig normal, dass Eltern die Bildschirmzeiten ihrer Kinder über eine App kontrollieren; Schulen organisieren obligatorische Elternabende, an denen man gemeinsame Regeln zum Umgang mit den neuen Medien erstellen soll; Pausenkioske verkaufen zuckerfreie Vollkornbrötchen und Teenager essen ganz von alleine nur noch gesundes Grünzeug. Ob das für alle so richtig ist und alles andere die Kinder tatsächlich ins Verderben und die Gesellschaft in den Abgrund führt, ist keine Frage mehr.
Es erschließt sich vermutlich nicht auf den ersten Blick, was unser damaliges Buch gegen vorgestanzte Normativitäten im Eltern-Kind-Verhältnis mit diesem Buch über das Altern verbindet. In diesem Fall gibt es keine Ratgeberliteratur, in denen ein strenges Vorgehen gegen die unbotmäßigen Alten gefordert wird. Aber unter dem Stichwort der Überalterung und dem Deckmantel demographischer Besorgnis und mithilfe der Kalkulationen der Summen, welche an multimorbide Alte verschwendet werden – ungeachtet der Tatsache, dass diese ja doch nicht mehr lange leben – wird eine Ideologie etabliert, die altersdiskriminierend zu nennen recht euphemistisch ist. So wie man auf der Hut sein muss, damit die Kinder nicht zu Tyrannen werden, gilt es auch aufzupassen, sich nicht von den Alten die Butter vom Brot nehmen zu lassen.
Der Diskurs über das Alter zielt eher auf Selbstdisziplin als auf Gehorsam und Kontrolle ab, aber er funktioniert nicht minder normierend: Als alternder Mensch solle man sich rechtzeitig mit seiner Patientenverfügung beschäftigen; man solle sich Gedanken darüber machen, wie man leben wolle, wenn die Kinder ausgezogen sind; man müsse sich mit der Vorstellung eines guten Sterbens beschäftigen. «Als alter Mensch wolle man doch ...»; «... gerade für alte Menschen sei es wichtig, dass ...». Solche Aufforderungen sind zwar nicht direkt erzieherisch, aber doch erfüllt von gütiger Strenge. Über eine Rhetorik vermeintlicher Selbstverständlichkeiten werden abweichende Meinungen und Einstellungen als Uneinsichtigkeit und Starrsinn diskreditiert: Wer anders altern will, als es vorgesehen und durch institutionelle Zwänge vorgegeben ist, wird zum Problemfall und muss sich dann halt auch nicht wundern ...
Wir hatten den laut und überzeugt vorgetragenen Gewissheiten bereits im Erziehungsbuch vergleichsweise schwache Waffen entgegenzusetzen. Eine davon war die simple Frage: Stimmt das eigentlich? Die andere: Wollen wir wirklich auf der Grundlage mit unseren Kindern zusammenleben, dass wir sie als potenzielle Problemfälle oder als Symptome einer kranken Gesellschaft betrachten und sie dementsprechend behandeln und bevormunden? Dasselbe gilt für den Diskurs übers Älterwerden und den Umgang mit alten Menschen, der von diesem Diskurs geprägt ist. All die vorausgesetzten Selbstverständlichkeiten sind keineswegs mehr selbstverständlich, wenn man sie den «Ist-das-tatsächlich-so?»- und «Muss-das-wirklich-so-sein?»-Tests unterwirft.
Wir entwickeln keine steilen Thesen. Allenfalls formulieren wir den Verdacht, dass an den Kindern oder den Alten etwas durchexerziert wird, das mit diesen nur sehr entfernt zu tun hat: ein normatives, oft nostalgisches Gesellschaftsmodell, das nicht trotz, sondern wegen seiner Realitätsferne so attraktiv ist. Einfache Botschaften, Regeln und Rezepte bieten Möglichkeiten zur Realitätsflucht, wie sie auch Heimat- oder Arztromane liefern. In Zeiten, in denen das Gesundheitssystem krankgeschrumpft und bürokratisiert wird, erbaut man sich gerne an der Landarztpraxis von Dr. Jonathan Menschenfreund und seiner treuen Praxisgehilfin Schwester Ingeborg. Und den teuflischen Intrigen der aus der Großstadt zugezogenen Blondine Chantal, deren modernen Verführungskünsten Jonathan dank der Hilfe Ingeborgs letztlich doch widerstehen kann.
Wir betrachten das Altern in diesem Buch aus zwei Perspektiven: Wir blicken zurück und nach vorne. Zum einen schauen wir auf jene, die noch älter sind als wir; zum anderen auf die jüngere Generation, für die wir den Beginn beziehungsweise das schon weit vorgeschrittene Stadium des Alters verkörpern. Wir sind dabei nicht auf ewige Wahr- und Weisheiten gestoßen und formulieren auch keine tiefsinnigen Aphorismen – höchstens unfreiwillig. Wir melden freilich Widerspruch gegenüber der Tendenz an, das Alter über einen Kamm zu scheren und darüber die simpelste aller Einsichten zu vergessen: dass Individualität mit dem Alter nicht verloren geht. Wobei wir mit dieser «Individualität» nicht die «Individualisierung» meinen, von der Marketing-Abteilungen schwärmen, wenn sie über das Alter reden.
I.Der Anfang
Wann bin ich alt?
(AS): «Altern beginnt mit zwanzig» titelt die Frankfurter Rundschau. «Ab 27 ist man alt!» lautet das Ergebnis einer Studie in einem Fachmagazin. «Ab dreißig geht es bergab» schreibt der Stern. Meine älteste Tochter hat an ihrem 22. Geburtstag mit ihrer gleichaltrigen Freundin darüber geklagt, wie alt sie doch jetzt seien. Früher hätten sie immer etwas vor sich gehabt: Teenager werden mit dreizehn, Alkohol trinken mit sechzehn, Abstimmen mit achtzehn und die letzte offizielle Hürde mit 21, wenn der Alkoholkonsum auch in den USA legal wird. Jetzt seien sie einfach nur erwachsen. Offensichtlich beginnt das Alter, sobald man die Kindheit hinter sich gelassen hat. Wir sind spät dran mit unserem Buch.
(PS): «Alter» ist keine klar definierbare Kategorie – außer als Altersangabe in Jahren. Aber dieses absolute Alter ist natürlich nur ein Aspekt dessen, was wir unter «Alter» verstehen. Wir altern von der Wiege bis zur Bahre, und wann man als «richtig alt» gilt, liegt im Auge des Betrachters. Für einen 17-Jährigen ist eine Dreißigjährige «richtig alt», dann, mit zunehmendem Alter, erscheinen einem solche Altersunterschiede weniger gravierend, bis einem mit neunzig 77-Jährige recht jung vorkommen mögen. Man ist so alt, wie man sich fühlt, so alt, wie es einem der Maßstab, den man auf andere anwendet, vorgibt – und all das variiert noch einmal je nach konkreter Situation. Wobei es auch Situationen gibt, in denen die Alterskategorie kaum eine Rolle spielt oder sich das ‹natürliche› Altersverhältnis (etwa hinsichtlich der gesammelten Erfahrung) umkehrt. Eine 27-jährige Dermatologin hat gewiss mehr Erfahrung mit meinen Hautflecken als ich, jedenfalls mehr medizinische. Mit anderen Worten, «Alter» ist ein relativer Begriff, alt und jung ist man jeweils nur im Vergleich.
Es macht also keinen Sinn, sich mit steilen Thesen zu überbieten, ab wann man alt ist: ab 21, 30, 65 oder erst mit 90. Das umgekehrte Zahlenbingo zur Frage, bis wann man noch jung ist oder sein kann, wenn man nur will, ist nicht minder stumpfsinnig. Behauptungen wie diejenige, dass Sechzig das neue Vierzig ist, sind allenfalls sinnvoll, wenn man sie auf einen ganz konkreten Bereich bezieht. Etwa darauf, dass heutzutage das Konsumverhalten eines Sechzigjährigen demjenigen einer Vierzigjährigen mehr gleicht als noch vor vierzig Jahren.
Ein Beispiel für die Relativität des Alters: Als meine älteste, inzwischen erwachsene Tochter ein Kind war, fühlte ich mich als Mutter recht jung, mit der mittleren Tochter fühlte und fühle ich mich ‹durchschnittlich› und mit meinem jüngsten 13-jährigen Sohn komme ich mir manchmal uralt vor, zum Beispiel, wenn ich am jährlichen Weihnachtssingen der Primarschule die jungen Eltern beobachte. Treffe ich hingegen Freunde, deren Kinder alle im Alter meiner ältesten Tochter und schon länger ausgeflogen sind, fühle ich mich grün hinter den Ohren. Bei einer Bekannten ist die Situation noch ausgefallener: Sie hat mit zwanzig ihr erstes Kind bekommen, brachte mit vierzig ihr letztes zur Welt und wurde praktisch gleichzeitig Großmutter. Die Frage ist: Wird man früher alt, wenn man jung Mutter wird beziehungsweise hält es einen jung, wenn man spät Kinder kriegt? Oder ist es genau umgekehrt?
Meine Mutter war bei meiner Geburt erst 21 Jahre alt. Das war auch 1957 recht jung. Sie lag etwa drei Jahre unter dem damaligen statistischen Durchschnitt für Westdeutschland, und ich empfand sie auch als eine junge Mutter. Viele Mütter meiner Schulkameraden waren für mich alte Frauen – so wie sie angezogen waren, überhaupt in ihrem ganzen Habitus. Meine Beobachtungen gelten für eine ländlich-industrialisierte Kleinstadt und das Arbeitermilieu. Zudem sind sie natürlich vielfach getrübt durch ihren subjektiven und anekdotischen Charakter: durch die Liebe des Sohnes zu einer flotten Mutter, die unzuverlässige Erinnerung usw. Aber ich glaube, man kann dennoch sagen, dass in jener Zeit mit der Geburt eines Kindes für die Frau ein großer Alterungsschub einsetzte, vor allem in sozialer Hinsicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Porno-Genre der «MILF» in den Fünfzigerjahren entstanden ist. Frauen mit einem Kind waren damals weitgehend ‹weg vom Fenster›. Das gilt heute keineswegs, weder für eine Frau, die mit 35 oder 40 Jahren ihr erstes Kind gebärt, noch für eine Zwanzigjährige aus unserem urbanen Milieu. Beide sind auf ihre Art gleichermaßen coole Mütter. Wie alt sie sich jeweils fühlen, hängt natürlich wiederum von den Umständen ab. Als Zwanzigjährige unter Vierzigjährigen fühlt man sich wahrscheinlich sehr jung und denkt sich, dass man in zwanzig Jahren niemals wie jene werden möchte; als Vierzigjährige unter Zwanzigjährigen fühlt man sich eher alt, vielleicht aber auch jung, weil man sich SO alt dann doch wieder nicht fühlt. Was eben damit zusammenhängt, dass das Alter nicht nur im Vergleich entsteht und variiert, sondern auch situationsabhängig schwankt.
Interessant ist jedenfalls, dass das Älterwerden schon in sehr jungen Jahren thematisiert wird und uns quasi ein Leben lang beschäftigt.
Es gibt eben ganz verschiedene Motive, warum man es thematisiert. Die Jungen beschäftigen sich vielleicht mit dem Alter, weil sie erwachsener werden und sich von den Alten nichts mehr sagen lassen oder mindestens doch nicht mehr als Jungspunde abgetan werden wollen. Wer sehr auf sein Aussehen und auf seine Fitness achtet, kämpft schon in jungen Jahren gegen die Symptome des Alters. In dem Fall mag auch Koketterie im Spiel sein, man zeigt, wie jung man sich fühlt, obwohl man doch (angeblich) schon so alt ist. Wie auch immer: Es ist nicht dumm, sich mit dem Alter zu beschäftigen. Es ist etwas, auf das man sich sinnvollerweise früh genug vorbereitet, nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht.
Vom «U-» zum «Ü-» und bis zum goldenen Plus
Altern kann man mit zwei unterschiedlichen Modellen beschreiben: einem Zuwachs- und einem Verlustmodell. Kinder beschreiben ihr Älterwerden meistens nach dem Zuwachsmodell, wenn sie es denn überhaupt tun: Sie können zu einem gewissen Zeitpunkt etwas, was sie vorher noch nicht konnten. Sie sind nun nicht mehr zu klein, um alleine dieses oder jenes zu tun. Die Kindheit und die Jugend erscheinen als ein einziger Quell neuer Möglichkeiten. Man übersieht leicht, dass die Gewinne auch mit Verlusten einhergehen. Irgendwann ist Schluss mit dem Nuggi oder Nuschi, irgendwann bekommt man keine Geschichte mehr vorgelesen. Schon die kindliche Geschichte ist eine Geschichte von Weichenstellungen: So viel Neues kommt hinzu, so Vieles wird möglich, aber die Möglichkeiten schränken einen auch ein. Aus den hochfliegenden Erwartungen der Pubertät können schnell einmal Karrierehindernisse werden. Die 10 000 Follower auf Instagram, auf denen in der jugendlichen Phantasie die große Zukunft als Influencer beruht, erweisen sich später als flüchtige Erfolge in einem sozialen Medium, das schon bald als typisches Unterschichtsprodukt gelten könnte. Der Übergang zum Verlustmodell des Alterns kann zuweilen sehr früh beginnen: mit dem Bedauern, dass man dieses oder jenes verpasst hat. Später kommt dann die Klage über die Abnahme des Gedächtnisses oder der körperlichen Kräfte dazu. Aber zugleich wird man möglicherweise auch zufriedener und erfahrener.
Das Altern beginnt also bereits, wenn der Osterhase die Nuggis klaut. Das Zuwachsmodell erscheint mir vergleichsweise kurzlebig: Man wartet eine Kindheit lang sehnsüchtig darauf, dass man dieses kann oder jenes darf, um dann quasi nahtlos von den Us zu den Üs überzugehen. Ü-22, Ü-30, Ü-40 – kaum sind wir den Kinderschuhen entwachsen, erlauben uns solche Alterskategorien, all das zu tun, wofür wir uns eigentlich bereits wieder zu alt fühlen, zum Beispiel am Wochenende im vollen Club die Nacht durchzutanzen, den eisgekühlten Mojito oder die Bierflasche in der Hand. Ü-40-Partys sind gewissermaßen die Fortsetzung der Jugendjahre im adäquaten Altersumfeld. Früher waren solche Kategorien nicht nötig, weil unsere Eltern nicht in die Disco, sondern ins Dancing gingen und damit aufhörten, sobald sie unter der Haube waren.
Ich weiß gar nicht, wann diese «Ü»-Kategorisierung angefangen hat. Vielleicht zusammen mit diesen unsäglichen Einteilungen in X-, Y-, Z-Generationen, die ähnlich nichtssagend sind und die sozialen Veränderungen kaum realistisch abbilden. In den 1950er-Jahren diente das Alter als soziologische Kategorie dazu, die Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegsgeneration zu unterscheiden. Der Slogan der sogenannten 68er, «Trau keinem über dreißig», war nicht zuletzt gegen die durch den Nationalsozialismus geprägte ältere Generation gerichtet. Dreißig, das war damals zudem das Alter, in dem man hoffnungslos erwachsen war und verloren für den revolutionären Umschwung. 1968 war Rudi Dutschke tatsächlich erst 28; die spätere RAF-Terroristin Ulrike Meinhof jedoch bereits 34. Die theoretischen Gewährsleute der 68er wie Marcuse und Adorno bereits um die siebzig. So trennscharf war die Ü-30-Kategorie also nicht. Was die durchtanzten Nächte angeht, so sind die ein ebenso abgehalfterter Topos wie die Nächte, in denen man in der WG-Küche bei billigem Chianti und Spaghetti die Weltrevolution verhandelt hat. Heute sind wir bekanntlich entweder in der FDP oder bei der Toskana-Fraktion der Cüpli-Sozialisten. Einer schreibts bei der anderen ab, und schon verfestigt sich die Anekdote zur alterssoziologischen Struktur. Ich schätze, dass die Ü-Irgendwas-Partys vor allem Singlebörsen sind. Weil man bei den U-Irgendwas-Partys eben zu alt aussieht, hält man sich an die Ü-Partys. Dort hat man wenigstens den gemeinsamen Gesprächsstoff, dass man für so was eigentlich schon zu alt sei.
Die Kategorisierung fängt aber in der Clubszene schon mit den Ü-19- oder Ü-22-Partys an. Die 18-Jährigen wollen nicht mit den 16-Jährigen, die 25-Jährigen nicht mit den 18-Jährigen feiern. Offensichtlich bewegen wir uns ungern in einem Umfeld, in dem wir das Durchschnittsalter heben.
Dass die 18-Jährigen nicht mit den 16-Jährigen und die 25-Jährigen nicht mit den 18-Jährigen feiern wollen, ist verständlich: Die Jüngeren erinnern die Älteren zu sehr an die Krämpfe der Jugendjahre, denen sie gerade entkommen sind. Etwa ab dreißig wächst die Alterstoleranz, die Altersspanne der Freundinnen und Kollegen dehnt sich. Meine Frau ist zehn Jahre älter als ich, beste Freunde sind teils fünfzehn Jahre älter, teils gleichaltrig und teils zwanzig Jahre jünger. Student*innen sind über dreißig bis fast vierzig Jahre jünger als ich, und mit vielen von ihnen kann ich reden, ohne dass die Altersdifferenz im Vordergrund steht. Vielleicht gibt es in gewisser Hinsicht Wissensvorsprünge und in einer anderen Defizite – einmal in dieser und einmal in jener Altersgruppe. Mühsam wird es natürlich immer dann, wenn der Jüngere beziehungsweise die Ältere von nichts eine Ahnung hat, was in der Welt los ist, dann klaffen Gräben auf, die primär nichts mit dem Alter zu tun haben.
Die Ü-Partys enden mit vierzig, ab fünfzig schlittern wir in die Plus-Generation. Wobei wir uns dieser Alterskategorie frühestens mit sechzig zugehörig fühlen. Der über siebzig Jahre alte Kurt Aeschbacher gibt zum Beispiel das Magazin ‹50plus› heraus. Alterswohnungen werden für Menschen ab sechzig angepriesen, aber vor achtzig interessiert sich kaum jemand dafür. Es scheint, als wäre die Plus-Generation dazu erfunden worden, dass sich die Achtzigjährigen wie sechzig fühlen können.
Das große Alterswunder besteht darin, dass niemand sich so alt fühlt wie er ist, weil ihm die durchschnittlichen Gleichaltrigen soviel älter erscheinen. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass unsere Alterswahrnehmung angesichts einer abstrakten Zahl anachronistisch bleibt. Wir beurteilen als Sechzigjährige Achtzigjährige aus der Perspektive eines Vierzigjährigen, als der wir uns oft immer noch fühlen. Und letzteres nicht einmal zu Unrecht, denn die geistige Alterung hält durchaus nicht mit der Alterung in Jahren Schritt. Wir sind heute keineswegs als Sechzigjährige so ‹altmodisch›, wie es Sechzigjährige in den Fünfzigerjahren waren. Wir bedenken aber zu wenig, dass das inzwischen auch für die Achtzigjährigen gilt. Und der beharrliche und real existierende Jass-Kinderchörli-Handorgel-Groove der gegenwärtigen Altersheime, der auch vielen Neunzigjährigen ein Gräuel ist, lädt nicht dazu ein, sich mit sechzig als Achtzigjährige zu fühlen.
Allerdings wirken wir auf Zwanzigjährige nach wie vor so alt, wie wir sind. Oder glauben Sie, dass Sie und ich heute jünger und weniger altmodisch wirken als die Fünfzig- oder Sechzigjährigen von vor dreißig Jahren?
Es kommt darauf an, was die Jüngeren unter altmodisch verstehen. Ich sehe zum Beispiel heute so aus wie ich mir mit zehn Jahren einen älteren Herrn vorgestellt habe (und wie ich mit zehn schon gerne hätte aussehen wollen). Für die einen Zwanzigjährigen wirke ich wahrscheinlich wie ein etwas älterer Hipster; für andere völlig unmodisch, weil ich keine praktisch-sportlich-jugendliche Funktionskleidung trage. Die Codes für alt und jung sind in der Stadt anders als auf dem Land und variieren nach Schicht und Bildungsmilieu. Je informierter man als Sechzigjähriger ist, desto jünger wirkt man auf Zwanzigjährige. Entsprechend älter kommen einem 45-Jährige vor, die ihr Dorf für den Maßstab der Welt nehmen. Mit einer 25-jährigen Studentin teile ich dieselben Vorlieben auf Netflix, und wenn nicht, dann liegt das nicht primär am Alter, sondern an einer unspezifischen Geschmacksvorliebe.
Die Werbung bekräftigt das Bild der hippen Alten, in dem wir uns gerne wiedererkennen: Senioren sehen aus wie vierzigjährige Topmodels, einfach mit grau gefärbten Haaren – und bei Fielmann noch dazu mit Brille. Inkontinenz-Einlagen werden uns als modische Accessoires für die «schon länger Junggebliebenen» verkauft. Solche Begriffe, die das Alter mit Hängen und Würgen umschiffen, gibt es zuhauf. Was für ein Eiertanz ist das denn bitte?
Ja, das ist ein doofer Eiertanz. Einerseits. Andererseits funktioniert Werbung eben so. Die zeigt bekanntlich nicht neue Automodelle, wie sie malerisch bei Sonnenuntergang auf einer wunderbaren Allee im Stau stehen. Wäre es außerdem besser, wenn Inkontinenz-Einlagen als Vorboten des Altersheims verkauft würden?
Es wirkt einfach lächerlich, wie die Nöte des Alters zum Lifestyle verklärt werden. Nehmen wir den Begriff «Gold»: Schon als Jugendliche fand ich den Zusammenhang zwischen der «goldenen Hochzeit» und dem «goldenen Schuss» befremdlich. Heute erlebt der Begriff ein Revival, insbesondere im Bereich des Sports, und führt zu allerlei sprachlichen Verrenkungen: «Zumba Gold ist perfekt für aktive ältere Erwachsene» oder «Zumba Gold – ohne hüpfen und springen, für unsere erfahrenere Kundschaft». Ist das «Gold» ein Euphemismus für «verrostet» oder eine Anspielung auf Geld und Zeit des anvisierten Publikums?
Das ist nichts als ein zynischer Euphemismus. Eine Verdrehung der Wirklichkeit. Der Abstieg wird einem als Wertsteigerung verkauft.
Was kommt nach dem «Gold»?
Irgendwann wird es still um die Alten. Keine Üs, kein Plus und auch kein Gold mehr. Punktuell Beachtung finden allenfalls die glücklichen Einzelfälle: Man staunt über den Achtzigjährigen, der noch um die Welt reist, oder über die Neunzigjährige, die alleine für sich sorgen kann. Hundertjährige kommen an ihrem Geburtstag mit Bild in die Zeitung – wenn sie vom Rollstuhl aus die Kerzen ausblasen. Alle anderen verschwinden von der Bildfläche beziehungsweise im Altersheim. Endgültig alt sind wir spätestens, wenn wir marktwirtschaftlich nicht mehr relevant sind.
Wir werden in dem Maße wirklich älter, in dem wir entmündigt werden. Darum altert man im Altersheim besonders schnell. Man kann nicht mehr essen, wann und was man will, nicht mehr auf seinem Zimmer rauchen, kiffen, koksen oder was auch immer – man wird graduell entmündigt. Auch im Sozialen. Man befindet für uns, es sei doch schön, am Vierertisch zu essen und nicht immer alleine auf seinem Zimmer, an den Vortragsabenden teilzunehmen und am Adventssingen der Quartierjugend. Und wenn man hundert ist, kommt die Frau Bürgermeisterin, ob man das nun will oder nicht.
Eigentlich ist es erstaunlich, dass wir jedes Jahr feiern, um das wir älter werden, obwohl uns vor dem Älterwerden graut.
Manche tun das, manche nicht. Ich nicht. Ich mochte schon als Kind keine Kindergeburtstage, und ich mag auch heute nicht im Mittelpunkt einer Feier stehen. Ich schätze, das wird auch mit neunzig nicht mehr anders sein.
Gehören Sie zu jenen, die jedes Jahr laut seufzen, wenn der Geburtstag bevorsteht?
Nein. Mir ist mein Geburtstag wurscht. Ich halte wenig von Ritualen und Feiertagen. Ich mag es, wenn mein Alltag vor sich hinplätschert. Mir geht es außerdem im Durchschnitt besser als vor zwanzig Jahren. Und Sie so?
Ich mag meine Geburtstage sehr; je länger, je lieber – wie jeden Anlass, an dem ich es mir gut gehen lassen kann. Trotzdem frage ich mich: Warum nennen wir das Fest, das unser Älterwerden dokumentiert, ausgerechnet GEBURTStag, selbst dann noch, wenns vielleicht der letzte ist?
Wir können ja schlecht unseren Todestag im Voraus feiern, oder?
Nein, aber einen Lebenstag oder so ähnlich. Es ist doch komisch, dass wir ein Leben lang auf die Geburt fixiert sind, obwohl wir eigentlich das Altern feiern. Der neunzigste Geburtstag hat ja mit unserer Geburt nicht mehr viel zu tun.
Sie ist immerhin die Voraussetzung dafür. Aber man kann es ja auch sein lassen, seinen Geburtstag zu feiern. Ab einem gewissen Alter kommt dann allerdings wie gesagt die Gemeindepräsidentin zu Besuch und lässt sich mit einem für die Lokalzeitung fotografieren. In diesem Fall hilft eigentlich nur, sich totzustellen.
Das sage ich meinem Mann auch immer, wenn er als Vorstandsmitglied unserer Baugenossenschaft Jubilarinnen ab siebzig einen offiziellen Gratulationsbesuch inklusive Geschenkübergabe abstattet. Aber er behauptet, die Beglückwünschten freuten sich darüber. Ich frage mich, ob deren Freude echt ist oder sie sich nur aus Anstand freuen, respektive ob Sie und ich Snobs sind oder einfach noch zu jung.
Ich bin ja selber nur noch ein paar Jahre von den Siebzig entfernt; einige meiner besten Freunde sind schon drüber, und in meiner Altersbubble ist man tatsächlich so snobistisch wie Sie. Natürlich würde ich mich aus Anstand freuen und wäre gleichzeitig deprimiert. Allerdings nicht, weil die Aufmerksamkeit bekräftigt, dass ich ein bestimmtes Alter erreicht habe, sondern weil der Vereins-Geschenkkorb-Groove mich runterzieht.
Erste Altersanzeichen: Müdigkeit und Matratzen-Talks
Ein Beweis, dass meine Töchter noch blutjung sind, obwohl sie sich bereits über das Älterwerden beklagen: Sie freuen sich nicht, wenn sie jünger geschätzt werden und ihnen der Kellner im Restaurant keinen Alkohol ausschenken will. Ich kann mich erinnern, dass ich bereits mit 27 eine gewisse Genugtuung verspürte, wenn ich am Ticketschalter gefragt wurde, ob ich nicht noch Anrecht auf den Studententarif bis 25 hätte. Offensichtlich ist es also ein erstes Alterszeichen, wenn man sich darüber freut, dass man jünger geschätzt wird.
Eines von vielen möglichen Zeichen. Traditionsgemäß eines, das man in derart jungen Jahren eher bei Frauen findet. Es zeigt, dass Altern ein komplexes Phänomen ist, ein aus ganz unterschiedlichen Komponenten zusammengesetztes Gewebe. Zum Beispiel aus juristischen Normen, die festhalten, wann man etwas darf (Alkohol trinken) oder nur noch unter Auflagen darf (Autofahren, als Ärztin praktizieren). Diese gesetzlichen Bestimmungen sind verwoben mit informellen sozialen Begriffen und Vorstellungen davon, was man in welchem Alter erreicht haben sollte. Altern ist mitnichten ein ganz natürlicher Prozess. Er ist aufgeladen mit Sehnsüchten und Ängsten. Dabei können selbst die ersten Falten ein Sehnsuchtsobjekt sein, weil sie signalisieren, dass man nunmehr dem Alter der Pickel endgültig entwachsen ist und zur Cougar oder zum Sugar-Daddy gereift ist (wenn man denn solche Rollenverteilungen mag).
Noch eine Episode zum Student*innentarif: Vor Jahren habe ich in einem Modegeschäft eine virtuelle Kundenkarte angelegt. Seither zieht es mir dort bei jedem Einkauf automatisch 10% Rabatt ab. Die Reaktionen der Verkäuferinnen oder Verkäufer sind unterschiedlich. Manche machen beim Einkassieren eine freudige Bemerkung in der Art «Ah, Sie haben da übrigens noch 10% Studentenrabatt!». Andere schauen mich zweifelnd an und formulieren die Bemerkung eher als Frage. Ich sage dann jeweils: «Keine Ahnung, woher das kommt; der Rabatt hat sich irgendwie in Ihr System geschlichen, eingegeben habe ich so was nie; aber vielleicht weiß Ihr System, dass ich eine studierende Tochter habe und bringt uns durcheinander.» Wer will schon an etwas rütteln, das automatisch erfasst wurde. Den Rabatt kriege ich wohl noch bis achtzig. Vielleicht könnte ich beim Antworten noch etwas origineller werden: «Ich studiere halt etwas länger» oder «Ich möchte mich aufs Alter hin noch umorientieren und habe ein Medizinstudium begonnen».
Die Antwort mit dem Medizinstudium gefällt mir am besten. Oder man kann auch sagen, dass man leider für sein Alter immer schon sehr alt ausgesehen habe, was leider mit dem zunehmenden Alter noch schlimmer werde.
Wenn man jung ist, klagt man zwar bereits übers Älterwerden, merkt aber noch nicht viel davon. Es kam mir unglaublich vor, dreißig zu werden, und vierzig erst recht. Aber erst ab 43 fiel mir der körperliche Abbau tatsächlich auf. Auch die Altersschätzerei nimmt irgendwann eine neue Wendung: Auf einmal machen einem die Leute Komplimente wie «Sie sehen aber toll aus für Ihr Alter!» und fortan lechzen wir nach jedem Jahr, das man uns jünger schätzt.
Ein tolles Kompliment finde ich auch: «Sie müssen früher einmal eine wunderschöne Frau gewesen sein! Wohl dem, der seine soziale Bestätigung nicht immer schon nur aus seinem Aussehen, seiner Figur, seiner Sportlichkeit bezogen hat – aus jenen Faktoren also, die einen schnell nur noch in seiner Altersliga mitspielen lassen. Im intellektuellen Wettbewerb gibt es solche Ligen nur eingeschränkt: Eine sechzigjährige Molekularbiologin tritt nicht in einer anderen Kategorie an als eine 26-jährige Postdoktorandin. Dafür sorgt, dass beide an gemeinsamen Projekten arbeiten und dass das, was die eine der anderen an jugendlichem Einfallsreichtum voraus hat, die Ältere durch Erfahrung und Wissen kompensiert. Und, dass es institutionelle Faktoren gibt, welche das Konkurrenzverhältnis kanalisieren und dämpfen: Die Stufenleiter der akademischen Karriere kann man nicht hinunterfallen, man kann höchstens stagnieren. Auch wenn man in der Forschung längst von den Jüngeren abgehängt ist, steht man als Institutsleiterin dennoch im Glanz der Erfolge der nachfolgenden Generation da. Und das ist eine stabilere Position als die einer «Missen-Mom».
Heißt das, die Molekularbiologin wird glücklicher alt als Heidi Klum?
Vermutlich. Mindestens weniger angestrengt.
Heidi und Co. machen uns vor, dass äußerliche Alterszeichen wie graue Haare, Falten oder Cellulite jahrzehntelang mit allerlei Mittelchen, Eingriffen oder mittels Photoshop kaschiert werden können. Schwieriger zu bekämpfen ist die nachlassende Energie: Mit dreißig konnte ich nicht verstehen, warum meine Mutter spätestens um zehn am liebsten einfach nur ins Bett sinken wollte. Vor Mitternacht schlafen zu gehen, war für mich unvorstellbar, wenig Schlaf gehörte zu meinem Leben. Inzwischen bin ich selber abends oft so müde, dass ich nur noch ins Bett möchte, obwohl mir das als Nachtmensch sehr zuwider ist. Ich weiß jetzt auch, warum das «Thé dansant» erfunden wurde. Mein einziger Hoffnungsschimmer: Meine inzwischen über achtzigjährige Mutter ist mittlerweile nachts um zwei manchmal frischer als ich sie in meiner Kindheit je erlebt habe.
Me too. Bis etwa dreißig war ich ein Anbeter der Nacht; heute gehe ich eher um zehn ins Bett – senile Bettflucht in umgekehrter Richtung. Das könnte sich aber auch wieder ändern, denke ich. Wenn es zum Beispiel egal wäre, wann ich am Morgen aufstehe.
Ein untrügliches Alterszeichen ist auch, wenn das Smalltalk-Thema Nummer Eins nicht mehr das Wetter, sondern der Schlaf ist. Die Schlafqualität wird zu einer Art Obsession. Morgens berichten Paare einander, wer in der Nacht wie oft aufgewacht und wie lange wachgelegen ist. Unter Gleichaltrigen tauscht man sich darüber aus, dass man am Wochenende nicht mehr ausschlafen kann, dass einem früher die Kinder den Schlaf raubten und heute die senile Bettflucht.
Da kann ich leider nicht mitreden. Beziehungsweise nur als Smalltalk- und Spielverderber. Schlaf ist nämlich mein einziges Hobby, dem ich leidenschaftlich gerne und bis jetzt auch sehr erfolgreich nachgehe. Da ich in der Regel früh aufstehen muss, bedeutet das, dass ich entsprechend früh ins Bett muss, wenn ich genug schlafen will. Das Tollste aber ist, dass ich dann auch schlafen kann.