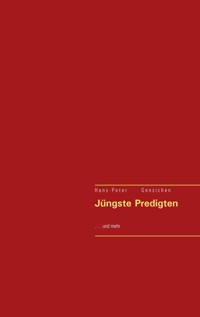
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Gensichen hat zwischen 1972 und 2014 regelmäßig Predigten gehalten. In evangelischen, seltener in katholischen Kirchen. Der Titel "Jüngste Predigten" besagt, daß G. seit 2015 nicht mehr gepredigt hat - ganz einfach, weil ein teils abhanden gekommenes Gleichgewichts-Gefühl das souveräne Am-Altar-Stehen unmöglich macht, ohne das es in einem Gottesdienst nicht geht. Nachdem zehn Predigten abgedruckt sind, finden sich im dritten Drittel dieses Buches andere Texte, durch welche die zehn abgedruckten Predigten erläutert werden. Freilich können diese anderen Texte auch für sich selbst gelesen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Zehn Predigten
Taube mit Ölblatt
Elia und die arme Witwe
Das Magnifikat durch die Zeiten
Nähe. Nicht Größe
Dreieinigkeit
Bereit sein
Nur dies eine Raumschiff
Das Glänzen der Welt
Milch und Honig
Ein Weg ins Weniger
Zwei Bilder „Sintflut“
95 Thesen 2017
Hier in Kurzform, was
Gensichen glaubt, hofft und lebt
Gedichte / Lieder
Christen und Kirchen in der DDR Eine sehr knappe DDR - Kirchengeschichte
Luther in der Lutherstadt Ein Schloßkirchenprediger erinnert sich
Vorwort
Die zehn Predigten in diesem Buch füllen zwei Drittel der Seiten. Daneben findet man hier auf zehn Seiten meine 95 Thesen für das Reformationsjubiläum 2017. Und auch (stark gekürzt) eine Vorlesung „Christen und Kirchen in der DDR” Dann einige mehr oder weniger lyrische Texte, die ich ad hoc für „meine“ Gottesdienste produziert habe. Und schließlich meine Beobachtungen als Prediger an der berühmten Wittenberger Schloßkirche. Diese Nicht-Predigt-Texte machen die zehn Predigten verständlicher. Sollen das jedenfalls tun.
Beim Predigen soll / muß ich biblische Texte interpretieren. Eigentlich eine unmögliche Möglichkeit. Deswegen (und auch: trotzdem) habe ich immer gerne gepredigt. Ab 1971 und bis 2014. In der Lutherstadt Wittenberg und – von 2009 bis 2014 – in Württemberg.
In unsicheren Zeiten muss man aufmerksam machen, umdenken, ein Umdenken in Gang setzen, handeln, Handeln anregen. Und Gründe für den Bau von Archen nennen. Von Zellen bzw. Elementen des Überlebens. Der Anspruch von Predigern und deren Predigten ist es ja, das Dasein der Zuhörenden zu verbessern, ihr Denken zu erhellen, neu zu orientieren. Vor der Katastrophe (und auch noch mitten in ihr) ein Leben nach der Katastrophe zu ermöglichen.
Die Bibel-Texte, über die in christlichen Kirchen gepredigt wird, sind 2000 bis 3000 Jahre alt. Manche (aus dem Alten Testament, also der hebräischen Bibel) sind in der Eisenzeit entstanden: mehr als 3000 Jahre vor jetzt.
Predigen, diese unmögliche Möglichkeit, ist anstrengend. Man braucht gutes Handwerkszeug, um Gottes Wort auszulegen, Ohne theologische Bildung und Weiterbildung und ohne soziale Kompetenz ist Predigen nicht möglich. Und muß immer mit Sympathie für die bzw. mit den Predigt- Hörern vorgetragen werden. Auf das alles muss ein Prediger sich einlassen! Nichtpredigen ist jedenfalls viel einfacher. Hingegen Dochpredigen ist lebendiger. In den biblischen Predigttexten findet man wertvolle Perlen. Wenn es einem gelingt, heutigen Menschen helfende Ausblicke in ihr heutiges Leben, in ein mögliches Überleben zu verschaffen. So dass ihnen womöglich ihr Leben, die Zukunft, die Vergangenheit verständlicher werden. Es ist wirklich jedes Mal aufregend (um nicht „lebensgefährlich“ zu schreiben), wenn ich die tiefen Gräben zwischen dem biblischen Text und mir überwinde, wenn ich Brücken entdecke zwischen den Zeiten. Ein Seil, an dem ich mich von hier nach dort und zurück schwingen kann. Hin und zurück zwischen den Zeiten, den Situationen und auch zwischen den Orten.
Predigten hören – Predigten ergebnisreich hören – ist ebenfalls anstrengend und aufregend. Man muß ja ca. 20 Minuten lang zuhören – Sätze, Gedanken hören, in denen es nicht um Leistung, nicht um Werbung, nicht um Zwänge, nicht um Banalitäten geht, um nichts, was sie, was er zur Prüfung wissen müsste oder was ihn bzw. sie mainstreamiger erscheinen lassen könnte. Nicht um etwas, das den Job in der Firma oder die Stellung im Freundeskreis sichern könnte. Sondern es geht in der Kirche um etwas, das nach den Regeln der Leistungsgesellschaft wertlos ist. Und angeblich auch zwecklos. Und wenn, angesichts dessen, manchmal doch ein Satzteil hängen bleibt, mit dem eine(r) das Leben neu justieren – oder eine Einzelentscheidung anders, besser fällen kann – ein Satzteil, auf den der Prediger vielleicht gar nicht den Akzent gesetzt hatte. Sondern wo Du, nicht die Prüfungskommission, nicht der Kirchengemeinderat, nicht die Freunde, nicht die Arbeitsagentur, sondern Du entscheidest, was an dem Gehörten und Behaltenen wichtig ist. Beim Predigthören kann man, muß man extrem selbständig sein.
Ich war Prediger an der Schlosskirche in der Lutherstadt Wittenberg – dort, wo Martin Luther und Philipp Melanchthon begraben sind.
Ab 2007 (schon im Ruhestand) habe ich öfter an der Stephanuskirche in Tübingen Gottesdienste gehalten.
Im Evangelischen Gesangbuch habe ich mitunter keinen Choral gefunden, dessen Strophen zu meiner Predigt gepasst hätten. Dann habe ich manchmal zwei, drei Strophen selbst gedichtet. Oft erst am späten Samstagabend: kurz vor „meinem“ Gottesdienst. Am liebsten war es mir, einen bereits existierenden Lied-Text nur teilweise umzudichten, den anderen Teil aber unverändert zu lassen. Das drückt ganz gut aus, wie wir in der Kirche zwischen Gegenwart und Vergangenheit stehen, wie wir das teils antike Erbe mitnehmen und auch umgestalten müssen. Und auch können. Einige Liedertexte sind hier mit abgedruckt. Mehrere von ihnen haben einen schöpfungstheologischen Akzent und weisen auf das Thema Ökologie hin; mein Spezialgebiet in den letzten 50 Jahren.
Manchmal, auch unabhängig von Gottesdiensten, habe ich Gedichte zu schreiben versucht. Gedichte sollte man eigentlich nicht veröffentlichen. Die sind nur für einen selbst. Aber einige wenige sind hier dennoch abgedruckt.
Dieses Buch heißt JÜNGSTE PREDIGTEN. Die meisten von ihnen habe ich in Tübingen, je eine auch in Wittenberg, in Uzwil (Schweiz) und im im benachbarten Gönningen gehalten. (Viele ältere Manuskripte hatte ich beim Umzug aus Wittenberg vernichtet oder verbummelt.)
Ich habe oft angegeben, wann und wo die Predigt gehalten wurde. - Die Reihenfolge der Predigten sagt übrigens nichts über deren zeitliches Nacheinander.
Meine 95 Thesen 2017 (die auch extra als Heft in Deutsch und Englisch zu haben sind), dann die Kurzform eines Vortrages an der Tübinger Uni und schließlich einige Erinnerungen an Wittenbergs kirchliches Leben aus DDR-Zeiten. Die zeigen den Leserinnen und Lesern, wie Gensichen theologisch „tickt“.
Taube mit Ölblatt
Predigt über 1. Mose 8, 1-12, 1984, Schloßkirche Lutherstadt Wittenberg
Gott gedachte an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach hundertfünfzig Tagen. Am siebzehnten Tag des siebenten Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Es nahmen aber die Wasser immer ehr ab bis auf den zehnten Monat. Am ersten Tag des zehnten Monats sahen die Spitzen der Berge hervor.
Nach vierzig Tagen in der Arche tat Noah das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen; der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm n die Arche; denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Da harrte er noch weitere sieben Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug’s in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Aber er harrte noch eitere sieben Tage und ließ eine Taube ausfliegen; die kam nicht wieder zu ihm.
Liebe Schwestern und Brüder hier in der Wittenberger Schloßkirche!
Ganz hinten rechts in unserer Schloßkirche: das Standbild von Caspar Cruciger. Wir haben hier neun solcher „Säulenheiliger“: Luther, Melanchthon, Justus Jonas, Johannes Bugenhagen, Georg Spalatin, Urbanus Rhegius, Nikolaus von Amsdorff. Und ganz hinten dann eben noch Caspar Cruciger und den Schwaben Johannes Brenz.
Und Caspar Cruciger hat unsern heutigen Predigttext in seinem Wappen. Cruciger war der Naturwissenschaftler unter den Reformatoren; und darum dieses Wappen: Eine Taube mit einem Zweig im Schnabel. Sie fliegt zu Noahs Arche und zeigt an, dass wieder Land in Sicht ist, dass die Bäume ausschlagen und dass neues Leben möglich ist. Und es ist nicht nur möglich, sondern beginnt auch real: Der grüne Zweig wächst schon. Genau das ist die erfreuliche Nachricht dieser Erzählung: Wenn auch alles zusammenbricht – es ist immer schon und auch Hoffnung da. Und die stirbt nicht nur zuletzt, sondern gar nicht. Es gibt nach der Flut ein Leben trotz der Flut. Und wer die Sintfluterzählung kennt, kann das sogar mitten in der Flut glauben.
Besonders aufregend finde ich daran, dass die Situation sich schon entspannt hat, dass die Wassermassen schon zurückgegangen sind – wenn auch erst ein wenig – und dass die Spitzen der Berge schon wieder aus ihnen herausschauen. Dass aber Noah, der Überlebende, das noch gar nicht wahrnimmt. Er, für den das Überleben doch gerade organisiert worden ist, er ist in seinem Kasten noch ganz unsicher, was draußen geschieht. Ob draußen überhaupt irgendetwas geschieht. Ist die Arche wohl nicht doch sein Sarg? Er hat keinen Überblick. Unsicherheit herrscht in der Arche, obwohl diese doch schon über sicherem Grund schwebt.
Diese Spannung! Objektiv ist es schon Licht, aber wir sehen subjektiv noch ganz schwarz. Gott hat schon Ja gesagt, aber wir können es nicht zur Kenntnis nehmen. Wir nehmen es nicht wahr. Wir nehmen die Wahrheit nicht wahr, weil wir nur die wahrnehmbaren Fakten wahrnehmen.
Kurze Erinnerung: Vor der Sintflut, als die Menschheit schon ganz und gar „verderbt“, also verdorben war, hat Gott die Sintflut schon beschlossen, aber keiner nahm das wahr. Man konnte es offenbar nicht wahrnehmen. Nicht einmal Noah übrigens. Der tat dann zwar etwas für das Überleben in der Flut, aber er wusste nicht, wozu sein Tun gut sein würde. Er kannte die Richtung, wusste aber nichts vom Ziel.
Frappierend, wie Menschen ihre wahre Situation – im Guten wie im Schlechten – einfach nicht wahrhaben wollen bzw. nicht wahrnehmen können. Und wenn ihr zielloses Strampeln zum Ziel führt, wissen sie es nicht einmal.
Die schönste Einzelheit in diesem Bibeltext ist die, wo Noah die Hand aus dem Fenster tut, um die Taube wieder hereinzuholen. Das Tier hilft dem Menschen, der Mensch hilft dem Tier. Sie sind Partner. Besser kann man gar nicht ausdrücken, worum es heute angesichts von Umweltbedrohung und Naturzersetzung gehen muss: Natur und Mensch können nicht ohne einander weiterexistieren, und sie müssen geradezu als Partner miteinander leben – nicht als Gegner. Jedenfalls wenn sie, jeder von ihnen und beide zusammen, überleben will, überleben wollen.
Viele Künstler hat gerade dieses Bild von der zurückkehrenden und wieder hereingenommenen Taube fasziniert. Noah an dem Archenfenster und die Taube, Noah mit langem Bart und als sagenhaftsechshundertjähriger Mann. Dabei geht es gar nicht um sechshundert Jahre, sondern eigentlich um . . . sechshunderttausend: Mein heutiges Jetzt – und jedes Jetzt jedes Menschen zu jeder Zeit ist gemeint. Es geht um jedes Überleben trotz eines Infernos, um Gerettetwerden in jeder Flut, stets und immer wieder.
Und ich muss Pablo Picassos Friedenstaube erwähnen. Aus dieser biblischen Erzählung hat er sie, die Taube mit dem Ölblatt im Schnabel: Zeichen neu geschenkten Grundes, neuer Lebenshoffnung: Land ist in Sicht.
Unsere kommunistischen Lehrer erzählten uns immer, diese Taube drücke Friedenssehnsucht aus, eine Friedenssehnsucht, die durch den Friedenskampf der Menschen erfüllt werden könne. Aber das stimmt nicht. Es stimmte nie. Im Christenlehre- Unterricht ist mir klar geworden: Die Taube zeigt vielmehr, dass Gott den Frieden schon geschenkt hat; dieses Geschenk ist zwar noch unsichtbar, aber real vorhanden. Das habe ich dann wieder meiner Lehrerin in der sozialistischen Schule gesagt, aber die wollte das nicht hören. Ich glaube, sie durfte das einfach nicht hören wollen. Ich gab ihr Recht, der armen Frau. Aber Recht hatte ich.
Wenn ich nun also von der Taube rede, die das gewährte, geschenkte Überleben mit Gewissheit ansagt – das Überleben trotz des realen Chaos –, dann weiß ich das mit ganz großer und erneuerter Überzeugung, weil ich an Jesus Christus glaube. Er bringt ja die Botschaft von da, wo die neue Schöpfung anhebt, anfängt. Und darüber will ich jetzt sprechen. Über Christus, die Taube. Da spreche ich freilich schon nicht mehr über die Sintflutgeschichte des Alten Testaments, sondern über das Licht, welches vom Neuen Testament her auf sie fällt. Als erstes möchte ich euch an ein Rezitativ aus Bachs Matthäus-Passion von Bach erinnern. Der Evangelist hat da gerade berichtet, dass Jesus gestorben ist und dass Joseph von Arimathia kam, um den Leichnam Jesu abzunehmen. An dieser Stelle hat Bach ein Bass-Rezitativ eingeflochten:
Am Abend, da es kühle war,
ward Adams Fallen offenbar.
Am Abend drückte ihn der Heiland nieder,
am Abend kam die Taube wieder,
und trug ein Ölblatt in dem Munde.
0 schöne Zeit! 0 Abendstunde!
Der Friedensschluss ist nun mit Gott gemacht,
denn Jesus hat sein Kreuz vollbracht.
Die Bäume schlagen aus; die Blätter im Schnabel der Taube zeugen davon. Und das ist eben nicht Wunschbild, sondern Realität. Für uns noch unsichtbar, aber schon real existierend. Wenn wir in dem Boot sitzen, in dem Christus sitzt, dürfen wir auf das Ende der hohen Wellen und auf das Ende der immer noch Angst erregenden Wassermassen hoffen.
„Boot, in dem wir mit Christus sitzen“ – da habe ich schon das Markusevangelium zitiert. Im 4. Kapitel heißt es dort:
Am Abend desselben Tages sagte er zu den Jüngern: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk, das Jesus zugehört hatte, gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Wirbelwind, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll lief. Und Jesus lag hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir zugrunde gehen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme! Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sagte zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr denn immer noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sagten zueinander: Wer ist der? Selbst Wind und Meer sind ihm gehorsam!





























