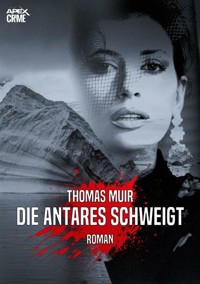6,99 €
Mehr erfahren.
Die Kabinen der Kumassi sind auf der Reise von Colombo nach England überbelegt. Das bringt Schwierigkeiten für die Besatzung mit sich...
Besonders heikel wird es für Kapitän McIvor, als man ihm den Tod eines Passagiers - des Reederei-Direktors Bickerton - meldet. Lieutenant Crammond stell fest: Bickerton wurde ermordet!
Schließlich geschieht ein zweiter Mord, und Lieutenant Crammond weiß, dass er auf der richtigen Spur ist...
Der Roman Kabine B 55 des schottischen Schriftstellers und Journalisten Thomas Muir (* 02. Januar 1918; † 8. Oktober 1982) erschien erstmals im Jahr 1948; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1962.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
THOMAS MUIR
Kabine B 55
Roman
Apex Crime, Band 219
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
KABINE B 55
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Das Buch
Die Kabinen der Kumassi sind auf der Reise von Colombo nach England überbelegt. Das bringt Schwierigkeiten für die Besatzung mit sich...
Besonders heikel wird es für Kapitän McIvor, als man ihm den Tod eines Passagiers - des Reederei-Direktors Bickerton - meldet. Lieutenant Crammond stell fest: Bickerton wurde ermordet!
Schließlich geschieht ein zweiter Mord, und Lieutenant Crammond weiß, dass er auf der richtigen Spur ist...
Der Roman Kabine B 55 des schottischen Schriftstellers und Journalisten Thomas Muir (* 02. Januar 1918; † 8. Oktober 1982) erschien erstmals im Jahr 1948; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1962.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
KABINE B 55
Erstes Kapitel
Archibald Bickerton war ein schwerer, stattlicher Mann, dem der graue Anzug aus Tussahseide feucht am Körper klebte. Als er das Fallreep zu dem Truppentransporter Kumassi hinaufstieg, hatte er einen bösen Ausdruck in den Augen. Sein Gesicht war von der Hitze aufgedunsen. Auf Deck angelangt, sah er sich einem Burschen mit unangenehm scharfem Blick gegenüber, der seine Reisepapiere zu sehen verlangte. Dann erst durfte er sich mit der übrigen Menge aus der sengenden Glut, die über dem Hafen von Colombo brütete, auf das B-Deck drängen, wo der Schatten eine größere Kühle wenigstens vortäuschte.
Bickerton kochte vor Zorn. Erstens musste er seinen Handkoffer selbst tragen, denn seinen Träger hatte ein junger Schnösel in Lieutnantsuniform nicht an Bord gelassen. Zweitens durfte er nicht mehr selbst befehlen, sondern musste sich von all diesen Passagieren puffen und stoßen lassen, die nicht die geringste Rücksicht auf ihn nahmen und nicht ein bisschen Respekt vor ihm zeigten.
Er keuchte. Solche Anstrengungen war er nicht gewohnt. Mühsam bahnte er sich einen Weg zum Büro des Zahlmeisters und benutzte dabei seinen Koffer unbarmherzig als Sturmbock.
»Wo ist meine Kabine?«, fuhr er einen Steward an, aber er begegnete nur einem ruhigen, nüchternen Blick. »Bickerton ist mein Name – Archibald Bickerton.«
»Darf ich um Ihre Karte bitten? – Danke sehr... Kabine B 55. Dort entlang. – Bitte nur Handgepäck in die Kabine mitnehmen.« Der Steward ratterte pflichtgemäß diese Anweisung herunter und wandte sich dem nächsten Fahrgast aus der Menge zu, die sich um ihn drängte. Bickerton empfand das Verhalten des Stewards als ziemlich respektlos. Sein Gesicht verfärbte sich noch mehr. Er sah den Mann, der ihn jedoch nicht beachtete, finster an, nahm seinen Koffer auf und bahnte sich weiter seinen Weg in der angegebenen Richtung. Mit seiner stattlichen Leibesfülle fing er manchen Stoß auf, und mit jedem Stoß nahmen seine schlechte Laune und das Bewusstsein zu, keineswegs so behandelt zu werden, wie es ihm gebührte. Das war nun der Anfang seines Urlaubs!
Er stand vor der Tür zur Kabine B 55, der Oase, in der er endlich für sich sein wollte. Er stieß sie auf. Aber noch auf der Schwelle erstarrte er. Seine etwas hervortretenden Augen quollen bei dem Anblick, der sich ihm bot, noch stärker heraus. Es war unfassbar, aber da drinnen hockte Bereits ein Kerl in kurzer weißer Hose und verstaute gerade einen Handkoffer unter der Koje bei dem großen Bullauge.
»Sie befinden sich in der falschen Kabine, Sir«, fuhr Bickerton den anderen gereizt an. »Der Steward hat mir diese als die meine angewiesen – B 55. Sie haben hier nichts zu suchen!«
Die Gestalt richtete sich auf und wandte sich ihm zu – ein hochgewachsener, junger Marinelieutenant mit einem klugen, spöttischen Gesicht und einem etwas rätselhaften Lächeln.
»Stimmt nicht ganz«, erwiderte er munter und betrachtete interessiert den Ankömmling. »Wir sind sogar sechs, die diese Kabine miteinander teilen müssen.«
»Sechs!« Archibald Bickerton rang nach Atem und nahm den Tropenhelm ab. Die Farbe seines Gesichts war nun fast die einer überreifen Tomate. Ganz benommen blickte er sich in der Kabine um, und da sah er die fünf zusätzlich hineingestellten Betten, von denen zwei zweistöckig waren.
»Es ist gar nicht so schlimm«, fügte der Marineoffizier aufmunternd hinzu. »In manchen Kabinen liegen zehn beieinander, und wir haben sogar noch das Glück, ein Bad für uns zu haben.«
»Hol’ der Teufel das Bad!«, entfuhr es Bickerton. »Es ist doch geradezu eine Frechheit, mir zu sagen, dass ich diesen Hundezwinger mit fünf anderen teilen soll! Ich habe für die Überfahrt Erste Klasse bezahlt, und, bei Gott, ich werde auch Erste Klasse fahren, oder ich will den Grund für diese Zumutung wissen!«
»Der Grund ist sehr einfach. Wir befinden uns auf einem Transporter und man hat an die viertausend Mann hier an Bord gestopft. Immerhin nimmt man ja gern ein paar Unbequemlichkeiten auf sich, wenn man nur heimkommt.«
Bickerton wischte sich mit dem Taschentuch den Schweiß von Gesicht und Nacken. »Sechs Mann in einer Kabine! Eine Unverschämtheit ist das, nichts weiter! Jetzt schon ist es höllisch heiß, was werden wir da im Roten Meer erleben? Das lasse ich mir nicht bieten! Hol’s der Teufel, ich werde mich beschweren!«
Er stolperte über seinen Koffer, versetzte ihm einen heftigen Fußtritt und stürmte wieder in den Gang hinaus. Dort stieß er sofort mit einem anderen Marineoffizier zusammen, der ein auffallend hübsches junges Mädchen begleitete.
»Verdammt nochmal, dieses Schiff ist das reine Irrenbaus!«, knurrte er und drängte sich ohne jede Entschuldigung an ihnen vorbei. »Leute, wohin man tritt... Sechs in einer Kabine... Tolle Zustände!«
»Was ist denn das für ein Urvieh? Reizendes Benehmen!«, brummte, der Offizier. Einen Augenblick verdüsterte sich sein sonst offenes, freundliches Gesicht. Dann steckte er den Kopf in die Kabine und fragte: »Sag mal, alter Junge, kommt dieser scheußliche Pukka-Sahib mit zu uns?«
»Ich fürchte, ja«, erwiderte der in der Kabine grinsend und trat zur Tür. »Er selbst ist von dem Gedanken nicht gerade begeistert. Typischer Fall von zu hohem Blutdruck. Aber sag mal, du bist ja ein ganz toller Bursche! Was hast du denn da schon im Schlepp?«
»Keine besonders galante Ausdrucksweise, mein Sohn! Nichts weiter als mein dienstlicher Auftrag für diese Reise«, erwiderte Lieutenant James Mills mit einer Würde, die nur schlecht zu seinem jungenhaften gebräunten Gesicht passte. »Das tollste ist ja, dass sie schon die ganze Zeit in Colombo war und ich sie niemals zuvor getroffen habe. Daran sieht man eigentlich, wie groß die Welt wirklich ist. Soll ich dich vorstellen?« Er wandte sich zu dem Mädchen um, das in der Nähe stehengeblieben war und nun belustigt lächelte. »Rona, darf ich Ihnen einen Bordkameraden vorstellen? Lieutenant Crammond – ein prima Kerl, wenn man es ihm auch nicht ansieht. Eine Kanone auf wissenschaftlichem Gebiet. Nennt sich selbst einen Meeresbiologen und weiß mehr von all diesem kriechenden Getier, das da im Meer herumkrabbelt, als ich von der hohen Kunst des Würfelns verstehe und –«
»Weitere biographische Einzelheiten kannst du dir sparen, du Kindskopf!« Crammond wandte sich entschuldigend an das Mädchen. »Ich fürchte, es ist bei ihm angeboren. So ist er immer.«
»Miss Stuart«, setzte Mills die Vorstellung fort, »ist die Tochter von Kapitän Stuart, und ich soll mich ihrer annehmen.«
»Es freut mich, Sie kennenzulernen«, sagte Rona Stuart zu Crammond. Sie war schlank und anmutig, hatte ein von Natur golden schimmerndes Haar und blaue Augen. »Jim hat, seitdem Vater ihn mir vor einer halben Stunde vorgestellt hat, wie ein amerikanischer Rundfunkkommentator auf mich eingeredet; ich bin schon ganz benommen.«
»Warten Sie nur, bis er richtig in Fahrt kommt. Ihr Vater hatte offenbar keine Ahnung, als er Sie mit ihm zusammenbrachte, worauf Sie sich da einließen. Und was nun die Fürsorge anbelangt...«
»Ach, ich glaube, ich weiß schon, woran ich bei ihm bin!« Rona lachte. »Ich bin es gewohnt, allein zu reisen, und ich weiß, wie man Leute seines Schlages behandelt. Es plagt ihn übrigens ungemein, nicht zu wissen, wo ich mich in Colombo verborgen hielt.«
Das Gedränge im Kabinengang wurde immer schlimmer, da ständig neue Passagiere eintrafen und sich aus den Booten das Fallreep heraufdrängten. Militär, Zivilisten, Kinder – alles schob und quetschte sich vorbei auf der Suche nach den Kabinen. Waren diese gefunden, so kehrten die Leute wieder um, weil sie sich dann um ihr großes Gepäck kümmern mussten oder nach Freunden Ausschau hielten.
Die Kumassi war ein Schiff von 12.000 Tonnen, das als kombiniertes Passagier- und Frachtschiff gebaut worden war. Das Ministerium für das Transportwesen hatte sie auf einfache Weise dadurch vergrößert, dass es zusätzliche Kojen auf jeden freien Raum einbauen ließ. Die Decks, in denen die Truppen lagen, waren wie riesige Ameisenhaufen, in denen die Männer schwitzend und fluchend in langen Reihen dicht nebeneinander lagen. Im Großen und Ganzen aber fanden sich alle voller Humor mit dem Unvermeidlichen ab. Sie lagen dort, wo in besseren Zeiten wieder die riesigen Laderäume sein würden.
»Ich glaube, ich muss mich jetzt wieder mal ein wenig um meine Leute kümmern«, sagte Crammond nach einer Zigarettenlänge und nach einigen Worten über die Zeit des Auslaufens und das wahrscheinliche Ankunftsdatum in England. »Als ich vor einer halben Stunde unten war, hatten sie sich die Hälfte des Platzes einer Luftwaffeneinheit angeeignet, und die Lage war ein wenig gespannt.«
»Ich möchte Vater ein paar Worte telegraphieren, um ihn aufzumuntern«, sagte Rona. »Er ist fürchterlich vergrämt, dass er nicht mit mir zusammen heimfahren kann.«
»Gut. Kommen Sie mit, ich suche Ihnen den Funkmaat«, erbot sich Mills sofort.
Crammond blickte beiden einen Augenblick nach, als sie davoneilten, und kehrte sich dann mit einem leichten Seufzer ab, um sich seinen eigenen Aufgaben zu widmen. Als dem dienstältesten Marineoffizier unter den Fahrgästen hatte man ihm das Kommando über die Urlauber und Abkommandierten der Marine, die in die Heimat fuhren, übertragen, und es gehörte zu seinen Pflichten, bei ihnen nach dem Rechten zu sehen.
Als er über das Promenadendeck in Richtung auf das Luk zum Zwischendeck ging, weckte plötzlich eine laute Stimme seine Aufmerksamkeit. Er blieb wie zufällig stehen, als er sah, dass Archibald Bickerton den Einschiffungsoffizier, einen abgehetzt aussehenden Hauptmann des Heeres, gestellt hatte und ihm sehr gereizt seinen Fall vortrug. Crammond trat ein wenig näher.
»Ich fahre schon dreißig Jahre auf dieser Strecke und habe in meinem ganzen Leben noch keine so unglaublichen Zustände kennengelernt! Ich verlange eine Kabine Erster Klasse.«
»Sie haben eine«, entgegnete der Offizier. »Es tut mir leid, dass Sie die Kabine mit anderen teilen müssen, aber das liegt an den Verhältnissen. Vergessen Sie bitte nicht: Dies ist ein Truppentransporter. Hier geht es allen gleich.«
»Tut Ihnen leid!«, schnaubte Bickerton. »Ich nenne so etwas einen verheerenden Skandal, und ich gehe der Sache nach. Ich werde meinen Abgeordneten veranlassen, diese Angelegenheit dem Unterhaus vorzutragen...«
»Wenn Ihnen die Kabine nicht gefällt, können Sie sie aufgeben und wieder an Land gehen. Es steht eine Unzahl von Menschen auf der Warteliste, die froh wären, eine solche Gelegenheit wahrzunehmen.«
»Unerhört!« Bickertons Gesicht war nun fast bläulich angelaufen. Er schäumte vor Wut und vermochte kaum, sich zu bezähmen. »Erst die schamlose Frechheit, für eine solche Unterbringung den Fahrpreis Erster Klasse zu verlangen, und dann nichts weiter als Unverschämtheiten, Gleichgültigkeit und völliger Mangel an Organisation! Kümmert sich überhaupt jemand an Bord um das große Gepäck, oder überlässt man das den eingeborenen Gepäckträgern, damit sie es kurz und klein schlagen?«
»Großes Gepäck bei Ladeluke zwei«, erwiderte der Offizier barsch. »Das ist Sache des Gepäckoffiziers.«
Wutschnaubend blickte Bickerton ihn an. Seine ganze Empörung lag in diesem Blick. Und dann murmelte er noch etwas zornig vor sich hin und stapfte davon.
Crammond tauschte ein verständnisvolles Grinsen mit dem Einschiffungsoffizier aus. Dieser machte eine müde Handbewegung, um seinen kurz bevorstehenden Nervenzusammenbruch anzudeuten, und Crammond setzte seinen Weg zum Truppendeck fort. Dann aber sah er einen Matrosen, der, ein Essgeschirr in der Hand, seinen Weg kreuzte, und das erinnerte ihn daran, dass es vier Uhr war, die geheiligte Stunde des Nachmittagstees. Er stieg die vielen Niedergänge hinab in den Laderaum, wo sich etwa zweihundert Leute von der Marine auf dem ihnen zugewiesenen Raum heimisch machten.
»Alles in Ordnung, Herr Lieutenant«, meldete Obermaat Hosick. »Haben uns schon ganz gemütlich eingerichtet. Die Sache mit dem Platz der Luftwaffenleute haben wir geregelt; ich und der Feldwebel hier haben uns gerade darüber geeinigt, das Gepäck der Soldaten von hier zu entfernen, weil dieser Platz noch uns gehört. Frage mich bloß immer wieder, wo diese Burschen ihre Ausbildung erhalten haben, Herr Lieutenant.«
»Sie können doch von einem Landsoldaten nicht erwarten, dass er sich auf einem Schiff zurechtfindet, Hosick«, entgegnete Crammond. »Und da Sie alle für die nächsten paar Wochen miteinander auskommen müssen, würde ich gar nicht erst den Versuch machen, die Leute zu ändern.«
»Geht auch schon alles in Ordnung, Herr Lieutenant. Wir kommen gut miteinander aus. Der Feldwebel ist ja ein ganz vernünftiger Bursche. Wir bereden die Sache und regeln sie friedlich.«
»Das ist auch das Beste.« Crammond sah sich um. »Und wie ist es mit Platz für die Hängematten? Reiht der?«
»Jawohl, Herr Lieutenant. Ich habe alle Hängematten probeweise aufhängen lassen, um es festzustellen. Jeder Mann hat seinen Schlafplatz. Sie sind alle – was ist denn das?« Er unterbrach sich, weil er mit dem Fuß gegen eine zusammengerollte Hängematte stieß, die am Boden neben dem kleinen Koffer eines Matrosen lag. Sein Gesicht verdunkelte sich, als er die Rolle umdrehte und den Namen las.
»Matrosenobergefreiter Clemens!«, brüllte er mit einer Stimme, die im ganzen Deck widerhallte. »Matrosenobergefreiter Clemens! – Ich werde diesen Mann deswegen zum Rapport melden, Herr Lieutenant«, fügte er hinzu. »Es geht nicht, dass er sein Zeug hier herumliegen lässt. – Matrosenobergefreiter Clemens!«
Der Mann befand sich offensichtlich nicht in Hörweite. Ein anderer Obergefreiter rückte schließlich mit der Mitteilung heraus, Clemens sei in der letzten halben Stunde überhaupt nicht dagewesen; er habe auch seinen Tee nicht gefasst.
»Suchen Sie ihn«, fuhr Hosick ihn an, »und sagen Sie ihm, er soll hier im Laufschritt erscheinen. Der wird mich noch kennenlernen, wenn ich ihn zwischen die Finger kriege!«
Zweites Kapitel
Crammond blieb noch eine Weile unter Deck und besprach mit Hosick die Einteilung der Backschaften. Er wollte gerade gehen, als der Obergefreite von seiner Suche zurückkehrte.
»Wo ist er, Gossage?«, fragte Hosick.
»Habe ihn nirgends gesehen«, meldete der Matrosenobergefreite Gossage. Auf seinem sommersprossigen Gesicht stand schimmernd der Schweiß. »Sieht so aus, als ob er im Augenblick gar nicht an Bord wäre.«
»Verstehe überhaupt nicht, was mit diesem Clemens los ist«, warf ein großer, hagerer Maat mit Namen Halfyard ein.
»Aber an Bord ist er doch gekommen?«, fragte Crammond.
»Ja, er kam mit uns allen zusammen an Bord«, sagte Halfyard. »Er hat ja noch beim Gepäckkommando im Laderaum zwei gearbeitet. Habe ihn selbst dahin abkommandiert.«
»Mir scheint, er hat sich dünngemacht«, warf Gossage ein.
»Was wollen Sie damit sagen?«, fragte Crammond scharf, während Obermaat Hosick offensichtlich entsetzt war, dass der Obergefreite überhaupt eine Meinung äußerte.
»Ich meine... Ich wollte... Ich weiß nicht recht...«, stammelte Gossage. Plötzlich wünschte er, er hätte überhaupt geschwiegen. »Ist wohl ein Irrtum, Herr Lieutenant.«
»Na los, heraus damit!«
Gossage fühlte sich gar nicht wohl in seiner Haut. Er schluckte, aber dann empfand er Crammonds Blick doch als ganz ermutigend und rückte mit der Sprache heraus.
»Vielleicht hätte ich gar nichts sagen sollen, Herr Lieutenant, aber ich habe zufällig erfahren, dass Fred Clemens keine Lust hatte, nach Hause zu fahren.«
»Warum nicht?«
»Wegen eines Mädchens, das er hier hat.«
»So, so. Was für ein Mädchen?«
»Eine Puppe! Ich habe sie einmal gesehen!« Gossages Augen leuchteten auf. »Ein Mischlingsmädchen, aber man sieht es ihr kaum an, und Fred hatte völlig den Kopf verloren. Hat alles versucht, seine Abkommandierung rückgängig zu machen und bei ihr zu bleiben.«
»Sind Sie mit Clemens befreundet?«
»Jawohl, Herr Lieutenant – bis er sich eben dieses Mädchen geschnappt hat. Dann hatte er für nichts mehr–Zeit. Tatsächlich habe ich ihn, bevor wir heute an Bord kamen, fast eine Woche lang nicht gesehen.«
»So, so.« Crammonds kluge graue Augen waren nun nachdenklich. »Hat er irgendwann geäußert, er würde versuchen, die Abfahrt zu verpassen?«
»Nein, Herr Lieutenant«, sagte Gossage. Ihm war in Hosicks Anwesenheit nicht ganz wohl zumute. »Aber es war Clemens anzumerken, dass er alles tun würde, um dableiben zu können. Er war völlig durchgedreht, als sein Gesuch abgelehnt wurde.«
»Und ist das der einzige Grund, den Sie sich dafür denken können, dass er sich wieder an Land geschlichen hat?«
Gossage schluckte noch einmal und streifte Hosick mit einem unsicheren Blick.
»Jawohl, Herr Lieutenant – ich wollte sagen, als ich hörte, er sei nicht zu finden, kam mir nur so der Gedanke, er könnte sich dünnegemacht haben. Und da dachte ich, das müsste ich wohl melden.«
»Ja, ganz recht. Sehr vernünftig«, erwiderte Crammond. »Aber wir müssen uns erst noch mehr an Bord umsehen, bevor wir zu irgendwelchen endgültigen Schlüssen kommen.«
Obermaat Hosick fasste dies als die schon längst überfällige Verabschiedung des Matrosenobergefreiten auf und sagte nur ganz kurz: »Hauen Sie ab, Gossage, und helfen Sie beim Aufstellen der Tische in der Back. Und ein bisschen Dampf drauf!« Er wandte sich entschuldigend an Crammond. »Tut mir leid, Herr Lieutenant, Ihre Zeit mit so einem Geschwätz zu vergeuden. Ist ja nur ein junger Wichtigtuer, der auch einmal was zu sagen haben will.«
»Ich kann das Ganze überhaupt nicht verstehen, Herr Lieutenant«, bemerkte Maat Halfyard und verzog seinen großen Mund wie einer, der über alles Bescheid weiß. »Sollte mir mal passieren, dass ich wegen einem Mädel meine Heimfahrt verpasse! Nehmen und sitzenlassen – das ist mein Wahlspruch. Bloß keine Gefühle – auf keiner Seite.«
Wiederum zeigte Hosick sein Missfallen. Sogar ein Maat hatte nicht das Recht, sielt einem Offizier gegenüber so frei und ungezwungen zu geben. Natürlich war Lieutenant Crammond schuld. Er hielt so gar nicht auf den Abstand zwischen Offizier und Mann, er ermutigte die Leute geradezu zum Reden. Ein ausgezeichneter Offizier, gewiss, und wenn es nötig war, konnte er einen herunterputzen, dass man sich so klein fühlte wie das kleine Getier, das er ständig unter seinem Mikroskop beobachtete, aber sein Verhalten passte ganz und gar nicht zu den traditionellen Vorstellungen, in denen er, Hosick, alt geworden war. Diese Vertraulichkeiten gingen ihm gegen den Strich, das war keine Disziplin mehr.
»Wir können nicht von allen erwarten, dass sie eine so überlegene Einstellung haben«, sagte Crammond lächelnd, »und ein junger Mensch lässt sich von einem hübschen Gesicht schon leicht den Kopf verdrehen. Was ist denn Clemens sonst für ein Mensch?«
»Er hat etwas von einem Salonlöwen«, erklärte Hosick und schaltete sich wieder in das Gespräch ein. »Welliges schwarzes Haar, große braune Augen. Spielt sich als Liebling der Frauen auf. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass er wegen einer Schürze die Heimfahrt schießenlässt.«
»Na ja, Hosick, organisieren Sie auf jeden Fall eine gründliche Suche, und ich werde ihn über die Schiffslautsprecher ausrufen lassen. Wenn wir ihn an Bord nicht finden, muss ich so bald wie möglich die Kommandantur benachrichtigen.«
»Jawohl, Herr Lieutenant.«
Kurz darauf hörte man in den Lautsprechern, die von der Kommandobrücke bis zum untersten Deck im Schiff angebracht waren, ein Knacken und Summen, und dann dröhnte aus ihnen eine Stimme: »Achtung, Achtung! Matrosenobergefreiter Fred Clemens soll sich sofort bei Obermaat Hosick im E-Deck melden.«
Noch mehrere Male wurde in Abständen die Anweisung durchgegeben, und dann kehrte Crammond ins Truppendeck zurück. Unterwegs traf er den Schiffsgeistlichen Ronald Torrens, der sich in der gleichen Richtung bewegte.
»Was ist geschehen?«, fragte Torrens. »Jemand abhandengekommen?«
»Ja. Ein Matrose ist irgendwie abseitsgegangen. Sehr ärgerlich! Es besteht die Vermutung, dass er eines verführerischen Mischlingsmädchens wegen hierbleiben will.«
»Aber das ist doch sicherlich nicht der Fall. Clemens heißt er? Den Namen kenne ich gar nicht. War er in Colombo stationiert?«
»Ja. Landkommando – beim Stab. Hatte wahrscheinlich nicht genug zu tun. Furchtbar ärgerlich, wenn er durchgebrannt sein sollte.«
»Ich hoffe nicht, dass er etwas so Verrücktes getan hat«, erwiderte der Geistliche. »Sicher tauest er wieder auf.«
Das Gesicht des Obermaats Hosick verriet ihnen dann, dass diese Hoffnung unbegründet war.
»Nicht eine Spur, Herr Lieutenant«, meldete er. »Habe das ganze Schiff abgesucht und alle Matrosen befragt. Man hat ihn offenbar zuletzt um sechzehn Uhr bei der Gepäckluke gesehen, als das Arbeitskommando Tee fassen ging. Ich fange allmählich an, die Sache mit dem Durchbrennen an Land ernster zu nehmen. Da steckt vielleicht doch etwas dahinter. Ist ja schließlich auch ganz leicht, bei diesen Krämerbooten, die um das Schiff herumlungern.«
»Es ist zu dumm! Irgendwie müssen wir seiner habhaft werden«, sagte der Geistliche. Sein hageres, asketisches Gesicht war bekümmert. »Kennt denn irgendjemand die Frau, mit der er sich eingelassen hat? Ich könnte an Land gehen und ihn suchen.«
Weitere Nachfragen ergaben jedoch keine wesentlichen Anhaltspunkte. Sogar der mitteilsame Gossage wusste lediglich zu berichten, das Mädchen heiße Insha. Im Übrigen musste er zugeben, keine Ahnung zu haben, was sie möglicherweise treibe und wo sie wohne.
»Da haben wir es, Herr Pfarrer«, sagte Crammond. »Wir können also ganz Colombo nach einem eurasischen Mädchen mit Namen Insha durchkämmen, die einen Matrosen zum Geliebten hat. Das ist keine sehr aussichtsreiche Aufgabe. Sie könnten dabei selbst das Schiff verpassen. Es ist besser, ich gebe der Kommandantur an Land Nachricht und überlasse ihr die weitere Sorge.
»Ich fürchte, es ist tatsächlich der einzige Weg«, stimmte Torrens ihm zu. »Während Sie die Mitteilung durchgeben, spreche ich mit den Leuten. Vielleicht können wir noch irgendetwas feststellen.« Crammond ging auf die Brücke, und einige Minuten später wurde die Nachricht zur Signalstation der Marine hinübergewinkt:
Matrosenobergefreiter Fred Clemens, Nummer der Erkennungsmarke P/BX 473 282, Angehöriger des Heimatkommandos, nicht an Bord. Zu befürchten, dass an Land zurückgekehrt. Bekannt, dass mit Mischlingsmädchen namens Insha befreundet.
Dann kehrte Crammond erhitzt und durstig in den Salon zurück. Dort, fand er eine kleine Gesellschaft versammelt, darunter auch Jim Mills und Rona Stuart, der es gelungen war, von irgendwoher etwas Tee zu beschaffen,
»Gerade zur rechten Zeit, alter Freund«, rief Mills ihm entgegen. »Wie wäre es mi.t einer Tasse? Ich weiß, dass Bier viel passender wäre, aber dies scheint mir ein trockengelegtes Schiff zu sein. Bist du hier schon bekannt? – Lieutenant Crammond – Vera Niven – Staffelführer Summers.«
Vera Niven, eine nicht mehr ganz junge Blondine, lächelte Crammond zuvorkommend an, als sie ihm eine Tasse reichte, während Jack Summers, ein schmächtiger junger Mann mit schwarzem Haar und Schnurrbart, ihm zunickte.
»Ich gehöre auch zu den Unglücksraben in B 55«, bemerkte er. »Es ist genauso schlimm wie auf einem Transporter während des Krieges.«
»Ja, ist es nicht scheußlich?«, rief Vera aus und wandte sich Crammond zu, dem sie sich ganz unmerklich genähert hatte. »In meiner Kabine sitzen wir geradezu aufeinander, und nicht einen Platz gibt es, wohin man seine Sachen hängen könnte. Ein Steward wurde richtig unhöflich, als ich meinen Schrankkoffer hineinschaffen lassen wollte; trotz aller meiner Proteste hat er ihn in den Gepäckraum bringen lassen. Ich habe überhaupt nichts anzuziehen.«
»Das macht fast gar nichts. Uns werden Sie damit kaum in Verlegenheit bringen. – Hallo, was kommt denn da hereingerollt?« Summers wandte sich mit einem leisen Pfiff einem anderen Gesprächsstoff zu. »Was haltet ihr von dieser Stromlinie?«
Die Frau, die gerade in den Salon trat, war eine so auffällige Erscheinung, dass ihr wohl jeder einen zweiten Blick schenkte. Sie war von mittlerer Größe, und ihr Leinenkostüm, hervorragend gearbeitet, hob ihre tadellose Figur vorteilhaft hervor. Das Gesicht war weniger schön als ungewöhnlich und wies einen seltsam straffen Zug um Nase und Mund auf, als spannte sich die Haut über den Knochen. Ihr dunkles Haar war aus dem Gesicht zurückgestrichen. Sie war so sorgfältig zurechtgemacht, als sollte sie im nächsten Augenblick vor eine Filmkamera treten.
»Sieht gefährlich aus, aber nicht ganz mein Geschmack«, erklärte Mills mit der Stimme eines Fachmanns. »Diese heißblütigen dunklen Schönheiten lassen mich kalt.«
»Könnte die schöne Spionin in einem Sensationsfilm spielen«, sagte Crammond.
»Mata Hari«, warf Summers ein.
»Wunderbar!«, rief Vera. »Den Namen hängen wir ihr an. Übrigens – wir teilen die Kabine miteinander. Sie hätten sehen sollen, wie ihr das zuwider war. Eine Mrs. Langford, und ein Mann ist in ihrem Gefolge, der ganz gewiss nicht ihr Ehemann ist. – Ach, da kommt er ja!«
In diesem Augenblick trat ein hochgewachsener, gutaussehender Mann von etwa vierzig Jahren zu Mrs. Langford. Er geleitete sie zu einem kleinen Tisch in einer Nische und, wickelte den Riemen einer Kamera auf, die er umgehängt getragen hatte. Er hatte breite, kraftvolle Schultern, markante Züge und war von der Sonne zur Farbe dunklen Teakholzes verbrannt. Sein dunkles Haar begann grau zu werden.
»Einer von dem Schlag, dem wir das britische Weltreich verdanken«, meinte Crammond. Er zog sein Zigarettenetui hervor und bot den anderen an.
»Sanders vom Strom«, murmelte Summers und ließ sein Feuerzeug aufschnappen.
»Damit haben Sie fast ins Schwarze getroffen«, sagte der Schiffsgeistliche Ronald Torrens, der in diesem Augenblick zu der Gruppe getreten war. »Das ist John Grayson, ein Ingenieur. Hat fast sein ganzes Leben in den Tropen zugebracht – Eisenbahn, Hafenanlagen und dergleichen gebaut. Ein sehr interessanter Mann. Er hat hier draußen in einem Zivilvertragsverhältnis für die Admiralität gearbeitet. Bin recht oft mit ihm zusammen gewesen, bis es ihn vor ungefähr sechs Monaten ganz plötzlich nach Singapur verschlug. Ein feiner Kerl.«
»Haben Sie noch etwas über Clemens feststellen können, Herr Pfarrer?«, fragte Crammond.
»Nein, leider nicht. Es sieht mir wirklich so aus, als ob sich der Junge an Land verdrückt hätte.«
»Sprechen Sie etwa von einem Matrosen mit Namen Clemens – Fred Clemens?« Rona Stuart mischte sich plötzlich ins Gespräch.
»Ja – wieso? Kennen Sie ihn?«
»Und ob! Ich habe doch in der Werftkantine mitgeholfen, und da war er sehr oft zu sehen.«
»Ausgezeichnet! Vielleicht können Sie uns helfen?«, sagte Crammond. »Er ist verschwunden. Und nun besteht der Verdacht, dass er sich dünngemacht und an Land verkrochen hat, um der Rückführung in die Heimat zu entgehen.«
»Aber das ist ja Blödsinn!«, entfuhr es Rona. »Clemens – der dachte doch nur noch daran, nach Hause zu kommen. Das würde er niemals tun. Er nicht.«
Drittes Kapitel
Rona sah sich plötzlich im Mittelpunkt des Interesses.
»Sind Sie sich dessen sicher?«, fragte Crammond. »Ich dachte, er hätte sich leidenschaftlich in eine der verführerischen Schönheiten dieser Stadt verliebt und sich deswegen vor der Überfahrt gedrückt.«
»Vor ein oder zwei Wochen hätte es vielleicht noch stimmen können«, sagte Rona. Sie errötete ein wenig, denn sie war es nicht gewohnt, soviel Aufmerksamkeit zu wecken. »Aber ich glaube, gerade in der letzten Zeit wurde die Sache etwas komplizierter. Natürlich weiß ich nicht, was geschehen ist. Ich nehme an, dass ein früherer Liebhaber des Mädchens plötzlich auftauchte. Er war in eine schreckliche Stimmung geraten, und es sah ganz so aus, als ob er nicht schnell genug aus Colombo hinauskommen könnte. Es war ihm anzusehen, dass ihn irgendetwas stark bedrückte. Er war geradezu darauf versessen, fortzukommen.«
»Sie scheinen ja eine Menge von ihm zu wissen.«
»Es ist erstaunlich, was man alles in einer Kantine erfährt!«, gab sie lachend zu. »Die Männer redeten immer gern von ihren Sorgen und Nöten und schienen uns beichten zu wollen. Wenn man die Stücke zusammensetzte, kannte man sie bald recht gut. Fred Clemens hat mir zwar niemals etwas Genaueres davon erzählt, aber ich habe doch gemerkt, dass er in ein Mischlingsmädchen verliebt war. Ich wusste auch, dass er alles daransetzte, seine Kommandierung in die Heimat rückgängig zu machen. Das heißt, bis vor etwa zwei Tagen. Da war er plötzlich völlig verändert und schien es verzweifelt eilig damit zu haben, wegzukommen.«
»Jedenfalls könnte, ich mir vorstellen, dass ein alter Liebhaber so eines Mädchens einem hier die Hölle heiß machen kann«, bemerkte Summers und lachte auf.
Crammond wandte sich wieder Rona zu.
»Sagen Sie, wissen Sie irgendetwas Näheres über diese Freundin von Clemens oder ihren Liebhaber?«
»Nein, leider nicht.« Sie streifte Summers mit einem Blick und bemerkte das ironische Lächeln in seinem Gesicht. »Ich weiß nur, dass es eine solche Person gab, und dass er es eigentlich gern hörte, wenn seine Kameraden ihn ihretwegen neckten. Aber das trifft, wie gesagt, auf die letzten beiden Tage nicht mehr zu. Da schien alles schiefzugehen. Mehr weiß ich nun aber wirklich nicht mehr darüber.«
»Sagen Sie, dieser Clemens – was für ein Mensch ist er eigentlich? Ich meine, im persönlichen Umgang?«
Rona dachte einen Augenblick nach, bevor sie antwortete. »Er sieht sehr nett aus – bildet sich allerdings auch einiges darauf ein. Er tanzt ausgezeichnet, und wo es um Mädchen geht, ist er sehr unternehmungslustig. Er scheint da keine Grenzen zu kennen, und man muss ihn ziemlich energisch zurechtstutzen.«
»Dürfte ein feines Exemplar sein«, warf Mills heftig ein.
In diesem Augenblick wurden sie vom Lautsprecher unterbrochen; man gab die Einteilung zu den Mahlzeiten bekannt. Wegen des Platzmangels im Speisesaal mussten die Mahlzeiten in zwei Abteilungen serviert werden. Die erste Gruppe sollte um neunzehn Uhr essen.
Die Gesellschaft löste sich auf, und Crammond, Mills und Summers gingen zusammen in ihre Kabine zurück.
»Was hältst du von Rona?«, fragte Mills ganz nebenbei.
»Ich muss gestehen, darüber habe ich noch nicht weiter nachgedacht«, erwiderte Crammond gleichgültig. »Aber weil du mich fragst: Sie hält wohl einen Vergleich mit dem guten weiblichen Durchschnitt aus.«
»Du hast auch nur Fischblut in den Adern«, knurrte Mills und versetzte ihm einen Stoß zwischen die Rippen. »Im Übrigen würde ich mich an deiner Stelle ein wenig vor dieser Niven vorsehen. Als sie dich ansah, bekam sie in den Augen das raubgierige Leuchten eines wilden Tieres, das auf Jagd zieht und ziemlich ausgehungert ist.«
»Rede doch nicht solchen Unsinn! Und nimm alle Kraft zusammen, denn jetzt müssen wir dem Sahib Bickerton gegenübertreten.«
In der Kabine war Bickerton gerade damit beschäftigt, sich die verschwitzte Jacke und das feuchte Hemd auszuziehen. Das weißliche, aufgeschwemmte Fleisch seines Wanstes quoll ihm über den Gürtel. Er bot keinen besonders schönen Anblick. Ein kleiner, pedantisch aussehender Oberstabsarzt saß auf einer der unteren Kojen und betrachtete ihn mit offenem Abscheu.
»Mein Name ist Paul Ledbury«, sagte der Oberstabsarzt, indem er sich den drei jüngeren Offizieren vorstellte. »Ich begreife nicht ganz, wie wir uns alle auf diesem engen Raum anziehen sollen.«
»Macht alles nichts, wir haben Heimatkurs«, erwiderte Mills lustig.
»Schön und gut für junge Leute wie Sie, denen es auf etwas weniger Bequemlichkeit nicht so ankommt«, sagte der Oberstabsarzt mürrisch. »Aber die Hygiene ist ja auch noch zu beachten. Den behördlichen Bestimmungen entsprechend soll jeder Mann ein Minimum von zweihundert Kubikfuß Luft in seinem Quartier haben, während wir hier, auf jeden Mann umgerechnet, nur rund fünfundneunzig Kubikfuß zur Verfügung haben.«
»Da haben wir’s!«, murrte Bickerton. »Weniger als das behördliche Maß, und das ist, bei Gott, wenig genug.«
Oberstabsarzt Ledbury fuhr mit pedantischer Stimme fort: »Natürlich sind die Zustände in den Mannschaftsdecks noch weit übler. Das kann zu sehr ernsthaften gesundheitlichen Folgen führen, denn nach einem Aufenthalt von zwei oder drei Jahren in den Tropen ist die Widerstandskraft der Europäer gegenüber Krankheiten ganz erheblich herabgesetzt; ich würde mich also gar nicht wundern, wenn die Keime für eine spätere Tuberkulose gerade auf dieser Reise bei einer Anzahl unglücklicher Leute ihren ersten Nährboden finden.«
»Sie sind mir ja ein ganz besonders munterer Vertreter!«
In diesem Augenblick trat John Grayson in die bereits überfüllte Kabine, blieb an der Tür stehen und sah mit einem spöttischen Lächeln um sich.
»Der reine Zirkus!«, rief er aus. Dann erblickte er Bickerton, der gerade ein Tuch um seinen umfangreichen Bauch schlang, und zog die Augenbrauen hoch. »Archie Bickerton! Mein Gott, sollen etwa Sie und ich die gleiche Kabine teilen? Na, wenn das kein Witz ist!« Bickertons aufgequollenes Gesicht verfärbte sich von neuem, als er den Ankömmling anstarrte.
»Grayson!« Seine kleinen Augen leuchteten auf. Aber es war kein Aufleuchten der Freude. »Mussten Sie sich ausgerechnet hierher verirren?«
»Ich wäre auch sehr viel lieber woanders«, sagte Grayson ganz offen. »Wir haben eben beide Pech. Im Übrigen nehme ich von Port Said aus das Flugzeug; wir brauchen es also nur bis dorthin miteinander auszuhalten.«
Bickerton grunzte etwas Unverständliches, drängte sich an ihm vorbei, verschwand im Bad und schlug die Tür heftig hinter sich zu.
»Sehr liebenswerter Charakter«, bemerkte Summers. »Sie scheinen ihm aber ziemlich auf die Nerven zu gehen.«
Grayson lachte, während er seine Kamera in seinem Handkoffer verstaute.
»Man kann wohl sagen, dass fast jeder Archibald Bickerton auf die Nerven geht. Ich kenne keinen Menschen, der so reizbar wäre wie er.«
»Was hat er denn für einen Beruf?«, fragte Crammond und nahm Bickertons Handkoffer von seiner Koje, den dieser dort abgestellt hatte.
»Technischer Direktor einer einheimischen Reederei. Sie hat ein halbes Dutzend morscher alter Trampdampfer, die er irgendwie immer wieder zusammenflickt, womit er für die Firma Geld scheffelt. In seinem Beruf ein durchaus tüchtiger Mann und seiner Firma treu ergeben. Einer von den Engländern, die man niemals aus Indien vertreiben wird, denn er kommt mit den Indern weit besser zurecht als mit seinen eigenen Landsleuten. Ich hatte hin und wieder geschäftlich mit ihm zu tun – es ging darum, seine Schiffe ins Dock zu bringen und zu reparieren. Es ist ganz natürlich, dass er mich als seinen Erbfeind betrachtet. Feilscht um jede Rupie und glaubt immer, dass man ihn übervorteilen will.«
»Er ist körperlich in sehr schlechter Verfassung«, bemerkte Oberstabsarzt Ledbury, der gerade mit peinlicher Genauigkeit eine saubere Uniformjacke zurechtlegte. »Isst und trinkt viel zu viel.«
»Ganz Ihrer Meinung«, sagte Grayson. »Ich glaube auch, dass sein Arzt ihn gewarnt hat. Ich könnte mir denken, dass er uns hier jeden Augenblick zerplatzt.«
Ledbury nickte zustimmend. »Ein höchst unangenehmer Mensch. Ich traf ihn vor ungefähr sechs Monaten auf einer kleinen Bridgeparty. Da war er mein Partner, und ich weiß nicht, ob ich jemals vorher einen so unangenehmen Abend verbracht habe. Er hatte die Unverschämtheit, mein Spiel zu kritisieren, und dabei lag alles nur daran, dass er ständig zu hoch bot. So gute Karten hatte er gar nicht. Wir verloren ganz erheblich, und er war hinterher geradezu beleidigend in seinen Ausdrücken.«
Einige Minuten später tauchte Bickerton wieder auf. Er beklagte sich über die unzulängliche Warmwasserversorgung. Dann hatte er einen Zusammenstoß mit Crammond, dessen Koje er sich anzueignen suchte – sie war zweifellos auch die günstigste, da sie unterhalb des großen Bullauges stand.
»Sie haben meinen Koffer von der Koje genommen!«, fuhr er ihn an.
»Gewiss – denn ich habe ältere Ansprüche auf diese Koje«, erwiderte Crammond ruhig. »Ich hatte bereits als Zeichen meiner Besitzergreifung meinen Stock daraufgelegt, aber ich sehe, dass jemand ihn entfernt hat.«
»Ganz richtig, alter Freund«, unterstützte ihn Mills. »Wir waren die ersten in dieser Kabine, und du hast mich um Nasenlänge bei, dieser Koje geschlagen.«
Bickerton gab nach, aber es war ihm anzusehen, wie sehr es ihm gegen den Strich ging. Die Atmosphäre in der Kabine blieb daher gespannt, und alle zogen sich so schnell wie nur möglich um und verschwanden. Als das Signal zum Essen ertönte, standen sie alle bereits in der Menge der Wartenden vor dem Speisesaal, dessen Türen noch geschlossen waren. Mills suchte Rona Stuart, und Grayson stand mit Mrs. Langford ziemlich weit vorn. Mrs. Langford verstand es, ihren exotischen Zauber mit kühler Arroganz zu verbinden, und trotz der Hitze war ihr Kostüm noch immer makellos.
»Wer ist sie eigentlich?«, fragte Summers, »und warum erlaubt ihr Mann, dass sie so frei herumläuft?«
»Mrs. Langford ist eine etwas geheimnisvolle Person«, erwiderte Oberstabsarzt Ledbury, offenbar stets in der Lage, Auskunft zu geben. »Ihr Mann soll sich in Malaya aufhalten, aber es scheint niemand recht zu wissen, wie sie miteinander stehen. Sie hat etwa drei Monate in Colombo gelebt und scheint sehr viel Geld zu haben. Sie gehört zu jenen Frauen, über die in jeder Gesellschaft gesprochen wird – die aber auch selbst dafür sorgen. Selbstverständlich habe ich hier und dort etwas über sie gehört, aber mit ihr selbst habe ich nicht ein einziges Mal gesprochen.«