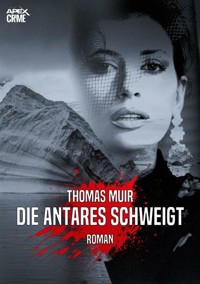6,99 €
Mehr erfahren.
Es ist wissenschaftlicher Ehrgeiz, der den Meeresbiologen Roger Crammond dazu treibt, trotz der Warnung Angela Torsons und Tony Manfrieds ein Wrack zu untersuchen, das an der Küste einer kleinen westindischen Insel auf Grund liegt.
Aus der Warnung wird eine Drohung - dann setzen Angela und Tony noch wirksamere Mittel ein: Maschinengewehre und Wasserbomben.
Als schließlich ein Mord geschieht, glaubt Crammond genau zu wissen, wen er als Täter überführen kann...
Der Roman Mord unter Wasser des schottischen Schriftstellers und Journalisten Thomas Muir (* 02. Januar 1918; † 8. Oktober 1982) erschien erstmals im Jahr 1956; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1961.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
THOMAS MUIR
Mord unter Wasser
Roman
Apex Crime, Band 218
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
MORD UNTER WASSER
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Das Buch
Es ist wissenschaftlicher Ehrgeiz, der den Meeresbiologen Roger Crammond dazu treibt, trotz der Warnung Angela Torsons und Tony Manfrieds ein Wrack zu untersuchen, das an der Küste einer kleinen westindischen Insel auf Grund liegt.
Aus der Warnung wird eine Drohung - dann setzen Angela und Tony noch wirksamere Mittel ein: Maschinengewehre und Wasserbomben.
Als schließlich ein Mord geschieht, glaubt Crammond genau zu wissen, wen er als Täter überführen kann...
Der Roman Mord unter Wasser des schottischen Schriftstellers und Journalisten Thomas Muir (* 02. Januar 1918; † 8. Oktober 1982) erschien erstmals im Jahr 1956; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1961.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
MORD UNTER WASSER
Erstes Kapitel
Mit einer Unterwasserkamera bewaffnet, schwamm Roger Crammond langsam über die phantastischen Korallenbänke und Riffe an der Küste der westindischen Insel San Monique. Mit dem geschärften Auge des Wissenschaftlers studierte er die reiche Meeresfauna, die in dieser eigenartigen Unterwasserwelt lebte, liebte, sich vermehrte, fraß oder gefressen wurde.
Mit Tauchermaske und Sauerstoffflaschen ausgerüstet, konnte er sich hier mit der gleichen Leichtigkeit bewegen und atmen wie die buntgestreifte Brasse, die an ihm vorbeihuschte; wie der Regenbogenfisch, der ihn mit kühler Verachtung betrachtete, bevor er ihm mit einem kurzen Schlag seines Schwanzes aus dem Wege schwamm; wie die breitmäulige Meerbarbe, die stets verdutzt dreinblickte und mit gespannter Aufmerksamkeit den silbrigen Strom der Luftblasen betrachtete, die aus seiner Maske aufstiegen.
In fünfundzwanzig Meter Tiefe waren alle Farben in Schattierungen von Blaugrün verwandelt. Es war eine merkwürdige Welt durchsichtigen Zwielichts, in der die Sicht sich nach zwanzig Meter in einer bläulichen Unendlichkeit verlor. Obwohl er doch schon häufig getaucht war, konnte Crammond unter Wasser niemals das Gefühl tiefster Einsamkeit überwinden, das Gefühl, als ob er sich in einer vierten Dimension bewegte. Immer blieb ihm die ungeheure Ausdehnung der Wassermassen um ihn herum bewusst, stets erschien ihm das silbrige Dach, das für ihn die Meeresoberfläche, das Licht und den Sonnenschein darstellte, unermesslich weit entfernt. Gelegentlich warf er wohl einen Blick nach oben, um sich durch den Anblick des Kiels seines Motorbootes zu beruhigen, in dem der frühere Obermaat Ralph Hosick mit den Augen getreulich den aus seiner Maske aufsteigenden Luftblasen folgte oder durch ein Glasfensterchen zu ihm herunterspähte. Irgendwie war diese Verbindung mit der normalen Welt ermutigend. Sie war für ihn eine Versicherung, dass er jederzeit auf die Oberwelt zurückkehren konnte. Mit einem prüfenden Blick auf seine wasserdichte Armbanduhr setzte er seine Erkundungsreise fort.
Ganz in seine Arbeit vertieft, fand er sich unerwartet einem Hindernis gegenüber; es sah wie ein überhängendes Korallenriff aus, das sich vom Grund des Meeres zehn Meter hoch auftürmte. Er wandte sich um und schwamm ein paar Meter zurück, um eine bessere Übersicht zu gewinnen. Nun erkannte er das Wrack eines Schiffes, so vollkommen mit Korallen bewachsen, dass seine Form in ihren Linien schon verwischt war.
Diese Entdeckung konnte ihm sehr nützlich sein. Wenn es ihm gelang, festzustellen, wie lange das Wrack hier schon lag, so besaß er damit einen ausgezeichneten Maßstab, um die Wachstumsrate der verschiedenen Korallenarten in verschiedenen Meerestiefen zu messen; am Kiel, der schon in den Meeresgrund eingegraben war, und, im Vergleich dazu, am Schornstein, der weit zur Oberfläche des Meeres hinaufragte.
Langsam schwamm er an der Bordwand des Schiffes entlang. Schließlich fand er, gerade vor der Schiffsbrücke, ein großes, gähnendes Loch, das in ihm die Vermutung erweckte, dass das Schiff einem Torpedoangriff zum Opfer gefallen war. Ein leichtes Anfüllen der Lungen mit Luft und ein oder zwei Schwimmstöße brachten ihn zu der höhlenartigen Öffnung hinauf, und einige Beinstöße ließen ihn in die Dunkelheit des Schiffsbauchs gleiten, den er mit seiner elektrischen Taschenlampe ableuchten konnte.
Das Innere des Schiffes war eine Wirrnis von verbogenem, mit Algen bewachsenem Stahl und einer harten Masse, die ihm zuerst wie Felsblöcke erschien. Sie war hier im Laderaum zu einem steilen Berg aufgetürmt, der sich wohl durch die Torpedoexplosion gebildet haben mochte. Aber etwas weiter von der Explosionsstelle entfernt hatten diese Felsbrocken merkwürdigerweise das Aussehen von kissenförmigen Blöcken angenommen, auf denen Meerespflanzen wucherten. Bei genauerem Betrachten sah er, dass sie auf dickem, festem Papier wurzelten. Die Ladung des Schiffes hatte also aus Säcken mit Zement bestanden, der jetzt zu Beton erstarrt war.
Mit ein paar Stößen nach oben kam er so hoch, dass er den Raum zwischen der Ladung und der Unterseite des Decks erforschen konnte.
Plötzlich fiel ihm an der hinteren Schottenwand eine merkwürdige Erscheinung ins Auge, die sofort seine Aufmerksamkeit erweckte. Er schwamm hin, um sich die Stelle anzusehen.
In einer Entfernung von etwa dreißig Zentimeter von der Schottenwand fanden sich auf etwa drei Meter Länge keinerlei Meeresgewächse, und diese sterile Zone war außerdem noch mit einem Rand umgeben, in dem alle Gewächse spärlich und verkümmert wären. Oberhalb dieser Stelle war auch die Unterseite des Decks völlig unbewachsen; offenbar hatte sich auch dort eine Zone völliger Sterilität gebildet.
Diese Unfruchtbarkeit stellte ein biologisches Problem dar, das in Roger Crammond all die Fähigkeiten auf den Plan rief, die aus ihm einen guten Wissenschaftler – und einen vielleicht noch besseren Kriminalisten gemacht hatten. Aber da die Zeit, gemessen an dem Luftvorrat in seinen Flaschen, knapp wurde, ließ er das Problem für den Augenblick auf sich beruhen und schwamm aus dem Laderaum ins Freie.
Mit der dreidimensionalen Beweglichkeit des freien Tauchers schoss er aufwärts und machte sich daran, das Oberdeck zu erforschen. Das Schiff lag in einem Winkel von zwanzig Grad seitlich geneigt. Der Bug ragte in die Höhe, und das Heck lag fast so niedrig wie die es umgebenden Korallen. Offenbar hatte sich das Schiff in eine tiefe Kluft im Meeresboden gelegt. Er war jetzt ganz sicher, dass das Schiff torpediert worden war, denn das Vorderdeck war aufgerissen, und der Vordermast fehlte. Der Hauptmast lag in einem Wirrsal von Seilen und Stahltrossen auf dem Hinterdeck. Eine nähere Untersuchung zeigte, dass er kürzlich mit einem Unterwasser-Schweißapparat abgeschnitten worden war – ebenfalls ein eigenartiger Umstand.
Während ihm diese Gedanken durch den Kopf gingen, stieß er kräftig mit den Plastikschwimmhäuten an seinen Füßen aus, bis er die Back des Schiffes mit ihrer korallenüberkrusteten Ankerwinde erreichte. Dort erblickte er wieder etwas, was seine Aufmerksamkeit sofort auf sich zog: Die Kette des Backbordankers war völlig von Bewuchs gereinigt worden, sodass sich ihre großen, verrosteten Glieder deutlich von den verschwommenen Konturen aller übrigen Geräte abhoben. Der Anker selbst fehlte; an seiner Stelle war ein starkes Drahtseil befestigt, das nach oben führte. Wenn er sich halb auf den Rücken legte, konnte er sehen, wie das Seil über, die Oberfläche des Wassers hinausging, wo es am Bug eines kleinen Schiffes endete.
Er hatte, bevor er tauchte, einen kleinen, recht verkommenen Schlepper bemerkt. Nun wurde ihm klar, dass von dem Schlepper aus Bergungsarbeiten an dem Wrack im Gange sein mussten; aber es schien eigentlich nichts da zu sein, was eine Bergung lohnte, wenn nicht die Bunkerkohle, die aus dem Wrack geborgen werden konnte, auf der Insel Handelswert besaß.
Er fühlte, dass es ihm schwerer wurde, zu atmen; diese Tatsache zeigte ihm an, dass er das Ende seines Vorrats an Sauerstoff erreicht hatte. Er griff nach den drei Metallflaschen auf seinem Rücken und öffnete den Hahn der Reserveflasche. Damit hatte er, wie er wusste, noch eine halbe Stunde Zeit, um die Oberfläche zu erreichen. Er begann, nach oben zu schwimmen, und zwar langsam und mit gelegentlichen Pausen, um seinem Körper zu erlauben, sich auf die Druckveränderungen in den verschiedenen Tiefenschichten umzustellen.
Als er schließlich neben seinem eigenen Motorboot auftauchte, bemerkte er, dass Hosicks breites, rundes Gesicht einen ungewohnt verärgerten Ausdruck trug. Er kletterte die kurze Leiter hinauf, nahm seine Maske ab und atmete dankbar in tiefen Zügen die reine Luft ein, die nach dem abgestandenen, metallischen Geschmack der Luftkonserve geradezu herrlich war.
»Was haben Sie denn, Hosick?«, fragte er, als sein untersetzter Helfer begann, ihm die Taucherausrüstung abzunehmen. »Glauben Sie vielleicht, dass mich ein Tintenfisch gefressen hat, als ich in das Wrack schwamm?«
»Das ist es nicht, Sir«, sagte Hosick ärgerlich, »obgleich ich mich ehrlich erleichtert fühlte, als Sie wieder zum Vorschein kamen. Aber das dort!« Und er zeigte mit dem Daumen auf den schäbigen Schlepper, der ein paar hundert Meter entfernt vor Anker lag.
»Nanu – was hat Ihnen denn das Schiff getan?« Crammond sah auch zu dem Schlepper hinüber. »Ich habe bemerkt, dass es mit dem Wrack verbunden ist, obgleich ich mir nicht vorstellen kann, was man aus dem Wrack bergen will.«
»Nicht das Schiff, das Weib, das dort kommandiert, meine ich.«
»Welches Weib?«
»Sie haben gut fragen, Sir. Sie ist die ausgekochteste Xanthippe, die ich in meinem Leben gesehen habe – und das will schon etwas heißen. Dabei sieht sie ganz gut aus, könnte man sagen, aber man kriegt Angst, wenn man sie ansieht. Ihre Zunge ist so scharf wie ein Rasiermesser, und wie sie spricht – dagegen ist meine Sprache die eines Pastors auf einer Mütterversammlung.«
»Sie ist ganz bestimmt die Lieblingsfrau des Teufels selbst«, warf der Negerbootsmann ein, dem das Motorboot gehörte. Er hatte es sich hinten beim Steuer gemütlich gemacht. Jetzt rollte er ausdrucksvoll die Augen. »Jawohl, Sir, so ein Geschimpfe habe ich noch nie gehört!«
»Interessant!« Crammond versuchte, sich die Szene auszumalen, während er das Wasser aus seinem Haar schüttelte. »Was hat denn diese Amazone so in Harnisch gebracht? Haben Sie vielleicht Annäherungsversuche gemacht, Hosick?«
Hosick schluckte.
»Für was halten Sie mich denn, Sir? Ich beobachtete Sie durch das Fenster, als ich plötzlich von dieser Bestie so angebrüllt wurde, dass ich fast ins Wasser kippte. Da stand sie, fuchtelte mit einem Gewehr herum, fluchte, dass sich mir die Haare sträubten, und drohte, mich niederzuschießen, wenn ich nicht sofort machte, dass ich fortkäme. Zuerst versuchte ich es auf die sanfte Tour – damit komme ich im Allgemeinen zum Ziel –, aber diesmal goss ich damit nur Öl ins Teuer. Dann versuchte ich, ihr Vernunft zu predigen, und erklärte ihr, dass Sie dort unten herumschwömmen – aber das war es gerade, worüber sie sich so aufregte – und dass ich Sie nicht heraufholen könnte. Ich sagte ihr, Sie würden schon von selbst nach oben kommen, wenn Sie Ihre Tanks geleert hätten. Aber ich hätte ebenso gut mit einem Haifisch argumentieren können, soviel gab sie auf mein Reden. Sie ist wirklich ein Satan, Sir!«
»Offenbar!«, lächelte Crammond, der vor einer Frau, die den Obermaat Hosick mit seiner achtundzwanzigjährigen Erfahrung bei der Kriegsmarine in die Flucht schlagen konnte, allen Respekt hatte. »Ich sollte wohl mit der Dame selbst sprechen und mich bei ihr entschuldigen, wenn ich in ihrem Revier gewildert habe.«
»Sie ist keine Dame, Sir. Wenn ich Ihnen etwas raten darf, so meine ich, wir sollten die Anker lichten und fortfahren. Bei einem solchen Teufelsbraten können Sie mit Entschuldigungen nichts ausrichten.«
»Jetzt haben Sie mich erst neugierig gemacht. Fahren Sie an den Schlepper heran – während ich mir Hosen anziehe. Ein Mann ohne Hosen ist stets gehemmt.«
»Wollen Sie das wirklich wagen, Sir?«
»Natürlich!«
»Zu Befehl, Sir.« Nachdem er seine Missbilligung zum Ausdruck gebracht hatte, verfiel Hosick wieder in seine Marinegewohnheit, ohne Widerrede zu gehorchen. Dieses Prinzip war es auch, das er dem eingeborenen Bootsmann einzuimpfen versuchte. »Los, Joe!« Eigentlich hieß der Mann Emanuel Josephus Hobson. »Los! Die Kaffeemühle in Gang bringen! Und zwar ein bisschen dalli!«
Brummend und murrend nahm Joe seinen zerrissenen Strohhut ab, zog sich seine zerfetzten kurzen Hosen höher und ließ die alte Zwei-Zylinder-Maschine an. Mit beunruhigendem Klappern loser Ventile und Lager erwachte sie prustend zum Leben.
Dieser Lärm brachte auf dem anderen Schiff das erste Lebenszeichen hervor, das Crammond bisher gesehen hatte. Das Schiff war wohl ein alter amerikanischer Hafenschlepper; sein Rumpf lag tief, und in der Mitte besaß er einen Aufbau. Er hatte auch ein geschlossenes Ruderhaus und einen Schornstein, der nur ein Auspuff war. Jetzt erschien ein blonder Kopf hinten auf der Kajütentreppe, und eine Frau, deren kurvenreiche Gestalt auch ein raues Hemd und blaue Hosen nicht verbergen konnten, tauchte auf und starrte auf das sich nähernde Motorboot. In der Biegung ihres Armes hielt sie eine recht bösartig aussehende Maschinenpistole.
»Das ist sie, Sir!«, sagte Hosick ganz überflüssigerweise.
Crammond hielt sie für eine Mischung von nordischem und romanischem Blut, obwohl der Augenblick für Spekulationen über Rassenfragen nicht sehr glücklich gewählt schien.
»Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie machen sollen, dass Sie fortkommen?«, empörte sich die Frau und griff vielsagend an ihr Gewehr. Sie warf auf den Biologen einen raschen, abschätzenden Blick. »Was soll denn das bedeuten, dass Sie hier herumschnüffeln?«
»Ich möchte mich nur entschuldigen, wenn ich Ihnen in die Quere gekommen bin«, rief Crammond diplomatisch, als das Motorboot an den Schlepper heranfuhr. »Ich hatte doch keine Ahnung, dass ich auf verbotenem Gebiet war. Übrigens ist mein Name Crammond – Doktor Crammond.«
»Ich habe nichts für Doktoren übrig – besonders nicht für Doktoren aus England!«, fügte sie ganz überflüssigerweise hinzu.
»Ich bin aber kein Arzt, sondern Doktor der Philosophie«, erklärte ihr Crammond mit einem etwas selbstbewussten Lächeln. Der Titel war ihm immer noch neu und nicht recht gewohnt. »Meeresbiologie ist mein Fach, und daraus erklärt sich auch mein Herumschwimmen unter Wasser.«
»Ein Federfuchser, wie?« Ihr Mund verzog sich höhnisch. »Nun, hören Sie mir einmal zu, Herr Doktor der Philosophie, und nehmen Sie das gefälligst zur Kenntnis: Ich möchte nicht gern grob werden, aber Sie und Ihre verdammten Leute haben bei diesem Wrack da nicht das geringste zu suchen. Verstehen Sie mich?«
»Knapp und sachlich gesprochen«, nickte Crammond freundlich, während Hosick im Hintergrund leise Geräusche von sich gab. »Aber was ich nicht ganz verstehe, Miss – äh...«
»Torson«, sagte sie widerwillig.
»Vielen Dank.« Crammond nahm die Tatsache zur Kenntnis, dass also offenbar das skandinavische Blut von ihrem Vater her kam. »Was ich nicht ganz verstehe, Miss Torson, ist, warum dieses alte Wrack so strikt unter Eintritt verboten rangieren soll. Als Wissenschaftler möchte ich gern den Grund für alles wissen, und ich bin imstande, wenn er mir nicht freiwillig gesagt wird, so lange zu suchen, bis ich die Antwort selbst gefunden habe.« Ihre Augenbrauen zogen sich zusammen; es sah fast aus, als ob jetzt ein Wutausbruch kommen werde.
»Sie suchen also Streit?«
»Im Gegenteil! Leben und leben lassen ist meine Devise. Aber glauben Sie nicht, dass Sie das Maschinengewehr beiseitelegen können, während wir uns vernünftig unterhalten?«
»Lass dir von dem Kerl keine Flausen vormachen, Angela!«, fiel hier eine Stimme ein, und ein verfetteter, verschlagen aussehender Mann mit gewelltem Haar und verwaschenen Zügen tauchte auf der Kajütentreppe auf. Er sah Crammond durch dicke, verzerrende Brillengläser mit Abneigung an. »Wir lassen es uns nicht gefallen, dass sich jemand hier herumtreibt!«
»Ich sage ihm schon Bescheid, Tony!«, versicherte ihm die Frau, während Crammond, über das Unpassende des Namens Angela amüsiert, den Neuankömmling betrachtete, als ob er ein merkwürdiges Seetierchen wäre. Angela Torson fing seinen Blick auf, und ihre Stimme wurde weicher, als sie ihn vorstellte: »Mein Mann – Tony Manfried – der Dramatiker, wissen Sie.«
Crammond war der Name zwar nicht bekannt, aber er stellte sich, als ob das doch der Fall wäre. Seine Höflichkeit hatte jedoch nicht viel Erfolg, denn Tony Manfried sagte herablassend, während er sich seine bunte, handgemalte Krawatte glattstrich: »Du kannst nicht erwarten, dass so ein wissenschaftlicher Pedant Kunst zu würdigen weiß.«
»Offenbar weiß er noch nicht einmal die Tatsache zu würdigen, dass er hier völlig überflüssig ist.« Angela wandte sich wieder an Crammond. »Wenn Sie es durchaus wissen müssen, wir arbeiten an dem Wrack und dulden nicht, dass Sie oder Ihre Badepuppen von der Jacht sich hier herumtreiben; dabei kann Ihnen nur sehr leicht etwas Peinliches zustoßen. Das ganze übrige Karibische Meer gehört Ihnen, und ich fordere Sie höflichst auf, sich an eine andere Stelle zu bemühen. Das gilt ebenso für Harry Mossbeck und sein schwimmendes Millionen-Dollar-Bordell – das können Sie ihm von mir ausrichten. Ich habe doch wohl recht, dass Sie auch auf seiner Lohnliste stehen und dass dieser wissenschaftliche Quatsch nur Tarnung ist?«
»Wenn Sie das Wrack gekauft haben und an ihm Bergungsarbeiten ausführen, so fällt es mir natürlich nicht im Traum ein, mich hier einzudrängen«, sagte Crammond höflich. »Aber das Wrack ist vom wissenschaftlichen Standpunkt aus sehr interessant, und ich hoffte –«
»Was wollen Sie denn eigentlich?«
Zu Crammonds Überraschung wurde sie plötzlich steif und umfasste das Gewehr so fest, dass ihre Knöchel ganz weiß wurden.
»Ich meine, an dem Wrack ließe sich die Wachstumsrate verschiedener Arten von Korallen besonders gut studieren.«
Angela Torson, oder vielmehr Angela Manfried, entspannte sich, blieb aber immer noch wachsam und auf der Hut.
»Wozu so etwas gut sein soll, das kann nur ein Kerl wie Sie wissen«, sagte sie verächtlich. »Aber in jedem Fall werden Sie Ihre Forschungen irgendwo anders betreiben müssen.«
»Das ist jedenfalls deutlich.« Crammond nahm die Zurechtweisung an und grinste. »Mit Ihnen kann man wenigstens mit erfrischender Direktheit verhandeln.«
»Ja? Nun, wenn Sie nur halb so schlau sind, wie Sie zu sein glauben, dann machen Sie schnellstens, dass Sie von hier fortkommen – und fortbleiben!«
»Ich kann jedenfalls nicht sagen, dass ich nicht gewarnt wurde.« Er sah ihr fest in die Augen. »Adieu – schade, dass wir nicht besser miteinander auskommen konnten.«
Das Maschinengewehr an der Hüfte, beobachtete Angela Torson, wie das Motorboot in Richtung auf den Strand fortfuhr. Zwischen ihren hochgewölbten Brauen stand eine Falte. Tony Manfried sah sie unsicher an.
»Glaubst du, dass er auf einen Verdacht gekommen ist?«, fragte er ängstlich. Es klang fast wie ein Blöken.
»Noch nicht. Aber er ist so ein langnasiger, neugieriger Typ, der alles Mögliche fertigbringt. Aber verlass dich nur auf mich – weder er noch Harry Mossbeck kann uns an unserer Arbeit hier hindern.«
Zweites Kapitel
»Wenn Sie mir gestatten, so etwas zu sagen, Sir, Sie verstehen sich aber wirklich auf Frauen!«, sagte Hosick bewundernd, als sie außer Hörweite gekommen waren. »Sie hat Ihnen ja praktisch aus der Hand gefressen, wie man sagen möchte!«
»Den Eindruck hatte ich eigentlich nicht«, grinste Crammond. »Mir war nicht sehr wohl zumute, als sie das Maschinengewehr auf mich richtete, und ihre Tonart war nicht liebenswürdig.«
»Ich meine ja auch nur, im Vergleich mit dem, was sie mir gesagt hat. Das werde ich nicht so schnell vergessen!« Hosick brütete finster über der offenbar schmerzlichen Niederlage, die er in seinem Rededuell erlitten hatte. Bald klärte sich jedoch sein Gesicht auf. »Haben Sie schon einmal so eine Karikatur von einem Menschen gesehen, wie diesen sogenannten Ehemann von ihr? Er, geschniegelt und gebügelt mit seinem lächerlichen Hemd und seiner albernen Krawatte, und sie im Arbeitsanzug? Dort geht etwas verdammt Komisches vor, wenn Sie mich fragen!«
»Das Ganze könnte wirklich aus den Memoiren eines Psychoanalytikers stammen«, nickte Crammond und starrte gedankenvoll vor sich hin. »Aber besonders wundert mich, warum sie sich für ein Wrack interessieren, das mit Zement voll ist! Selbst wenn sie beabsichtigen, die Bunkerkohle aus dem Wrack herauszuholen und an die Leute hier zu verkaufen, kann ich nicht sehen, wie sich so etwas lohnen oder die Methoden des Wegscheuchens rechtfertigen kann!«
»Bei solchen Leuten kann man nie wissen, Sir.« Hosick spuckte mit Nachdruck über die Bordwand. »Was sie nur in dem aufgeputzten Gigolo von Mann sehen mag! Er mit seinem weibischen Gehabe! Wenn man ihn nur ansieht, dreht sich einem ja der Magen um!«
Das Motorboot fuhr auf die zerstreuten Riffe zu, die die Wellen des Ozeans mit schneeigem Schaum übergossen; an ihnen brach sich die Dünung des Meeres, bevor sie als harmlose kleine Weilchen am Strand unter den Palmen hinauflief. Mit seinen beiden Bergkuppen, die bis zur Spitze mit dunkelgrüner Vegetation bestanden waren, besaß San Moniere in den Kiemen Antillen das aufdringlich Malerische der knalligen Propaganda eines Reisebüros. Die Insel erhob sich aus einem tiefblauen Meer. Sie war ringsum von schneeweißem Sandstrand umgeben, hinter dem Palmen in einer kühlen Brise rauschten.
Im Hafen lagen mehrere Handelsschoner, die gemächlich Ladung entnahmen; man übersah sie jedoch, da eine palastartige Fünfhundert-Tonnen-Motorjacht sofort die Augen auf sich zog. Sie lag, ganz schimmernder weißer Lack und glänzendes Mahagoni, in der Mitte der Bucht vor Anker. Von ihrem Flaggenmast wehte das Sternenbanner der Vereinigten Staaten von Amerika.
»Da liegt die Jacht, und die Algen wachsen auf ihrem Kiel, während der feiste Dickwanst sich mit seinen Filmziegen abgibt!«, brummte Hosick mit einem Blick auf die buntscheckige Gesellschaft unter dem Sonnendach auf dem Deck der Jacht. »Ein richtiger schwimmender Harem ist das! Jawohl! Eine Schande, dass so etwas überhaupt erlaubt ist!«
Crammond lächelte.
»Vergessen Sie nicht, dass der Dickwanst, wie Sie ihn so freundlich titulieren, auch das Geld für unsere Expedition hergibt und dass wir ohne ihn gar nicht hier sein würden.«
»Das will ich ja gar nicht leugnen, Sir. Aber das, was er für uns ausgibt, ist doch gar nichts im Vergleich zu dem, was er für seine Weiber und das übrige verschwendet. Dass er Sie unterstützt, Sir, ist doch nur eine faule Ausrede dafür, dass er nichts tut und wie ein verdammter Sultan lebt – nur, dass er sich mehr Luxus leistet, als so ein Sultan je gehabt hat.«
»Ich glaube aus Ihrem Ton Neid herauszuhören, Hosick!«
»Ich auf ihn neidisch!« Hosick spuckte unwillig. »Nee, Sir, er ist der letzte, den ich beneiden würde. Ich habe meine Alte zu Hause, und sie ist weiß Gott mehr wert, als alle die angemalten, halbnackten Amüsierkäfer zusammen.« Er wies verächtlich mit dem Daumen auf die Jacht. »Von mir aus kann er die ruhig behalten und seinen eigenen Weg zur Hölle gehen.«
Das Motorboot wandte sich nach rechts, einem rohbehauenen, hölzernen Landungssteg auf der unbewohnten Seite der Bucht zu, der noch immer unter dem Namen Bootswerft bekannt war. Hier standen jenseits des Strandes in einer Lichtung, die aus dem Busch herausgehauen war, zwei zerlegbare Baracken, die das Laboratorium und die Wohnräume dessen darstellten, was offiziell unter dem Namen Mossbeck-Expedition für meeresbiologische Forschung bekannt war. Das Motorboot fuhr an den Landungssteg heran, und nun überließ Crammond Hosick der hoffnungslosen Aufgabe, einem höchst uninteressierten Joe etwas vom Standard der Reinlichkeit in der britischen Kriegsmarine beizubringen. Er selbst sprang an Land und ging mit seiner Taucherausrüstung zu den Baracken hinauf. Crammond war überrascht, hier seine Expeditionsmitglieder vollzählig versammelt zu sehen – Marilyn Turner, die auch in Hemd und kurzen Höschen reizend aussah – und die beiden jungen Männer – Alan Ferrier und Walter Harrison, beide Zoologen. Alle drei standen auf der Veranda und beobachteten sein Näherkommen. Da es nicht üblich war, sie zu dieser Tageszeit müßig vorzufinden, musste wohl etwas Außerordentliches vorgefallen sein.
»Hallo! Ihr seht ja wie eine Abordnung aus«, sagte Crammond und legte seine Taucherausrüstung nieder. »Was ist denn los? Seid ihr in Streik getreten?«
Die jungen Leute grinsten höflich und sahen einander an, wie wenn einer dem anderen das erste Wort überlassen wolle. Schließlich räusperte sich Alan Ferrier und sagte:
»Ich bin der Schuldige, Sir. Ich glaube, das beste ist, ich gestehe alles gleich«, sagte er. Er sah fast wie ein hübscher Schuljunge aus, der etwas ausgefressen hat und darum vor seinem Direktor steht. »Es – es hat Ungelegenheiten gegeben, und – nun, ich habe Mr. Mossbeck eine Ohrfeige heruntergehauen.«
»Eine Ohrfeige, wie?« Crammond zog sich auf das Geländer der Veranda hinauf, setzte sich oben hin und suchte in seinen kurzen Hosen nach seiner Pfeife. Leider erstreckten sich die Pflichten eines wissenschaftlichen Leiters der Expedition auch über den Bereich reiner Wissenschaft hinaus.
»Eigentlich war es ein Kinnhaken!«, unterstrich Walter Harrison mit innerer Befriedigung. »Ich hätte nie geglaubt, dass Alan so viel Kraft in einen Hieb hineinlegen kann. Ruckzuck in Mossbecks fette Schnauze! Wenn ich nur die Kamera bei der Hand gehabt hätte...«
»Es war ein lächerlicher Streit um nichts«, sagte Marilyn vermittelnd. Ihr hübsches, sonnverbranntes Gesicht wurde rot. »Als ob ich nicht durchaus imstande wäre, selbst für mich einzustehen!«
»Das war es also?« Crammond sah scharf von ihr zu ihm, als er sich seine Pfeife ansteckte.
»Entschuldigen Sie bitte mein Benehmen«, sagte Ferrier ohne merkbare Reue. »Aber er hat mich wirklich dazu gereizt! Als wir gerade anfingen, die Ausbeute des Nachmittags zu klassifizieren, kam er her und fing an, sich mächtig aufzuspielen. Er sagte uns, er wolle Resultate – schließlich bezahle er alles und habe ein Recht, für sein Geld auch etwas zu sehen. Das war schon schlimm genug. Aber dann fing er an, mit Marilyn handgreiflich zu werden, und als ich mir ansehen musste, dass er sie betätschelte...«
»Ich hatte schon die Nadel in Bereitschaft, wenn er sich über die äußerste Grenze hinauswagen sollte«, fiel ihm Marilyn ins Wort. »Ehrlich gesagt hoffte ich sogar darauf; es wäre mir ein reines Vergnügen gewesen, ihn durch sein Fettpolster zu stechen.«
»Aber konnte ich es nicht mehr ertragen«, fuhr Ferrier hartnäckig fort. »Ich schrie ihm zu, er solle sie in Ruhe lassen – aber daraufhin wendete er sich zu mir um, grinste mich an und sagte mir, ich solle mich fortscheren – nun, und da langte ich ihm eben eine.«
»So... Und was geschah dann?«, fragte Crammond trocken.
»Er klappte zusammen wie ein Taschenmesser.« Ferrier konnte seine Stimme nicht frei von innerer Genugtuung halten. »Aber er ist ja so gut gepolstert, dass ich ihm kaum wirklich weh getan habe. Er stand, purpurrot im Gesicht, wieder auf, aber er nahm sich in Acht, mich zu einem weiteren Schlag zu reizen. Er drohte mir nur beim Weggehen, er werde mich diesen Tag noch bedauern lassen. Ich werde teuer dafür zu zahlen haben, dass ich einen alten Mann wie ihn niedergeschlagen habe. Mir ist es gleich, was er tut. Der Hieb war es mir wert«, fügte er trotzig hinzu.
»Aber bevor er fortging, hatte er noch die Frechheit, mich für heute Abend zu sich auf die Jacht zum Abendbrot einzuladen«, sagte Marilyn empört. »Das muss man dem Kerl zugutehalten: Er weiß, was er will und lässt nicht so leicht locker.«
»Haben Sie die Einladung angenommen?«
Marilyn warf ihm einen zornigen Blick zu.
»So dumm bin ich doch nicht! Hier bei mir kann ich mit ihm fertigwerden. Aber es würde schon mehr als eine Nadel dazu gehören, ihn mir dort vom Leibe zu halten.«
»Ich weiß noch nicht einmal, ob dazu eine Harpune genügt«, grinste Harrison. »Aber jetzt, glaube ich, fängt das Theater erst richtig an!«, fügte er hinzu, als ein schnelles Motorboot von der Jacht über die Bucht gerauscht kam und am Anlegesteg festmachte. »Das sieht ja fast so aus, wie ein Befehl zur Audienz.«
»Glauben Sie, dass ich – dass ich unsere Expedition ruiniert habe?«, fragte Ferrier und versuchte, seine Stimme nicht ängstlich klingen zu lassen.
»Natürlich ist es peinlich.« Crammond runzelte die Stirn. »Waren bei dieser Szene Zeugen von seiner Seite zugegen?«
»Nein. Seine Bootsmannschaft war unten am Landungssteg.«
»Gut. Ihr seid zwei und könnt beide eure Version bestätigen. Mir scheint, er hat nur bekommen, was er verdient hat. Während ich offiziell den Zwischenfall natürlich bedauern muss, bin ich privat der Ansicht, dass er gar keinen Grund hat, sich zu beklagen.«
Die unsichere Spannung, die bei den jungen Leuten geherrscht hatte, verschwand.
»Ich freue mich über Ihr Urteil, Sir«, brach Ferrier aus und nahm von Harrison eine Zigarette. »Es tut mir furchtbar leid, aber ich hoffe, dass ich Ihre Lage nicht allzu unangenehm gemacht habe.«
»Ich kann auch unangenehm werden.« Crammond wandte sich dem Mann zu, der von dem Motorboot zur Veranda gekommen war. »Ja?«
»Der Chef mochte Sie sehen. Sofort«, sagte der Mann.
Crammonds Kinnmuskeln wurden hart, aber er blieb an das Geländer der Veranda gelehnt und zog ruhig an seiner Pfeife.
»Schön. Ich komme in ein paar Minuten hinüber.«
»Aber der Chef wartet...« Der Seemann hatte offenbar einen festen Auftrag.
»Dann soll er noch einen Cocktail trinken.« Crammond ging vom Geländer fort und klopfte sorgfältig seine Pfeife aus. »Ich muss mich erst duschen, um das Salz von der Haut herunterzuspülen.«
Er schlenderte zu der anderen Baracke hinüber, in der die Expeditionsteilnehmer schliefen. Während er sich duschte, dachte er grimmig über die Vor- und Nachteile des Mäzenatentums nach. Er hatte natürlich die Gelegenheit eifrigst ergriffen, auf Kosten des Millionärs Mossbeck eine wissenschaftliche Expedition zu organisieren, die die neuen, von einer Schlauchleitung unabhängigen Taucherausrüstungen für meeresbiologische Forschung erproben sollte. Es war wirklich etwas Herrliches, sich das beste Material anschaffen zu können, ohne sich der Ausgaben wegen Sorgen machen zu müssen. Unterwasserkamera, Unterwassertaschenlampen und die anderen Apparate neben der Aqualungen-Tauchausrüstung wurden, genau seinen Wünschen entsprechend, ohne jedes Feilschen gekauft. Daneben bedeutete auch die Möglichkeit, von einem Fahrzeug wie der Fünfhundert-Tonnen-Jacht Lucilla aus zu arbeiten, noch zusätzlich Komfort und Bequemlichkeit; es blieb ihm also kaum noch etwas zu wünschen übrig.
Aber der Haken der Sache wurde bald offenbar. Die Bemerkungen von Hosick über die Jacht waren nicht allzu krass übertrieben. Mossbeck war ein Genussmensch der gröberen Art, und die gemischte Gesellschaft, die er auf seiner Jacht an Bord hatte, war wissenschaftlicher Forschung nicht gerade förderlich. Ja, noch mehr, alle diese Leute hatte schließlich die Leidenschaft für Unterwasserjagd mit dem Harpunengewehr erfasst, und ihre ungeschickten Versuche auf diesem Gebiet genügten völlig, alle Möglichkeiten für ernsthafte Arbeit in der Bucht zu vernichten. Dies hatte zu einer ernsten Auseinandersetzung Crammonds mit Mossbeck geführt. Er hatte sich, schließlich mit seinen Mitarbeitern von Mossbeck getrennt und hatte seine Expedition an Land in den vorfabrizierten Baracken untergebracht, die glücklicherweise als Teil der Ausrüstung angeschafft und mitgeführt worden waren.
»Hoffentlich wird der Krach nicht zu schlimm, Doktor«, sagte Walter Harrison, der ihm wie durch Zufall begegnete. »Möchten Sie, dass wir mitkommen?«
»Nein, danke, Walter. Aber wenn es nicht zum Gewitter kommt, dann wird es nicht meine Schuld sein!«, versprach Crammond grimmig. »Ich wäre ganz froh, wenn jetzt die endgültige Auseinandersetzung stattfindet.«
Der kräftig gebaute junge Zoologe sah dem Motorboot, das, ganz glänzender Lack und Chrom, von der Anlegestelle fortsurrte, nachdenklich nach. Dann wandte er sich an Alan Ferrier, der sich ihm zugesellt hatte.
»Ich muss schon sagen, unser Doktor ist ganz hübsch in Fahrt!«, meinte er. »Ihr Engländer seid doch wirklich erstaunliche Menschen! Meistens seid ihr bequem und nachgiebig, als ob ihr gar kein Blut in den Adern hättet. Aber wenn ihr einmal loslegt, dann wehe! Ich setze auf den Doktor. Er ist nicht der Mann, der sich von Mossbeck herumkommandieren lässt.«
»Ich wünschte nur, ich hätte das Schwein noch härter getroffen!«, brummte Ferrier.
»Sie hätten ihn umbringen können. Und dann hätten wir wirklich in der Tinte gesessen«, meinte Harrison. »Sie haben einen Schlag gegen das Großkapital geführt, und das ist schon schlimm genug.«
Inzwischen näherte sich Crammond in dem Motorboot der Lucilla. Die Sonne war untergegangen, und nur ihr Nachleuchten rötete die erstaunlich hohen Wolken im Westen. Sie ließ das leicht bewegte Wasser in goldigen, grünen und orangefarbenen Tinten aufblitzen. In diesem warmen Licht sah die Jacht gegen den Hintergrund der alten Stadt, in der schon die ersten Lichter erschienen, wirklich traumhaft schön aus. Aber diese Schönheit wurde von dem Radio beeinträchtigt, das auf dem Hinterdeck, auf dem eine Anzahl Mossbeckʼscher Gäste mit Cocktails in Liegestühlen lagen, plärrende Musik von sich gab. Es waren ein Filmstar in einem exotischen Abendkleid, zwei Mädchen, noch in Badeanzügen, und zwei junge Männer, die zu sehr nach Modejournal aussahen, um angenehm zu wirken.
Als das Motorboot an der Schiffstreppe anlegte, hörte man oben Tuscheln und leise Bemerkungen. Crammond ließ seinen Blick mit kühler Gelassenheit über die Gesellschaft gleiten, bevor er die Treppe hinauf auf Deck stieg, wo ihn ein Schiffsoffizier erwartete, um ihn in das Büro der Sekretärin am hinteren Ende des Decks zu führen. Offenbar mussten alle Förmlichkeiten gewahrt werden, bevor er zur Audienz vorgelassen werden konnte.
Delia Williams, Mossbecks Privatsekretärin, sah von ihrer Schreibmaschine auf, als Crammond bei ihr eintrat. Groß, untadelig angezogen und jeder Zoll die fähige, stets beschäftigte Sekretärin, mochte man sie für dreißig halten. Wahrscheinlich war sie aber etwas älter. Allerdings wurde der angenehme Eindruck ihrer gepflegten Persönlichkeit durch ihren Mund wieder zerstört, dessen Verkniffenheit auch der geschickt verwendete Lippenstift nicht verheimlichen konnte.
»Ich bin froh, dass Sie hier sind, Dr. Crammond«, sagte sie erleichtert. »Mr. Mossbeck hat schon die ganze letzte halbe Stunde ununterbrochen nach Ihnen gefragt.«
»Gut. Ich möchte ihn auch gern sprechen«, verkündete Crammond vergnügt.
Sie warf ihm einen fragenden Blick zu, ehe sie ihn telefonisch anmeldete.
»Er sagt, dass er Sie erwartet. Soll ich Sie hinüberbringen?«
»Nein, nicht nötig. Ich kenne den Weg ja.« Er dankte ihr und schlenderte über das Deck, die Kabinentreppe hinunter in den Salon und dann einen Gang entlang. Dabei kam er an einem Mädchen in einem unglaublich tief ausgeschnittenen Abendkleid vorüber. Sie wandte sich um und zeigte ihm provokativ die Schulter. Aber ohne sich aufzuhalten, klopfte er an Mossbecks Tür und drehte auf einen Ruf von innen den Türknopf.
Die Tageskabine des Herrn der Jacht war ein großer, elegant möblierter Salon, der sich quer durch die ganze Breite des Schiffs erstreckte. Mossbeck stand an der Hausbar und mixte sich einen Cocktail. Als er sich zu ihm umwandte, war sein fleischiges Gesicht hässlich verzerrt.
»Was, zum Teufel, hat Sie denn so lange aufgehalten?«, fragte er Crammond.
»Die Bürokratie Ihrer Organisation«, sagte der Biologe ruhig und schloss die Tür hinter sich. »In der Tat hätte ich Sie sowieso aufgesucht. Denn ich möchte wissen, was es heißen soll, dass Sie meine Mitarbeiter belästigen?«
Mossbeck verschüttete etwas von seinem Cocktail. Sein hartes Kinn, begraben in Fettpolstern, schob sich kampflustig nach vorn.
»Belästigen! Was wollen Sie damit sagen?« Er hielt sein Glas in die Höhe. »Hören Sie mir einmal zu, Crammond. Ich habe heute schon so viel durchgemacht, dass es mir wirklich für einen Tag langt. In der Tonart können Sie nicht mit mir reden. Ich ging heute Nachmittag an Land, um zu sehen, welche Fortschritte Sie mit Ihren wissenschaftlichen Arbeiten machen. Dabei wurde ich von diesem jungen Rowdy, dem Ferrier, angefallen.«
»Sie haben das herausgefordert.«
»So stellt er es natürlich dar. Aber was geht es ihn an, wenn ich ein hübsches Mädchen ein bisschen tätschele – oder glauben Sie vielleicht, dass Ihre Wissenschaftler ein Monopol auf sie haben?« Er grinste hämisch. »Ist das vielleicht der Grund, der Sie plötzlich zu der Behauptung veranlasste, dass Sie an Bord meiner Jacht nicht arbeiten können? War es das, was Sie veranlasste, sich an Land häuslich einzurichten? Ach so – ein Kollektivliebesnest unter den Palmen! Jetzt verstehe ich!«
»Und ich kann jetzt verstehen, warum der junge Ferrier Ihnen eine gelangt hat.«
»Na, das ist ja schön.« Mossbeck goss die Reste seines Cocktails hinunter. »Nun, nehmen Sie mir die Bemerkung nicht so krumm, Crammond. Eigentlich wollte ich Ihnen ja gar nicht so etwas sagen. Aber Sie müssen doch schließlich auch an meine Gefühle denken. Ich will Ihnen keinen Vorwurf machen. Ich weiß, Sie können manches, was ich nicht kann, und darum finanziere ich auch Ihre Arbeit. Aber wenn mich jemand ins Gesicht schlägt, so stecke ich das nicht ruhig ein und sage womöglich noch danke schön. Mit Ferrier ist Schluss! Er ist entlassen! Er soll seine Sachen packen und noch heute Nacht abziehen. Ich bin bereit, ihm das Geld für ein Flugbillett nach England zu bezahlen – oder wohin er sonst will. Aber fort muss er!«
»Bedaure«, sagte Crammond entschlossen. Seine grauen Augen waren hart wie Granit. »Ferrier bleibt hier bei meinem Stab. Und darüber hinaus, Mossbeck, muss ich von Ihnen verlangen, dass Sie sich bei Marilyn entschuldigen und ihr die Versicherung geben, dass Sie sie in Zukunft in Ruhe lassen werden.«
Mossbecks dicke Lippen öffneten und schlossen sich, wie die eines Fisches, der nach Luft schnappt. Einen Augenblick herrschte im Salon gespanntes Schweigen. Man hörte nur das ferne Surren der Schiffsdynamos und das leise Zirpen der Klimaanlage. Dann wandte sich Mossbeck zu der Hausbar und sagte unerwarteterweise: »Trinken Sie etwas, Crammond! Whiskey?«
»Nein, danke schön. Nichts.«
Der Millionär mixte sich einen steifen Whiskey, und als er sich wieder umwandte, unterstrich er seine Worte mit seinem Glas, das er gegen Crammonds Brust hielt.
»Nun passen Sie einmal auf, Crammond. Ich will es wirklich nicht zwischen uns zum Kampf kommen lassen. Aber, verdammt nochmal, ich kann mich doch nicht von irgendeinem kleinen Pinscher, der auf meiner Lohnliste steht, schlagen lassen und mir zum Schluss noch anhören, dass ich mich entschuldigen und ihm die andere Backe hinhalten soll. Für was halten Sie mich eigentlich?«
»Die Beleidigungen sind doch von Ihnen ausgegangen!«
»Das ist doch schließlich mein Recht!«, schrie Mossbeck. »Ich zahle doch für diese gottverdammte Expedition! Sie leben im Grunde genommen von meiner Freigebigkeit! Ebenso wie Ihr Land – wie Europa – wie die halbe Welt auf dieser Seite des Eisernen Vorhangs!« Der Einfall begeisterte ihn so, dass er mit den Armen in der Luft herumfuchtelte. »Alle lebt ihr von Onkel Sam, dem guten Narren, der jedem Geld gibt, der ihm die Stiefel leckt und schön bitte-bitte macht! Ihr seid alle verdammte Schmarotzer, und daher habt ihr kein Recht, euch so aufzublasen!«
»Ich habe Sie nicht darum gebeten, mir gegenüber den Mäzen zu spielen«, erwiderte Crammond, dem die Galle hochkam. »Wenn ich gewusst hätte, wie das aussehen würde, hätte ich niemals angenommen. Ich glaubte, Sie sind wirklich an der Wissenschaft, die ja international ist, interessiert und nahm nicht an, dass Sie nur Ihrer Eitelkeit frönen wollen.«
»So lasse ich nicht mit mir reden!« Mossbeck schüttelte seine Faust vor Crammonds Gesicht, und sein fetter, verweichlichter Körper zitterte vor Wut. »Ich und eitel...«
»Natürlich! Die Art, wie Sie die Schmeicheleien von Ihren Speichelleckern und Parasiten schlucken, die Sie hier auf dem Schiff haben, ist ja ekelhaft! Sehen Sie denn nicht, dass diese Leute Sie nur ausbeuten?«
»Sie halten mich also für einen dummen Tölpel?«
»Wenn Ihnen diese Leute Spaß machen, ist das schließlich Ihre Sache. Aber es ist einfach unmöglich, ernsthafte Forschungsarbeit in diesem Irrenhaus zu betreiben. Wenn es Ihnen Spaß macht, einen römischen Cäsar im Taschenformat zu spielen –«
»Jetzt beschimpfen Sie mich auch noch! Ich werde Sie wegen böswilliger Verleumdung verklagen!«
»...so machen Sie nur so weiter«, schloss Crammond. »Aber über einen Punkt müssen Sie sich klar sein: Wenn Sie sich wegen Ihres Benehmens heute Nachmittag und heute Abend nicht entschuldigen – dann ist die Mossbeck-Expedition für Meeresforschung beendet, und ich führe die Forschungen unabhängig von Ihnen weiter.«
Mossbeck atmete schwer. Schweißtropfen traten auf sein Gesicht; auf dem seidenen Hemd, das an seinem Körper klebte, zeigten sich dunkle, feuchte Flecken.
»Das können Sie nicht!«, schrie er. »Das ist Vertragsbruch! Ich werde Sie verklagen...«
»Das würde jedenfalls einige sensationelle Schlagzeilen abgeben. Millionenschwerer Müßiggänger verklagt Wissenschaftler, den er finanziert hat! Dabei würde noch hübsch ausführlich geschildert werden, was hier so vor sich geht, und Sie können sich ja ausmalen, was das für ein Fressen für eine gewisse Presse gäbe. Oh, nein, Mossbeck! Ich halte Sie doch für zu klug, um es Ihnen zuzutrauen, mich zu verklagen. Mir persönlich ist das übrigens ganz egal. Erhalte ich nun von Ihnen eine Entschuldigung oder nicht?«
»Ach, scheren Sie sich zum Teufel!«