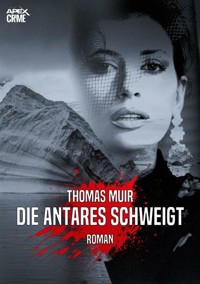6,99 €
Mehr erfahren.
Bei der Havarie des Dampfers Pampas auf dem Amazonas scheint nicht alles mit rechten Dingen zugegangen zu sein. Dennoch wird Brian Stenton das Kapitänspatent entzogen.
Eine Londoner Tageszeitung beginnt sich für den Fall zu interessieren. Schon nach dem ersten Gespräch mit Kapitän Stenton wird der Reporter Jerry Henshaw von Unbekannten niedergeschlagen und entführt.
Die Spur führt von London in den Dschungel Brasiliens. Im Mittelpunkt: Eine schöne, gefährliche Frau...
Der Roman Der tanzende Tod des schottischen Schriftstellers und Journalisten Thomas Muir (* 02. Januar 1918; † 8. Oktober 1982) erschien erstmals im Jahr 1952; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1960.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Thomas Muir
Der tanzende Tod
Roman
Apex Crime, Band 160
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DER TANZENDE TOD
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Das Buch
Bei der Havarie des Dampfers Pampas auf dem Amazonas scheint nicht alles mit rechten Dingen zugegangen zu sein. Dennoch wird Brian Stenton das Kapitänspatent entzogen.
Eine Londoner Tageszeitung beginnt sich für den Fall zu interessieren. Schon nach dem ersten Gespräch mit Kapitän Stenton wird der Reporter Jerry Henshaw von Unbekannten niedergeschlagen und entführt.
Die Spur führt von London in den Dschungel Brasiliens. Im Mittelpunkt: Eine schöne, gefährliche Frau...
Der Roman Der tanzende Tod des schottischen Schriftstellers und Journalisten Thomas Muir (* 02. Januar 1918; † 8. Oktober 1982) erschien erstmals im Jahr 1952; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1960.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
DER TANZENDE TOD
Erstes Kapitel
Vor dem Spiegel des Ankleideraumes glättete Doris Shanklin noch einmal den Badeanzug. Was sie im Spiegel sah, befriedigte sie einigermaßen und steigerte ihr an sich schon stark ausgeprägtes Selbstvertrauen noch mehr. Aus verschiedenen Gründen hatte sie an dem Schönheitswettbewerb in Southpool teilgenommen. Erstens glaubte sie fest an ihre große Chance, als Siegerin aus dem Wettbewerb hervorzugehen, und zweitens winkten der Siegerin allerlei Abenteuer in Form von Filmverträgen und ähnlichen erregenden Möglichkeiten. Erregend jedenfalls für eine nicht gerade hervorragende Stenotypistin in einem kleinen Maklerbüro.
Doris betrachtete ihre Reize mit Losgelöstheit und Selbstbeherrschung. Sie trug diese vor allem der anderen Bewerberinnen wegen zur Schau, die alle wie sie darauf warteten, vor den Schiedsrichtern zu erscheinen. In dem Buch Persönlichkeiten und ihre Entwicklung hatte Doris gelesen, wie man jene erfolgreiche innere und äußere Haltung gewinnt, die bei anderen einen Minderwertigkeitskomplex auslöst. Und dieser Haltung legte sie ganz besonderen Wert bei.
Natürlich konnte sie auf allerlei stolz sein. Sie hatte eine auffallend gute Figur, deren Rundungen sich in richtigem Maß an den richtigen Stellen befanden. Ihr Gesicht war eher hübsch als schön, und die Unschuld ihrer großen blauen Augen wurde durch ein kleines, festes, gut geformtes Kinn ausgeglichen. Ihre Haut war zart und weiß, sie hatte keine Sommersprossen wie die meisten rothaarigen Frauen. Ihrer Meinung nach konnten es ihre Beine mit denen Betty Grables in jeder Hinsicht aufnehmen. Immer schon hatte sie es bedauert, so wenig Gelegenheit zu haben, diese Tatsache beweisen zu können.
Jedenfalls bemühte Doris sich, ihre Beine heute ganz besonders zur Geltung zu bringen. Die Parade um das Schwimmbassin war bereits erledigt, und jetzt sollten die Bewerberinnen einzeln vor den Richtern erscheinen. Manche Mädchen waren nervös. Sie kicherten, sprachen laut und sahen, je nach ihrem Temperament, aufgeregt oder besorgt um sich. Auch Doris fühlte sich nicht gerade behaglich. Sie hatte Herzklopfen, aber um nichts in der Welt hätte sie ihre Erregung verraten.
»Nummer neun! Los! Beeilen Sie sich! Lassen Sie die Herren nicht warten!«
Ein junger Mann in gelbem Hemd und gestreiftem Flanellanzug erschien in der Tür, und Doris nahm in aller Ruhe das Pappschild mit der Ziffer 9 in die Hand. Sie warf noch einen letzten Blick in den Spiegel und folgte, äußerlich ganz ruhig, dem jungen Mann hinaus auf den Laufsteg.
Die Bänke um das Schwimmbecken waren dicht besetzt, und Doris sah sich einem Meer von Gesichtern gegenüber, die sie gespannt und aufmerksam betrachteten. Sie kannte diese Gesichter schon von der Parade her, aber damals waren noch zwanzig andere Mädchen bei ihr. Jetzt aber kam sie sich sehr einsam vor als Zielscheibe aller neugierigen Blicke.
Leichter Beifall erscholl. Aber sie wusste, dass ihre Vorgängerinnen in der gleichen Weise empfangen worden waren, so dass das weiter nichts bedeutete. Die Blicke der Zuschauer kühl erwidernd, dachte sie, wieviel Kenner wohl in der Menge saßen. Ein Herr mit einem großen Fernglas nahm sie ganz besonders aufs Korn. Warum nicht? Sie konnte ihm schon etwas bieten. Sie hatte auf einmal das Gefühl, als verlöre sie ihre Persönlichkeit. Ja, das war der einzig richtige Ausdruck. Für alle diese Menschen war sie nicht Doris Shanklin, sondern nur Nummer 9 in einem Schönheitswettbewerb. Ein Etwas, das im Badeanzug ganz verlockend aussah.
Vorn saßen die Richter: ein Filmstar vierter Größe, ein Schauspieler, der in den zwanziger Jahren ein Idol gewesen war, und andere, weniger bekannte Persönlichkeiten. Was schrieben sie wohl auf die Punktkarte? Sie kam sich vor wie ein Pferd auf einer Pferdeschau. Am liebsten hätte sie laut gelacht.
Die Stimme des jungen Mannes im gelben Hemd brachte sie wieder zu sich. Gehorsam tat sie alles, was ihr vorher gesagt worden war. Es war ihr Augenblick! Sie stand auf der Bühne. Aller Augen waren auf sie gerichtet. Sie war die einzig wichtige Person in der Menge. Ein leichtes Beben, und ihre Phantasie begann wild zu arbeiten. Sie spielte eine Rolle, sie packte die Zuschauer, verzauberte sie, und dieses Gefühl beherrschte sie so sehr, dass ihre Befangenheit wich, und sie glaubte, ihr Bestes herzugeben, während sie leicht über den Laufsteg schritt.
Bald war es vorbei, und der junge Mann im gelben Hemd gab
ihr zu verstehen, sie möge sich wieder in den Ankleideraum begeben. War der Beifall wirklich lauter gewesen als der, mit dem die Bewerberinnen vor ihr bedacht worden waren? Mit dem Beifall in den Ohren gesellte sie sich den anderen wieder zu, während Nummer 10, ein dunkelhaariges, empfindsames Mädchen, auf gerufen wurde, sich der gaffenden Menge zu stellen.
»Es ist wirklich nichts dabei«, beruhigte Doris etwas von oben herab die blonde Nummer 11, die großes Lampenfieber zu haben schien. »Du gehst einfach über den Steg, wie es verlangt wird, und kümmerst dich dabei um keinen Menschen. Mir hat’s Spaß gemacht.«
»Wenn ich das doch auch schon sagen könnte«, erwiderte Nummer 11.
Doris wartete voller Ungeduld, während die anderen Mädchen eine nach der anderen aufgerufen wurden. Als das letzte Mädchen im Ankleideraum erschien, geschah eine Zeitlang nichts, bis dann endlich, lebhaft und sprühend, wie immer, der junge Mann im gelben Hemd erschien.
»Los! Kommt mit! Das Urteil wird verkündet«, rief er. »Wer gewonnen hat, weiß ich nicht, und wenn ich’s wüsste, dürfte ich es nicht verraten.« Er strahlte die Mädchen an, als fände er sie alle gleich reizend. »Bitte hierher! Lächeln und Haltung nicht vergessen! Wer nicht gewonnen hat, soll die Ohren nicht hängen lassen, sondern sich sagen, für einen in der Menge war ich sicher die Schönste!«
Wieder trabten sie hinaus in die Sonne und stellten sich auf, während die Richter noch immer berieten. Dann winkten sie den jungen Mann herbei, und man überreichte ihm eine Liste. Er lächelte die wartenden Mädchen mit blitzenden Zähnen an, ging an das Mikrofon, und bald hallte seine Stimme aus den Lautsprechern:
»Meine Damen und Herren, die Richter haben es bei der Urteilsfindung nicht leicht gehabt, und dennoch wird zweifellos mancher glauben, er würde es besser gemacht haben als sie.« Pause für Gelächter. »Jede der Damen hat den Preis verdient, aber eine kann ja nur Siegerin sein, so schwer diese Erkenntnis für die Nichtsiegerinnen auch sein mag. Und nun hören Sie den Spruch der Jury: Nummer neun hat gewonnen! Siegerin in dem Schönheitswettbewerb von Southpool ist Miss Doris Shanklin.«
Lang dauernder Applaus, während sich der Mann im gelben Hemd umdrehte und die Hand ausstreckte.
»Kommen Sie rauf, Doris! Verbeugen Sie sich! Vielleicht erzählen Sie den Herrschaften, wie Ihnen als Siegerin zumute ist. Nur keine Angst, wir alle stehen auf Ihrer Seite!«
In ihrer übergroßen Freude war Doris voller Zuversicht. Sie trat vor und fühlte, wie sie verlegen wurde. Statt des Lächelns und der beherrschten Sätze, die sie sich schon so oft zurechtgelegt hatte, stammelte sie ein paar unzusammenhängende Worte, während Fotoapparate und Kinokameras in ihrer unmittelbaren Nähe klickten und surrten. Die Menge schien sehr zufrieden, und Doris hatte das Gefühl, trotz allem einen Sieg davongetragen zu haben. Dann wurde ihr das blaue Band der Siegerin überreicht. Der Filmstar vierter Größe beglückwünschte sie und gab ihr einen Kuss. Der Kuss des einstigen Idols schmeckte nach Whisky, und der des Bürgermeisters war väterlich. Dann wurden ihr die Preise ausgehändigt: zehn Pfund in bar, ein kleiner Pokal mit Inschrift, ein Bon für einen zehntägigen Aufenthalt in London. Nach einer nochmaligen Parade um das Schwimmbecken, nach nochmaligen Aufnahmen war alles vorbei. Voller Freude und von ihrem Erfolg leicht berauscht, ging sie in den Ankleideraum und zog sich an. Alles war gut verlaufen. Es blieb jetzt abzuwarten, was sich weiter ereignen würde.
Als sie den Ankleideraum verließ, warteten die Pressefotografen wieder auf sie. Aber Doris war nun schon daran gewöhnt, die funkelnden Linsen der Kameras auf sich gerichtet zu sehen. Sie lächelte anmutig, entschlossen, die kurze Zeit ihrer Berühmtheit zu genießen. Dann bemerkte sie im Hintergrund einen Mann; er wollte sie anscheinend sprechen. Jetzt bahnte er sich mit den Ellbogen einen Weg durch die Menge. Er war trotz seiner Körperfülle sehr geschmeidig und hatte trotz seiner Jugend einen kahlen Kopf. Er sah aus, als wäre er in flüssigem Zustand in seinen tadellos sitzenden gestreiften Zweireiher gegossen worden.
»Mercer ist mein Name«, stellte er sich vor. Er lächelte und zeigte dabei sein tadelloses Gebiss. »Herzlichen Glückwunsch! Ich hatte von vornherein auf Sie gesetzt. Den anderen meilenweit überlegen. Fraglos eine Persönlichkeit!«
Doris errötete vor Erregung, aber sie verlor dennoch nicht den Boden unter den Füßen. Forschend betrachtete sie den dicken Mr. Mercer. War er Opportunist oder wirklich Kenner? Er sah aus, als wäre er aus der Filmbranche. Aber lieber Vorsicht!
»Vielen Dank. Das ist sehr nett von Ihnen«, sagte sie bedächtig.
»Nett ist nicht das richtige Wort. Es ist einfach Tatsache. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen, der Sie vielleicht interessiert.«
»Ist das nicht ein wenig voreilig?«, erwiderte sie spöttisch.
»Was ich Ihnen sagen möchte, ist durchaus ehrlich gemeint.« Er hob seine weiße, dicke Hand und schien über Doris’ Worte bekümmert.
»Hier können wir nicht gut sprechen. Mein Wagen steht draußen. Wir wollen irgendwo Tee trinken. Eine Tasse Tee tut Ihnen nach all der Aufregung bestimmt gut.«
Doris nahm die Einladung an. Der große Wagen, in dem er sie zum besten Hotel in Southpool fuhr, ließ vermuten, dass Mr. Mercer ein reicher Mann war. Und dass er mit dem gestrengen Oberkellner im Hotel auf du und du stand, machte auf Doris einen besonders tiefen Eindruck.
Während der Fahrt hatte er mühelos in Erfahrung gebracht, dass sie in einem Maklerbüro arbeitete, dass ihre vierzehntägigen Ferien, die sie zusammen mit einer Freundin verbrachte, zu Ende waren, dass sie augenblicklich keinen Freund hatte, dass ihr Vater im letzten Kriege gefallen und ihre Mutter vor zwei Jahren gestorben war. Sie fanden einen Tisch im Palmenhof, und Mr. Mercer bestellte Tee. Dann stützte er die Ellbogen auf den Tisch, streichelte sein dickes Doppelkinn und betrachtete Doris nachdenklich.
»Bei Ihrem Aussehen brauchten Sie sich wahrhaftig nicht in einem Maklerbüro abzurackern«, sagte er.
»Meinen Sie?« Da Doris der gleichen Meinung war, konnte sie nur auf diese Weise zustimmen. Es stand für sie fest, dass, wenn Mercer für sie nicht einen Filmvertrag in der Tasche hatte, sie mindestens damit rechnen konnte, von ihm aufgefordert zu werden, Probeaufnahmen machen zu lassen. Das alles hatte sie sich schon mehr als einmal ausgemalt, aber sie wollte nicht so ohne weiteres zugreifen wie ein unerfahrenes Schulmädchen, sondern alles ruhig an sich herankommen lassen. Kühle Zurückhaltung und ein etwas spöttisches Lächeln zeigte sie jetzt.
»Worauf wollen Sie hinaus? Vermutlich haben Sie gar nicht ernstlich die Absicht, mich aus meiner Tretmühle herauszuholen.«
Mercer schüttelte den Kopf und seufzte. Seine dunklen Augen ließen ihr Gesicht nicht los.
»Sie verstehen mich vollkommen falsch«, sagte er bekümmert. »Vielleicht glauben Sie, ich wollte mein Glück bei Ihnen versuchen.«
»Was haben Sie also vor?«
»Ich mache Ihnen ein durchaus ehrliches Angebot. Sie können es annehmen oder ablehnen. Aber hoffentlich nehmen Sie es an, etwas Derartiges wird Ihnen so leicht nicht wieder geboten.«
»So?« Doris nippte an ihrem Tee. Sie konnte ihre Erregung kaum verbergen. Mercer beugte sich vor und stieß dabei mit seinem dicken Bauch gegen den Tischrand.
»Wie gefiele Ihnen eine Arbeit, bei der Sie wie eine große Dame leben könnten? Reisen nach Nord- und Südamerika. Verkehr in der allerbesten Gesellschaft von New York, Rio, Buenos Aires - und dazu noch eine anständige Bezahlung?«
»Und der Haken?«
»Die Sache hat keinen Haken.« Mercer legte die Fingerspitzen leicht gegeneinander. »Sie sollen die Gesellschafterin einer Dame werden - keiner alten Witwe«, fuhr er schnell fort, als er Doris’ erschrecktes Gesicht sah, »sondern bei einer jungen - etwa dreißigjährigen Frau, die sehr gut aussieht und sehr reich ist. Sie heißt Natalie Manning und ist mehrere Millionen Pfund schwer - Pfund und nicht Dollar!«
Doris’ Luftschlösser brachen zusammen. Sie hatte von Filmverträgen geträumt, und man bot ihr eine Stellung als Gesellschafterin an. Aber irgendwie schien ihr dieses Angebot doch außergewöhnlich. Eine Millionärin - das wollte heutzutage schon allerhand heißen. Reisen nach den Vereinigten Staaten und Südamerika! Wieder begann ihre Phantasie zu arbeiten.
»Nun?« Mercer schob ein Stück Kuchen in den Mund, ohne sie dabei aus den Augen zu lassen.
»Ich weiß nicht recht.« Nach kurzem Schweigen fragte sie sehr klug: »Weshalb will diese Mrs. Manning absolut die Siegerin in einem Schönheitswettbewerb als Gesellschafterin haben? Meiner Meinung nach gehört zu einer solchen Stellung doch bedeutend mehr.«
»Ganz recht«, nickte Mercer. Er legte das Stück Kuchen auf den Teller und stäubte sich die Hand ab. »Mrs. Manning hat eine große Schwäche für alles Schöne, und nach dem, was sich auf ihre Zeitungsannonce hin bei ihr vorstellte, kam ihr der Gedanke, es mit der Siegerin in einem Schönheitswettbewerb zu versuchen. Vielleicht, so dachte sie, fände sie auf diese Weise die Richtige.«
»Ein sonderbarer Gedanke.«
»Mrs. Manning kann sich solche Gedanken leisten. Sie hat mich damit beauftragt, die geeignete Kandidatin zu finden, und ich glaube sie in Ihnen gefunden zu haben. Die letzte Entscheidung liegt natürlich ganz bei Ihnen und Mrs. Manning.«
»Ein sehr ungewöhnliches Angebot«, erwiderte Doris langsam und nachdenklich.
»Jedenfalls bietet sich Ihnen eine große Chance. Ich verlange nicht, dass Sie sich sofort entscheiden.« Mercer spreizte die Finger. »Natürlich müssen Sie sich das Angebot genau überlegen, es vielleicht mit diesem oder jenem besprechen. Vielleicht wollen Sie auch Genaueres wissen. Überschlafen Sie die Sache erst mal, und morgen treffen wir uns dann hier gegen elf Uhr wieder. Sollten Sie Interesse an meinem Angebot haben, dann erledige ich alles Notwendige für eine Reise nach London zu Mrs. Manning. Die Kosten trage natürlich ich, und sollte dieser Besuch zu beiderseitiger Zufriedenheit ausfallen, dann wäre alles gleich in Ordnung. Ich meine, Sie sollten die sich Ihnen bietende Chance wahrnehmen.«
Doris erwiderte, sein Angebot erschiene ihr durchaus annehmbar, aber sie hütete sich wohl, Mercer zu zeigen, wie sehr es sie reizte. Schnell hatte sie ihre anfängliche Enttäuschung überwunden und redete sich schon ein, Mercers Vorschlag böte doch allerlei Möglichkeiten. Wieder arbeitete ihre Phantasie, wenn auch diesmal in anderer Richtung. Als Gesellschafterin einer Millionärin durch die Welt zu reisen, da konnte man die herrlichsten Abenteuer erleben.
»Hat Mrs. Manning noch ihren Mann?«, fragte sie Mercer, als sie das Foyer verließen.
»Soviel ich weiß, ist Mr. Manning tot.«
Doris fand diese Antwort irgendwie seltsam. Sie sah Mercer einen Augenblick lang forschend an.
»Sonst noch eine Frage?«, sagte er.
»Noch eins«, erwiderte Doris besonders freundlich, »gehören Sie auch zu den schönen Dingen, mit denen Mrs. Manning sich umgibt?«
Mercers glattes Gesicht verzog sich, und er lächelte etwas gezwungen vor sich hin.
»Das vergesse ich Ihnen so leicht nicht«, sagte er und reichte ihr dabei die Hand. »Ich glaube, sie behält mich nur des Kontrastes wegen. Ich bin ihr Privatsekretär und habe allerlei seltsame Aufträge wie zum Beispiel diesen für sie zu erledigen. Also auf Wiedersehen, Miss Southpool. Hoffentlich erhalte ich morgen von Ihnen eine Zusage.«
Sie hätte ihm diese Zusage schon jetzt geben können, aber sie hatte, wie sie an diesem Abend zu ihrer Freundin Helen Weekes sagte, das Gefühl, dass sie an einem Kreuzweg in ihrem Leben stand und genau überlegen müsste, welchen Weg sie wählen sollte.
»Ich glaube schon, dass sich mir eine ganz besondere Gelegenheit bietet«, fuhr sie fort, als sie über die breite Promenade gingen. »Ich habe wirklich keine Lust, mein Leben lang fehlerhafte Briefe für Gilby und Stevens über verkäufliche Häuser und Grundstücke zu schreiben und nur mit den Leuten aus dem Tennisklub zu verkehren. Es ist hier ja alles so öde und langweilig.«
»Glaube nicht, dass ich dir die Sache verleiden will«, sagte die dunkelhaarige, ernste Helen. »Auf den ersten Blick sieht das Angebot wunderbar aus, so wunderbar, dass ich immer wieder meine, es müsste einen Haken haben. An deiner Stelle würde ich mich ganz genau erkundigen.«
»Das tue ich bestimmt. Ich lasse mir so leicht nichts vormachen. Erst wenn ich alles genau weiß, unterschreibe ich den Vertrag.«
Sie sah die Freundin fast hilfesuchend an. »Was meinst du, Helen, soll ich zugreifen oder nicht?«
»Natürlich sollst du zugreifen. Und ich beneide dich sogar darum, dass du von hier fortkommst.« Helen seufzte, denn sie musste für eine kranke Mutter sorgen. »Du brauchst für niemand zu sorgen... Ich glaube, du solltest zugreifen.«
»Gut. Ich tu’s.« Doris drückte Helen dankbar den Arm. »Ich fahre also zu der Besprechung nach London, und hoffentlich kann ich bald bei Gilby und Stevens kündigen. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten.«
Die unmittelbare Folge ihres Entschlusses war, dass Doris am nächsten Abend mit dem dicken Mr. Mercer, der mit Vornamen George hieß, in London weilte. Je mehr sie über ihre zukünftige Arbeitgeberin erfuhr, desto mehr wünschte sie, für die ihr angebotene Stellung geeignet zu sein. Mrs. Manning war gerade aus Südamerika zurückgekehrt, hatte in Paris kurzen Aufenthalt gemacht und würde schon sehr bald wieder auf Reisen gehen. Sie gehörte zu jenen Frauen, die in jedem Augenblick sagen konnten: »Morgen reisen wir nach Paris. Besorgen Sie die Flugkarten, Mercer.«
»Weshalb heiratet sie nicht wieder?«, fragte Doris, als sie im Taxi nach South Kensington fuhren.
»Sie hat kein Vertrauen zur Ehe.«
Mercer zündete sich eine Zigarette an. »Sie würde dabei nichts gewinnen, wohl aber viel verlieren. Es wäre ja auch eine Torheit, sich an einen Mann zu binden, der nur darauf bedacht ist, ihr beim Ausgeben ihres Geldes behilflich zu sein.«
Doris teilte Mercers zynischen Standpunkt in keiner Weise, aber die bevorstehende Begegnung beschäftigte sie so sehr, dass sie seine Worte schnell wieder vergaß. Die Taxe hielt vor einem Block mit vielen Etagen. Ein Lift brachte sie ins dritte Stockwerk.
»Wie soll ich mich Mrs. Manning gegenüber verhalten?«, fragte Doris, die versuchte, ihre Nervosität und ihr Herzklopfen zu verbergen. »Ich bin noch nie einer Frau ihrer Art begegnet.«
»Das glaube ich gern«, grinste Mercer. »Machen Sie sich deswegen keine Sorge. Seien Sie ganz natürlich, alles andere kommt dann von selbst. Wir sind da.« Er ging auf eine Tür zu und klingelte. Die Tür wurde von einem nett aussehenden Mädchen geöffnet, und Doris betrat einen duftenden, warmen Raum, dessen ganze Atmosphäre sie in eine Welt versetzte, die mit der regenfeuchten draußen nichts zu tun hatte.
Sie wurde in ein großes Zimmer geführt. Ihre Füße versanken in dem dicken Teppich; schwere, dunkle Samtvorhänge schlossen den Londoner Abend aus, und verborgene Lampen warfen schattenloses Licht auf tiefe Sessel und kleine Sofas. Sie sah einen Flügel, eine Hausbar, ein paar Buchregale mit Glastüren, einen Fernseh- und einen Radioapparat. Vor dem großen elektrischen Kamin, in dem glühende Gebilde brennende Holzscheite vortäuschten, stand ein langes, niedriges Sofa, auf dem die teuersten Magazine und Zeitschriften lagen. An den Wänden hingen einige Bilder, die Doris für moderne Kunst hielt - und abgesehen von diesen war sie mit allem andern, was sie sah, von Herzen einverstanden. Alles atmete Reichtum und Luxus.
Während der wenigen Minuten, die sie allein war, nahm Doris alles gierig in sich auf. Dann kam Mercer und sagte, Mrs. Manning würde gleich erscheinen.
»Wie gefällt’s Ihnen hier?«, fragte er leise und blickte dabei nach der Tür dem Kamin gegenüber.
»Wunderbar«, antwortete Doris. »So etwas habe ich bisher nur auf Bildern gesehen.«
»Sie sollten erst mal ihr Schlafzimmer kennenlernen - und das Bad!« Mercer wollte sich hierzu gerade etwas ausführlicher äußern, als die Tür, die er so aufmerksam betrachtete, geöffnet wurde und eine Frau in schulterfreiem schwarzem Abendkleid einen Augenblick auf der Schwelle stehenblieb, bevor sie das Zimmer betrat.
Bewundernd starrte Doris die Frau an. Solche Schönheit hatte sie bisher noch nicht gesehen. Groß und schlank, mit rabenschwarzem Haar und dunklen Augen, mit makellosem, feingeschnittenem Gesicht, musste sie in jeder Gesellschaft auffallen. Schultern und Busen, glatt und elfenbeinweiß, bildeten einen wirkungsvollen Gegensatz zu dem schwarzen Kleid. Instinktiv wusste Doris, dass die doppelte Perlenkette und das schwere Ohrgehänge echt waren.
Mercer verbeugte sich, und seine Stimme klang auf einmal viel weicher, als er sagte: »Dies ist die Dame, von der ich Ihnen telefonisch berichtete, Mrs. Manning.«
»Guten Tag.« Mrs. Manning lächelte und reichte Doris ihre mit Juwelen geschmückte weiße Hand. Ihre weiche Stimme klang, als wäre alles, was sie sagte, ehrlich gemeint.
»Hoffentlich hat Mercer gut für Sie gesorgt. Haben Sie im Speisewagen gegessen? Mixen Sie ein paar Cocktails, Mercer, und dann wollen wir uns unterhalten. Nehmen Sie bitte Platz.«
Doris, die sich neben der schönen Frau ziemlich schäbig und gewöhnlich vorkam, ließ sich in einen Sessel nieder, in dem sie so tief versank, dass sie Mühe hatte, das Gleichgewicht wiederzufinden. Mrs. Manning setzte sich anmutig auf das Ende des kleinen Sofas, legte dabei den einen Arm lässig auf die Rückenlehne und betrachtete Doris mit forschenden Blicken. Doris fühlte sich unbehaglich, und das Blut stieg ihr ins Gesicht.
»Mercer hat Ihnen ja wohl schon erklärt, weshalb Sie hier sind«, sagte sie, als Mercer die Getränke bereitet und das Zimmer verlassen hatte. »Von allen, die sich auf meine Annonce meldeten, gefiel mir keine einzige. Die meisten waren ausgesprochen alte Tanten, gräuliche Typen. So entschloss ich mich zu etwas ganz Neuem. Ich suchte ein junges, gut aussehendes Mädchen. Das sind meine Hauptbedingungen. Ich wusste von vornherein, dass ich allerlei riskierte, doch es machte mir nun einmal Spaß. Aber auch dieser Methode schien kein Erfolg beschieden zu sein, denn Mercer brachte mir Bewerberinnen ins Haus, die zwar gut aussahen, aber unsagbar dumm waren. Ich glaube, dass Sie das sind, was ich suche.«
Doris’ Herz schlug schneller. »Sehr lieb von Ihnen, aber Sie kennen mich doch gar nicht. Vielleicht bin ich genauso dumm wie die anderen?«
»Das glaube ich nicht.« Mrs. Manning lächelte und nippte an ihrem Cocktail. »Mercer hat mir zwar schon allerlei berichtet, doch erzählen Sie mir etwas mehr von sich. Wie alt sind Sie?«
»Zweiundzwanzig.« Doris fühlte sich immer freier. Vielleicht tat der Cocktail schon das Seine. Sie erzählte, dass sie mit sechzehn Jahren die Schule verlassen, einen Kursus für Stenografie und Maschinenschreiben mitgemacht und dann in einem Maklerbüro als Sekretärin gearbeitet hätte.
»Mein Vater ist im Krieg gefallen. Er war Sergeant bei den Fliegern - und vor zwei Jahren starb dann auch meine Mutter.«
»Das tut mir sehr leid.« Mrs. Mannings Stimme klang warm und voller Mitgefühl. »Sie haben also niemanden - keine Verwandten?«
»Nein, ich glaube, ich bin die Letzte in unserer Familie.« Doris lächelte. »Ich habe natürlich viele Freundinnen und Freunde, auch ein paar Vettern, von denen ich aber nie etwas höre.«
»Sie Ärmste! Da müssen Sie doch manchmal sehr einsam sein?«
»Ich habe mich längst daran gewöhnt, für mich allein da zu sein«, erwiderte Doris bescheiden.
Mrs. Manning entfernte das Zigarettenende aus der langen Elfenbeinspitze in den Aschenbecher.
»Hoffentlich ist das alles für Sie nun vorbei«, sagte sie lächelnd. »Ich glaube, wir werden uns gut verstehen.«
»Soll das heißen, dass ich die Stelle bekomme?«, fragte Doris erregt.
»Wenn Sie wollen - ja. Aber Sie kennen meine Bedingungen noch nicht. Ich schlage für den Anfang zehn Pfund vor.«
»Zehn Pfund!« Doris wurde fast schwindlig. Bei Gilby und Stevens verdiente sie nur vier Pfund und zehn Schilling und musste sich dauernd sagen lassen, dass sie auch die nicht einmal verdiente. Sie lachte. »Mit so viel habe ich nie und nimmer gerechnet.«
»Sie werden- mir das schon wert sein.« Mrs. Manning erhob sich. »Und was die notwendige Kleidung und alles andere angeht, so übernehme ich die Kosten. Aber das wollen wir heute Abend nicht näher besprechen. Sie sind nach der Reise sicher müde und sehnen sich nach dem Bett. Ihr Zimmer ist für Sie fertig, und Rosa - meine Zofe - wird sich Ihrer annehmen. Gute Nacht.«
Als Mercer das Zimmer wieder betrat, stand Natalie Manning am Kamin, die Spitze eines ihrer goldenen Schuhe auf die Einfassung gestellt. Er sah sie forschend an, und sie nickte ihm über die Schulter hinweg zu.
»Ausgezeichnet«, sagte sie leise. »Sie bekommt eine andere Frisur, wird ordentlich angezogen, und wer sie nicht genau kennt, hält sie bestimmt für Irma. Und das gerade wollen wir ja.«
»Ja«, entgegnete Mercer. Seine Blicke waren ein wenig trübe, während er sich mit dem Fingerknöchel das fette Kinn rieb. »Leicht wird es für das Mädchen nicht.«
Natalie Manning drehte sich hastig um und sah ihn an. Ihr schönes Gesicht war plötzlich hart und kalt geworden, als wäre es aus Stein.
Zweites Kapitel
»...Und deshalb kommt das Gericht zu dem Schluss, dass der Verlust des Dampfers Pampas durch die Unachtsamkeit seines Kapitäns Brian Stenton verursacht wurde, der während der schwierigen Fahrt auf dem Amazonas die Kommandobrücke verließ. Außerdem stand er damals unter dem Einfluss von Alkohol und war somit außerstande, seine Befehlsgewalt auszuüben. Das Gericht ordnet an, dass dem besagten Brian Stenton das Kapitänspatent für die Dauer von drei Jahren entzogen wird.«
Brian Stentons große, von der Sonne verbrannte Hände krampften sich langsam zusammen, als ihn in dem Saal der Admiralität die Worte des Vorsitzenden des Gerichts wie aus weiter Ferne erreichten. Er hatte damit gerechnet. Nach dem Beweismaterial konnte das Gericht keinen anderen Spruch fällen. Er war auf das Unvermeidliche gefasst, aber dennoch traf es ihn jetzt wie ein harter Schlag vor den Magen. Er fühlte sich ohne Schuld, und gerade das machte für ihn den Spruch des Gerichts besonders hart. Sein Blick wanderte hin zu der schönen Frau, die ihn mit ihren unergründlichen Augen ansah. Ihr hatte er das alles zu verdanken. Aber da er nicht getan hatte, was sie wollte, hatte sie keinen Finger zu seiner Rettung gekrümmt.
Das Gericht erhob sich. Richter und Anwälte legten ihre Akten zusammen und sprachen miteinander wie Menschen, die irgendeine ihnen geläufige Arbeit erledigt haben. Stentons Anwalt kam auf den Verurteilten zu und reichte ihm die Hand.
»Es tut mir leid, dass es so ausging«, sagte er mit ehrlichem Mitgefühl, »aber die Sache war von vornherein hoffnungslos. Das verfluchte Weibsbild...« - er senkte seine Stimme und machte mit dem Kopf eine Bewegung nach der Frau hin, die gerade ihren kostbaren Pelz um die Schultern legte und den Gerichtssaal verlassen wollte »...ich konnte sie einfach nicht zum Sprechen bringen, und Sie haben ja wohl selbst gemerkt, dass der Vorsitzende immer wieder ins Kreuzverhör eingriff. Sie brauchte ihn nur anzusehen, und schon wurde ich unterbrochen.«
»Ja, das weiß ich. Sie haben jedenfalls getan, was Sie konnten«, erwiderte Stenton.
»Freut mich, dass Sie das sagen. Also, auf Wiedersehen und alles Gute. Sollte ich noch etwas für Sie tun können...«
Schon eilte er mit wehendem Talar weiter.
Brian Stenton biss die Zähne aufeinander und schritt durch den Gerichtssaal. Die Frau im kostbaren Pelz bewegte sich mit der Menge auf die Tür zu. Einen Augenblick lang sahen ihre dunklen Augen, in denen Freude über seine Niederlage zu funkeln schien, ihn an. Dann wandte sie verächtlich den Blick ab.
Niederlage und Ruin eines Schiffskapitäns! Dieser Gedanke ging ihm blitzartig durch das Hirn und erfüllte ihn mit tiefer Bitterkeit. Er reckte die breiten Schultern, und sein hartes, sonnenverbranntes Gesicht wurde noch härter und abweisender, als er auf die Tür zuging. Mehr als ein Reporter gab das geplante Interview auf, als er die eiskalten blauen Augen sah.
Unbelästigt erreichte Stenton den breiten Korridor und war fast am nächsten Ausgang angelangt, als ihm ein junger Mann in fleckigem Regenmantel und mit wirrem Haar den Weg vertrat.
»Vertreter des Daily Clarion, Kapitän Stenton«, sagte er, sich dabei bemühend, seine Worte mit entwaffnender Liebenswürdigkeit zu verbinden. »Mein Name ist Jerry Henshaw. Ihr Fall interessiert mich sehr, und wir meinen...«
»Scheren Sie sich zum Teufel«, fuhr Stenton ihn an und drängte ihn beiseite.
»Ich kann mir selbst gut vorstellen, Käpt’n, in welcher Verfassung Sie sind«, sprach der junge Mann weiter. »Aber gerade deswegen...«
Stenton hatte inzwischen die Treppe erreicht und bahnte sich seinen Weg durch die Menge, die hinter ihm her schimpfte.
Als er die Admiralität verlassen hatte, rief er ein Taxi und nannte als Ziel die South Atlantic Shipping Company in der Fenchurch Street. Meine Arbeitgeber, oder besser, meine früheren Arbeitgeber, dachte er grimmig. Ob sie ihm eine andere Stellung gaben? Vielleicht die eines Vollmatrosen? Er stellte sich den alten Kilburn, den Inspektor, vor, der massig hinter seinem Schreibtisch saß, wie ein aufgeblasener Frosch aussah und quakend sagte, er müsste doch die Situation begreifen, und wenn die Gesellschaft gegen ihn persönlich auch nichts hätte Und durchaus bereit wäre, ein Auge zuzudrücken, so müsste er sich doch klarmachen...
Ihn packte der Ekel. Nein, alles andere, nur das nicht! Er gab dem Chauffeur die Adresse des bescheidenen Hotels, in dem er abgestiegen war. Dort kannte ihn niemand, und niemand wusste auch nur das Geringste über seinen Fall.
Es regnete. Ständiges, bedrückendes Geriesel aus tiefen, grauen Wolken, die die Dächer zu berühren schienen. Fahrwege und Bürgersteige waren mit dünnem Schlamm bedeckt. London in seiner grauesten Stimmung, die so gut zu der seinen passte.
Er bezahlte den Chauffeur, betrat das Hotel und ging vorbei an dem Empfangsbüro durch den Speisesaal mit dem abgetretenen Teppich. Leichter Modergeruch umwehte ihn. Im zweiten Stockwerk betrat er sein Zimmer. Es war ein drittklassiges Hotelzimmer mit geschmackloser Blumentapete und einem Ausblick auf nasse Dächer, Hinterhöfe und die Rückseite eines großen Warenlagers.
Er blickte durch das vom Regen trübe Fenster, die Hände tief in den Taschen vergraben, und verfolgte müßig den Zickzackweg der Regentropfen über die Scheiben. Ja, selbst dieses Zimmer konnte er sich nicht leisten. Er musste sich nach Arbeit umsehen, um irgendwie die Überfahrt nach Brasilien zu schaffen, und versuchen, das Geheimnis zu lüften, das den Verlust seines Schiffes umgab. Aber war das möglich? Die schwarzen Augen in dem schönen Gesicht über dem kostbaren Pelz stellten sich immer wieder zwischen ihn und seine Gedanken. Er war dreißig Jahre alt und als jüngster Kapitän der Gesellschaft bei ihren Eigentümern und den Passagieren in gleicher Weise beliebt. Seine Laufbahn schien gesichert. Und dann dieses Unglück - nicht durch seine Schuld!
Ein Klopfen an der Tür schreckte ihn auf.
»Herein!«, sagte er über die Schulter hinweg. Er glaubte, es wäre das Zimmermädchen. Er drehte sich ärgerlich um und sah in der Tür den jungen Reporter.
»Wie, zum Teufel, kommen Sie hierher?«
»Genau wie Sie, Käpt’n, mit einer Taxe.« Henshaw betrat das Zimmer, schloss die Tür hinter sich, als wären die Worte des anderen eine Aufforderung gewesen, und knöpfte den Regenmantel auf. »So ’n bisschen Spurensuche. Schwer war’s nicht.«
»Sie hatten also die Frechheit, mir zu folgen, und dringen jetzt so mir nichts, dir nichts in mein Zimmer ein!«
»Richtig, genauso war’s«, stimmte der andere bei. »Wir vom Clarion lassen uns nicht einfach abspeisen. Das können wir uns nicht leisten, wenn wir nicht rausfliegen wollen. Jemand aufspüren ist...«
»Scheren Sie sich zum Teufel - samt Ihrem Clarion. Raus! Raus!«
»Einmal genügt, Käpt’n. Zu schreien brauchen Sie auch nicht. Hören Sie lieber mal zu, Käpt’n...«
»Nennen Sie mich nicht Käpt’n. Sie wissen genau, dass mir heute das Patent aberkannt wurde.«
»Eine Affenschande! Deswegen komme ich zu Ihnen. Ich glaube, dass ich Ihnen helfen kann.«
Henshaw sprach schnell weiter, als Stenton auf ihn zukam, um ihn hinauszuwerfen. »Vermutlich hat man Sie zum Sündenbock gemacht, während in Wirklichkeit... Wenn Sie sich nicht so bockig anstellten... Vielleicht könnten wir Ihnen doch behilflich sein.«
Stenton stand drohend vor ihm. »Wollen Sie mit meiner Lebensgeschichte Reklame für Ihre Zeitung machen?«
»Nichts dergleichen. Ihre Lebensgeschichte interessiert uns nicht. So ein Blatt sind wir nicht.« Henshaw hielt sich tapfer. »Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es in Ihnen aussieht. Aber merken Sie denn nicht, dass wir auf Ihrer Seite stehen? Das Clarion ist eine einflussreiche Zeitung, und eine Unterstützung durch sie bedeutet allerlei. Bleiben Sie doch nicht im Regen stehen, kommen Sie zu uns ins Trockene.«
»Glauben Sie wirklich, dass die Pampas nicht durch meine Schuld verlorenging?«, fragte Stenton. Er rechnete mit einer zögernden Antwort des anderen, dann hätte er gleich gewusst, dass er log.
»Durchaus«, entgegnete prompt der Reporter. »Deshalb habe ich den Herausgeber überredet, etwas in dieser Sache zu unternehmen.«
»So?«
Stentons Stimme war nachdenklich geworden. »Ja, natürlich wäre das eine Hilfe.«
»Unbedingt.« Henshaw wischte sich mit dem Taschentuch über das Gesicht, und sein Lächeln wurde etwas weniger gequält. »Ich wusste doch, dass Sie zustimmen würden, sobald Sie...«
»Aber das berechtigt Sie noch lange nicht, hinter mir her zu spionieren und mich in meinem Zimmer zu überfallen.«
»Gebe ich zu - Verzeihung!« Henshaw hob die Hände, als wollte er durch diese Bewegung seine Entschuldigung bekräftigen. »Mehr kann ich nicht sagen. Aber irgendwie musste ich ja schließlich auf Ihre Wellenlänge kommen. Doch reden wir nicht weiter davon. Wollen lieber mal überlegen, was wir jetzt unternehmen... Zigarette?«
»Ich rauche nur Pfeife.« Stenton war immer noch sehr zurückhaltend. Er zog eine gut angerauchte Bruyere-Pfeife aus der Tasche.