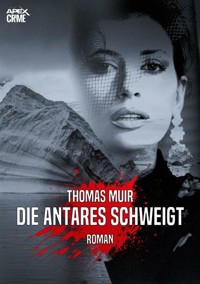6,99 €
Mehr erfahren.
»Ist denn auf dieser Insel alles tot?«, brummte Kapitän McPherson ungeduldig. Er stand auf der Kommandobrücke der Fingael und starrte zum Land hinüber. »Sandy, noch einen Stoß mit der Sirene!«
Der zweite Steuermannsmaat zog die Leine, und die Dampfpfeife heulte durchdringend auf. Scharen von Möwen erhoben sich von den Felsen am Nordende der Insel Camorach und trieben wie wirbelnde Schneeflocken durch die Luft. Ein Seehund, der sich auf den flachen Felsen gesonnt hatte, glitt platschend ins Wasser, streckte aber sofort wieder den Kopf heraus. Offenbar wollte er sich vergewissern, woher die Störung kam...
Der Roman Tod im Zeichen der Jungfrau des schottischen Schriftstellers und Journalisten Thomas Muir (* 02. Januar 1918; † 8. Oktober 1982) erschien erstmals im Jahr 1954; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1960 (unter dem Titel Das Mädchen auf dem Schlepper).
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
THOMAS MUIR
Tod im Zeichen
der Jungfrau
Roman
Apex Crime, Band 231
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
TOD IM ZEICHEN DER JUNGFRAU
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Das Buch
»Ist denn auf dieser Insel alles tot?«, brummte Kapitän McPherson ungeduldig. Er stand auf der Kommandobrücke der Fingael und starrte zum Land hinüber. »Sandy, noch einen Stoß mit der Sirene!«
Der zweite Steuermannsmaat zog die Leine, und die Dampfpfeife heulte durchdringend auf. Scharen von Möwen erhoben sich von den Felsen am Nordende der Insel Camorach und trieben wie wirbelnde Schneeflocken durch die Luft. Ein Seehund, der sich auf den flachen Felsen gesonnt hatte, glitt platschend ins Wasser, streckte aber sofort wieder den Kopf heraus. Offenbar wollte er sich vergewissern, woher die Störung kam...
Der Roman Tod im Zeichen der Jungfrau des schottischen Schriftstellers und Journalisten Thomas Muir (* 02. Januar 1918; † 8. Oktober 1982) erschien erstmals im Jahr 1954; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1960 (unter dem Titel Das Mädchen auf dem Schlepper).
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
TOD IM ZEICHEN DER JUNGFRAU
Erstes Kapitel
»Ist denn auf dieser Insel alles tot?«, brummte Kapitän McPherson ungeduldig. Er stand auf der Kommandobrücke der Fingael und starrte zum Land hinüber. »Sandy, noch einen Stoß mit der Sirene!«
Der zweite Steuermannsmaat zog die Leine, und die Dampfpfeife heulte durchdringend auf. Scharen von Möwen erhoben sich von den Felsen am Nordende der Insel Camorach und trieben wie wirbelnde Schneeflocken durch die Luft. Ein Seehund, der sich auf den flachen Felsen gesonnt hatte, glitt platschend ins Wasser, streckte aber sofort wieder den Kopf heraus. Offenbar wollte er sich vergewissern, woher die Störung kam.
»Tot oder taub - vielleicht beides.« Der Kapitän ließ sein Glas sinken und begann auf Gälisch zu fluchen. »Hol sie der Teufel, wie soll ich meinen Fahrplan einhalten, wenn sie mir nicht ihr Boot herausschicken?«
Der kleine Dampfer, der an der Küste des westlichen Hochlands den Verkehr versah, hatte inzwischen gestoppt und lag bewegungslos etwa eine Viertelmeile vor der Insel in der trägen Dünung. Es war ein warmer Augustnachmittag, und eine leichte Brise kräuselte das leuchtend blaue Wasser der Meerenge. Hohe Kumuluswolken türmten sich über den kahlen Quarz- und Sandsteinkuppen von Wester Ross, während die niedrigeren Berghänge im bräunlichen Rot des Heidekrauts schimmerten. Die Passagiere drängten sich an der Backbordreling, denn für sie war es nur eine nette Abwechslung. Auf Camorach gab es keine Pier, und das Motorboot, das dem Schiff hätte entgegenfahren sollen, war nirgends zu sehen. Nur die kleine Schafherde, die auf dem Vorderdeck eingepfercht war und unruhig blökte und scharrte, schenkte dem allen keine Aufmerksamkeit.
»Major Grant scheint jeder Sinn für Pünktlichkeit zu fehlen - köstlich, echt hochländisch!«, bemerkte Professor Cleghorn, ein kleiner Herr mit pausbäckigem Gesicht und hellen, aufmerksamen blauen Augen; er mochte etwa Anfang Sechzig sein.
»Aber irgendwie müssen wir doch an Land«, entgegnete seine Frau, die fast einen halben Kopf größer war als ihr Mann und den Eindruck machte, als sei sie der weitaus nüchternere Teil des Zweigespanns. »Mir ist jetzt wirklich nach einer Tasse Tee zumute. Ich frage mich schon, ob es nicht vielleicht ein Fehler war, ausgerechnet hier unsere Ferien verbringen zu wollen. Schließlich wissen wir von diesem Ort ja nicht mehr, als was in der Anzeige stand.«
»Ein Paradies im Hochland«, zitierte ihre Tochter Valerie. »Entlegene Insel nördlich Skye. Völlige Ruhe. Herrliche Landschaft. Mildes Klima. Angeln, Schwimmen und Segeln. Aller Komfort.«
»Nur versagt derjenige Komfort, mit dem wir in dieses Paradies gelangen können«, rief ihr Vater belustigt. »Wie Moses dürfen wir das Gelobte Land bloß schauen...«
Der Rest des Satzes verlor sich in einem neuen Dröhnen der Schiffssirene - einem langen Heulen, das mit einer Reihe kurzer, ungeduldiger Stöße endete. Tiefe Stille folgte.
»Sollte genügen, um sogar die Toten zu wecken«, meinte ein junger Mann mit langem, braunem Haar und offenem Gesicht; er trug eine Studentenjacke aus Flanell und war sichtlich um Valerie bemüht... »Aber da rührt sich doch etwas!«, fügte er hinzu, als ein offenes Motorboot aus der tief ins Land einschneidenden Bucht an der Nordwestecke der Insel auftauchte und mit schäumender Bugwelle auf sie zuhielt.
»Gott sei Dank«, rief Mrs. Cleghorn erleichtert. »Wie steht es nun mit dem Gepäck?«
»Alles bereits bestens geordnet, meine Liebe.« Die Stimme des Professors klang spröde, doch war sie erstaunlich durchdringend. »Einer der Matrosen besorgt das.«
»Aber vielleicht tut er es auch nicht.«
»Bestimmt tut er’s, oder der Kapitän ist nicht der Mann, für den ich ihn halte! Außerdem habe ich ihm auch noch kein Trinkgeld gegeben; das bekommt er erst, wenn alles im Motorboot ist.«
»Was willst du ihm denn geben?«, fragte Mrs. Cleghorn argwöhnisch.
»Was mir für solche Dienste angemessen erscheint.«
»Was das bedeutet, weiß ich schon«, erwiderte sie mit finsterer Überzeugung. »Wenn es um Trinkgelder geht, kennst du überhaupt keinen Maßstab. Ein Schilling ist durchaus reichlich.«
»Aber meine Liebe, denk doch an die ständig steigenden Lebenshaltungskosten! Für einen lumpigen Schilling würde ich so viel Gepäck bestimmt nicht auf das Motorboot schleppen.«
»Aber dafür wird er doch schon bezahlt - und im Verhältnis weit besser als du.«
»Nun hört einmal zu!«, mischte sich Valerie mahnend ein. »Deswegen braucht man sich doch nicht in aller Öffentlichkeit eine Szene zu machen!«
»Da hast du recht, Val.« Der Professor nickte zustimmend und ließ verstohlen eine halbe Krone in seine rechte Westentasche gleiten. »Und nun begeben wir uns besser zum Fallreep, bevor wir die gälischen Flüche des Kapitäns auf unser Haupt ziehen«, sagte der Professor.
Das Motorboot drehte bei, um längsseits zu kommen. Kapitän McPherson beugte sich über die Reling der Kommandobrücke, legte die Hände an den Mund und bullerte:
»Wo bleiben Sie denn, Major Grant? Glauben Sie, ich hätte nichts anderes zu tun, als hier draußen zu warten, bis Sie auf die Idee kommen, einen Kahn loszuschicken?«
Der Mann am Steuer des Motorboots, eine malerische Gestalt in Schottenrock, grober Tweedjacke und Balmoralmütze, bückte sich, um den Motor zu drosseln, ehe er ebenso laut zurückrief:
»Wie soll ich denn wissen, dass Sie fast eine Stunde vor der Zeit kommen?«
»Vor der Zeit?«, bellte der Kapitän. »Wissen Sie denn nicht, dass der Fahrplan geändert ist? Es hat doch groß und breit in der Invermory Times gestanden. Oder lesen Sie keine Zeitungen?«
Major Grant versuchte keine weitere Erwiderung. Vielleicht waren die Sticheleien daran schuld, auf jeden Fall missglückte sein Manöver, und das Motorboot schoss am Fallreep vorbei. Der Kapitän ließ sofort einige bissige Bemerkungen über die Fähigkeiten »gewisser Leute vom Stapel, die sich einbildeten, sie wüssten mit Booten umzugehen, während der Major ein zweites Mal versuchte, längsseits zu kommen. Eine Gestalt in einer Strickjacke, die am Bug des Motorboots stand, warf die Fangleine zum Schiff hinüber, wo sie dieses Mal auch aufgefangen und gleich belegt wurde.
Das Gepäck wurde rasch übernommen, und Professor Cleghorn und seine Familie kletterten das Fallreep hinunter. Major Grant sah zwar etwas erhitzt und atemlos aus, doch hielt er sich mit einem Fuß auf dem Dollbord aufrecht, riss seine Mütze herunter und half den Damen an Bord.
»Willkommen auf Camorach!«, rief er zuvorkommend. »Ich bitte wegen der Verspätung um Verzeihung, aber die Dampfergesellschaft macht hier draußen, was sie will, und wir wissen nie genau, woran wir sind.«
Professor Cleghorn kam als letzter, und nachdem er die halbe Krone glücklich einem stämmigen Seemann zugesteckt hatte, sprang er behend und ohne Hilfe an Bord des Bootes.
»Major Grant?... Ich bin Professor Cleghorn... Meine Frau... meine Tochter Valerie... und Anthony Stenton«, damit stellte er den jungen Mann in der Studentenjacke vor. »Ein Freund meiner - äh - Familie.«
Valerie lächelte angesichts dieses betonten Zögerns und wechselte rasch einen Blick mit Anthony. Inzwischen hatte man die Fangleine abgeworfen, und die Schrauben der Fingael wirbelten bereits wieder das Wasser auf, während das Schiff Fahrt aufnahm. Major Grant tauschte einen höflichen Winkgruß mit dem Kapitän auf der Kommandobrüche und nahm dann Kurs auf die Insel.
»Kapitän McPherson ist ein tüchtiger Bursche«, sagte er und blickte dem sich entfernenden Dampfer nach, »aber so ein richtig saugrober Westschotte. Ich glaube, er stammt von der Insel Skye.«
»Sind Sie selbst denn kein Westschotte, Major?« Cleghorn musterte ihn abschätzend. Er hatte einen Mann von etwa vierzig Jahren vor sich, der um die Hüften bereits zum Dickwerden neigte. Dunkles Haar, oben schon ein wenig grau und im Scheitel etwas spärlich, ein kurzgestutzter schwarzer Schnurrbart über schmalen Lippen und lebhafte schwarze Augen gaben ihm mehr das Aussehen eines Geschäftsmannes aus der Stadt als das eines Grundherrn aus dem Hochland, trotz seines Schottenrocks.
»Nein, ich bin ein Grant von Craigellachie«, erklärte er.
»Wie interessant«, warf Mrs. Cleghorn ein. »Standhaftes Craigellachie - das ist die Familiendevise, nicht wahr?«
»Ich dachte, das sei eine Whiskymarke«, sagte der Professor. »Sind Sie in diesem Geschäftszweig tätig, Major?«
»Leider nicht.« Major Grant grinste. »Das ist eine andere Linie der Familie. Mein ganzer Besitz ist Camorach, und das ist heutzutage eher eine Belastung als ein Aktivposten!«
»Ererbter Familienbesitz?«
»Genau genommen nicht. Die Familie hatte ihn nach dem Jahre 1745 verloren. Anhänger Jakobs, Sie verstehen schon. Culloden und so weiter. Ich habe es immer zurückerwerben wollen, und da kam nach dem Krieg die für mich günstige Gelegenheit. Die Luftwaffe besaß es damals - Sie werden ja noch den Dreckhaufen zu sehen bekommen, den sie aus einem Teil der Insel gemacht haben -, und ich konnte es also zurückkaufen und das Haus wieder instand setzen lassen. Da kommt es gerade in Sicht.«
Sie liefen nun in die Bucht ein, und vor ihnen lag ein fest gebautes, zweistöckiges Haus im schottischen Herrenhausstil mit hochgezogenem Dach, gestuftem Giebel und kleinen aufgesetzten Türmchen an den Ecken. Es stand in einem flachen Talgrund mit der Front nach Westen zur Bucht hin; in Terrassen stieg ein Garten zu ihm auf, durch den über Zementstufen ein Weg zu einer steinernen Pier führte; der größere Teil des Gartens lag hinter dem Haus. Einige Nebengebäude lagen noch im Gelände verstreut, ihrer ganzen Anlage nach offensichtlich früher für Dienstboten bestimmt.
»Wie schön!«, rief Valerie aus. »Ich habe immer in einem Haus leben wollen, wo ich gleich durch den Garten laufen und ins Wasser springen kann. Darauf freue ich mich jetzt schon.«
»Zum Schwimmen ist es hier herrlich«, sagte Grant und ließ seinen Blick anerkennend über ihre schlanke Gestalt gleiten, womit er sich ein Stirnrunzeln von Anthony Stenton zuzog, der das Thema jäh wechselte, indem er fragte:
»Und wie ist es hier zum Segeln?«
»Hier können Sie segeln, soviel Sie wollen.« Grant richtete seinen Blick nun auf ihn. »Wir haben ein paar Jollen hier - eine mit einem Schwert; dann noch dieses Motorboot, das ich für alle möglichen Zwecke verwende; und die Kelpie«, er nickte in Richtung auf ein ehemaliges Rettungsmotorboot der Luftwaffe, das in der Mitte der Bucht vor Anker lag. »Ich habe es umbauen lassen und kann es jederzeit für Ausflüge zur Verfügung stellen.«
»Ich glaube, die Jollen sind mehr nach meinem Geschmack.«
»Und was ist das für ein Ding ganz am Ende der Bucht?«, fragte Mrs. Cleghorn und deutete auf einen rostigen Radschlepper, der dort lag.
Major Grant drosselte, bevor er antwortete, den Motor ab.
»Es ist nur ein alter Schlepper, den man dort vor Anker gelegt hat. Nach dem Krieg hat er Kähne mit Munition, die versenkt werden sollte, auf See hinausgeschleppt. Und nun wird er nicht mehr gebraucht. Es wäre weit besser gewesen, man hätte ihn ebenfalls dort draußen absaufen lassen, anstatt ihn hierzubehalten. Einen schönen Anblick bietet er ja gerade nicht. Er befindet sich jetzt auch schon in einem ziemlich üblen Zustand, und man sollte am besten nicht an Bord gehen... Achtung, Dougie, pass auf!«
Sie näherten sich der Pier, und die letzten Worte waren an den Mann im Bug gerichtet. Grant stellte ihn nun auch ganz beiläufig vor:
»Dougal McVean, einer meiner Leute. Wenn Sie irgendetwas brauchen, können Sie sich stets an Dougal wenden.«
Dougal McVean war ein dunkler, breitschultriger Mann in Wollzeug und Seestiefeln, so wie Fischer sie tragen. Er hatte tiefliegende Augen unter buschigen Augenbrauen. Er grinste pfiffig, wobei ein paar gelbliche Zahnstümpfe zum Vorschein kamen, und fuhr sich mit der Eland an die Mütze. Aber sein Gruß war kaum mehr als eine Andeutung.
»Ureinwohner«, murmelte Professor Cleghorn. »Vorkeltische Zeit. Wahrscheinlich ein Nachkomme der alten Pikten. Die niedrige Stirn und die tiefen Augenhöhlen sind typisch. Interessant.«
»Verschone uns bitte mit deiner Anthropologie«, sagte Valerie gedämpft, während sie längsseits der Pier kamen. Major Grant half den Damen bereitwilligst an Land, überließ es Dougie, das Gepäck nachzubringen, und ging über die Terrassen ihnen voraus zum Haus. Unter dem hohen Torbogen erwartete sie eine schöne, junge Frau in Schottenrock und grünem Sweater. Er stellte sie als seine Frau vor.
»Hoffentlich hast du schon alles fertig, Helen«, rief er. »Es ist ja zu dumm, dass der Dampfer so früh kam.«
»Das macht gar nichts«, versicherte Helen Grant ihren Besuchern mit freundlichem Lächeln. Sie hatte eine Haut wie mattes Elfenbein, prächtiges rötlich-braunes Haar, offensichtlich von Natur, klare, dunkelbraune Augen mit einem grünlichen Schimmer in der Tiefe und einen kräftigen Mund. »Es steht schon alles bereit. Würden Sie mir bitte nach oben folgen, damit ich Ihnen die Zimmer zeige?«
Die anderen gingen hinter ihr die Treppe zum ersten Stockwerk hinauf, wo Professor Cleghorn und seine Frau ein großes Doppelzimmer, das auf die See hinausging, erhielten. Valerie hatte ein kleineres Zimmer gleich daneben, während Anthony mehr zur Treppe hin wohnen sollte.
»Nun, meine Liebe, was hältst du davon?«, fragte der Professor, als sie allein waren, und schnüffelte wie ein neugieriger Schuljunge im Zimmer herum. »Wie gefällt es dir, Gast eines Hochland-Lords auf seiner Inselfestung zu sein?«
»Paradies lautete die Bezeichnung«, erinnerte ihn seine Frau, warf ihren Hut aufs Bett und wandte sich zum Spiegel. »Das alles sieht ja sehr nett aus, wenn mich auch der Major selbst nicht sehr für sich eingenommen hat. Übrigens - er hat vorher getrunken.«
»Deswegen habe ich ihn ja auch gefragt, ob er mit Whisky handelt.«
Mrs. Cleghorn lachte, aber es klang doch ein Vorwurf durch.
»Zum Glück hat er es nicht übelgenommen, aber du solltest wirklich etwas vorsichtiger sein.«
Professor Cleghorn wandte sich vom Fenster, von wo er einen Blick auf die Gegend geworfen hatte, ab und zwinkerte ihr zu.
»Du wirst niemals einen Hochländer dadurch beleidigen, dass du zu verstehen gibst, er habe gerade was getrunken. Für ihn ist ja Whisky sozusagen die Muttermilch.«
»Nun gehen wir erst einmal hinunter und sehen zu, ob Vorbereitungen zum Tee im Gang sind«, antwortete Mrs. Cleghorn.
Dies war glücklicherweise der Fall. In dem großen, mit Eiche getäfelten Wohnzimmer, dessen tiefe französische Fenster auf die Terrasse hinausgingen, lernten sie die anderen Gäste kennen - Mr. und Mrs. Harding, Amerikaner aus Kalifornien; außerdem noch Miss Margaret Gilchrist, eine hagere, steife ältere Dame mit weißem Haar und leuchtend schwarzen Vogelaugen.
»Wenn Sie Frieden und Ruhe suchen, Professor, wird es Ihnen hier gefallen«, erklärte Mr. Harding, nachdem die Vorstellungen beendet waren. »Meine Frau und ich haben ganz Europa abgeklappert - Paris, die Riviera, Mailand, Venedig, Florenz, Rom.« Er rasselte die Namen herunter wie ein Zugansager. »Wir haben sie alle innerhalb von vierzehn Tagen erledigt - und uns langt es so ziemlich!« Sein hageres Gesicht, das noch Spuren der Erschöpfung aufwies, verzog sich zu einem Lächeln. »Ich war immer der Meinung, dass ich - bis auf meinen Magen - eine recht gute Konstitution habe; aber das kann ich Ihnen sagen, ich bin mir doch schließlich ziemlich verbraucht vorgekommen, und da habe ich zu Claire gesagt: Liebling, so kann ich ganz einfach nicht weitermachen. Wir müssen einen Ort finden, an dem wir uns wirklich erholen und eine Weile entspannen können. Ich will ganz einfach keine Gemäldegalerien und Kathedralen mehr sehen. Mein Bedarf daran ist für lange Zeit gedeckt.«
»Mir war ganz genau so zumut«, mischte sich nun seine Frau ein und nickte. Sie war eine hübsche Erscheinung, eine gut erhaltene Fünfzigerin, die durch ein festes Korsett ihrer Figur noch den Anschein von Jugendlichkeit zu geben suchte. »Dann entdeckten wir zufällig die Anzeige von diesem Schloss. Das erschien uns ganz das Richtige, und wir ließen uns sofort telefonisch Zimmer reservieren.«
»Und entspricht es nun Ihren Erwartungen?«, fragte Professor Cleghorn und biss in das warme Buttergebäck.
»Das kann man wohl sagen!«, erklärte Mrs. Harding mit Nachdruck. »Was für eine herrliche Landschaft, und dann diese romantischen Namen und das Gälische und die Geschichte, die man hinter allem spürt! Dem kann man sich doch nicht entziehen«, rief sie und legte wie zur Bekräftigung die Hand auf ihren fülligen Busen. »Sie müssen verstehen, meine Großeltern waren nämlich Schotten - Robertson war der Name -, und Joe hat ebenfalls schottisches Blut in den Adern. So trägt er auch noch den Namen Sinclair nach einem seiner Vorfahren. Ich dränge ihn ständig, sich doch tatsächlich Sinclair Harding zu nennen. Immerhin ist es doch ein Name, auf den man stolz sein kann.«
»Wenn ich meinen Magen von diesem Vorfahren habe, so ist das bestimmt nichts, wofür ich dankbar sein könnte!«
»Wenn Sie vernünftig essen würden, Mr. Harding, hätten Sie auch niemals Verdauungsbeschwerden.« Plötzlich hatte sich Miss Gilchrist in die Unterhaltung eingeschaltet, während sie an einem Etwas nagte, das wie ein Stück gebleichte Pappe aussah. »Das kommt alles nur von Ihrer falschen Diät, und dafür brauchen Sie Ihre Vorfahren nicht verantwortlich zu machen.«
»Vielleicht haben Sie damit gar nicht so unrecht«, gab Harding zu, während er einigermaßen misstrauisch die essbare Pappe durch seine sechseckige randlose Brille betrachtete, »aber ich kann mich nun einmal mit einer rein vegetarischen Kost nicht abfinden.«
Valerie und Anthony sahen, nachdem sie ihren Tee beendet hatten, einander fragend an. Die Unterhaltung, die sich nun vornehmlich um Fragen der Ernährung und des Stoffwechsels drehte, die ihnen bislang nicht die geringsten Kopfschmerzen verursacht hatten, langweilte sie. Sie nahmen einen passenden Augenblick wahr, sich zu entschuldigen, und flüchteten in den Sonnenschein hinaus.
»Sehr anregende Gesellschaft, nicht wahr?«, lachte Valerie, als sie über die Terrassen zum Strand hinunterliefen. »Eine vegetarische alte Jungfer, ein magenkranker Amerikaner und seine auf Vorfahren versessene Frau!«
»Ziemlich trostlos!«, gab Anthony mit dem Ausdruck eines Mannes zu, dem im Übrigen alles ziemlich gleichgültig ist, solange er sich nur in Gesellschaft dieses reizenden, langbeinigen Mädchens mit den lachenden blauen Augen und der Mähne welligen blonden Haares befand. Sie hatte inzwischen kurze Tennishosen angezogen, trug ein Sporthemd mit offenem Kragen und strahlte vor Jugend und Lebensfrische.
Sie warf ihm von der Seite einen Blick zu.
»Es scheint dich aber doch nicht sehr niederzudrücken.«
»Tut es auch nicht«, versicherte er ihr. »Viel schlimmer wäre ein Haufen raublustiger junger Männer.«
»Du glaubst also, dass du vor Konkurrenz ziemlich sicher bist?« Sie lachte herausfordernd. »Sei deiner Sache nicht zu sicher. Wie wäre es denn mit dem Major? Immerhin ein sehr galanter Mann. Hat diesen gewissen Blick.«
»Guter Gott, er ist vierzig, wenn das überhaupt langt!«
»Das heißt, er ist über das unangenehme Stadium der Unreife hinaus...«
»Außerdem hat er eine Frau, bei der einem der Atem vergehen kann.«
»Ach, hast du das bereits bemerkt?«
»Hör zu, wir wollen uns doch hier nicht streiten«, meinte Anthony und versuchte das Geplänkel abzubrechen, bei dem er, wie er wusste, ohne weiteres den Kürzeren ziehen würde. »Machen wir lieber eine Jolle klar. Möchte nur wissen, wo er die Segel auf bewahrt.«
»Wo wollen denn Sie hin?« war plötzlich eine Stimme zu vernehmen, und sie wandten sich um. Dougal McVean kam am Strand hinter ihnen her geschlendert.
»Wir wollten eigentlich jetzt segeln«, erwiderte Anthony.
»Sie werden heute noch an Land bleiben müssen«, entgegnete Dougal mit einer gewissen Schadenfreude in der Stimme. »Der Major will nicht, dass mit den Booten hinausgefahren wird.«
»Aber was soll denn das...? Warum nicht?«
»Das können Sie ihn ja selbst fragen. Wenn er mir einen Befehl gibt, frage ich nicht lange, wieso und warum.«
»Aber das muss doch ein Irrtum sein. Wo ist denn überhaupt Major Grant?«
»Er ist mit dem Gewehr über die Hügel gegangen. Dann gibt es morgen Kaninchenpastete.«
»Aber... das ist ja geradezu lächerlich«, widersprach Anthony. »Professor Cleghorn hat abgemacht, dass wir die Boote benutzen können. Es muss doch also ein Irrtum vorliegen. Können Sie uns denn nicht sagen, wo sich Mast und Segel befinden?«
»Das ist mir die Sache nicht wert.« Dougal schüttelte entschlossen den Kopf.
Verzweifelt blickten Valerie und Anthony einander an. Ganz offensichtlich hatte Dougal etwas missverstanden und nahm seine Befehle zu wörtlich. Anthony zuckte mit den Schultern.
»Aber schließlich kann uns ja wohl nichts daran hindern, mit einem der Boote hinauszurudern«, erklärte er.
Dougal schob seine Tuchmütze zurück und fuhr sich mit den Fingern durch das spärliche graue Haar.
»Befehl des Majors«, sagte er eigensinnig.
»Das erledigen wir nachher, wenn der Major zurück ist... Komm jetzt, Val, wir bringen das Boot zu Wasser.«
Dougal betrachtete sie verdrießlich, wie sie die Jolle zu Wasser brachten und einstiegen.
»Aber behaupten Sie nur nicht, ich hätte es Ihnen nicht gesagt«, rief er hinter ihnen her, drehte sich um und stapfte schwerfällig zum Haus zurück.
»Auch so ein streitsüchtiger alter Teufel«, sagte Anthony lächelnd, während er die Ruder einlegte. »Wohin fahren wir jetzt?«
»Wie wäre es, wenn wir bis zum Ende der Bucht ruderten? Es sieht dort sehr schön aus.«
»Das hatte ich mir auch gedacht.« Anthony hatte seine Flanelljacke ausgezogen, und unter seinen Schlägen glitt die Jolle leicht über das stille Wasser hin. Nur leise murmelten die Wellen unter dem Kiel. Er war einundzwanzig Jahre, ein Jahr älter als Valerie, und sehr in sie verliebt.
»Rudern tust du ja gut«, erklärte sie schließlich. »Aber eigentlich liegen wir gar nicht in einem Rennen.«
»Ich habe nur etwas überschüssige Kraft«, sagte er bescheiden und behielt einige Minuten lang seinen schnellen Schlag bei. Irgendwo in den Hügeln knallte ein Flintenschuss, dem fast unmittelbar ein zweiter folgte.
»Klingt mir fast so, als ob es morgen Kaninchenpastete gäbe«, meinte Valerie, wobei es ihr gelang, Dougals Akzent ziemlich einwandfrei nachzuahmen.
Anthony ruhte sich auf seinen Rudern aus und blickte über die Schulter hinweg um sich.
»Wie wäre es, wenn wir den alten Schlepper näher untersuchten?«, schlug er vor. »Er sieht doch ganz interessant aus.«
»Der Major hat uns doch gewarnt, es sei gefährlich«, erinnerte ihn Valerie.
»Gerade deswegen habe ich daran gedacht, mir ihn einmal anzusehen.«
»Ziemlich kindliche Reaktion.«
»Unsinn - Major Grant huldigt noch völlig feudalen Anschauungen, und er muss erst einmal lernen, dass er uns nicht herumkommandieren kann, als wären wir seine Leibeigenen oder dergleichen. Wir haben uns immerhin durchgesetzt, indem wir die Jolle nahmen, und wenn wir uns den Schlepper etwas ansehen wollen, werden wir uns durch seine törichten Warnungen ganz bestimmt nicht davon abhalten lassen. Wir sind schließlich keine Kinder mehr.«
»Dem muss ich allerdings zustimmen«, rief Valerie lachend. »Also volle Fahrt voraus auf den Schlepper Gamecock. Was für ein hübscher Name für einen Schlepper!«
Anthony ruderte auf das rostige, verkommene Fahrzeug zu, das vereinsamt an seiner Boje lag, und ging beim Radkasten auf Steuerbord längsseits. Lange Tang-Wedel hingen vom Rad und den Schaufeln herab und bildeten einen dichten Pflanzengürtel rings um den Schiffskörper.
»Wenn das so weitergeht, wird das Schiff noch Wurzeln schlagen«, meinte Anthony, sprang auf die Plattform des Radkastens und belegte die Fangleine an einer Klampe. Dann wandte er sich um und zog Valerie zu sich herauf. »Komm nur. Du könntest in einem Pfaus nicht sicherer sein. Ich verstehe nicht, was sich der Major da in den Kopf gesetzt hat.« Zuerst erforschten sie das Oberdeck; dann blickten sie in die Kombüse mit ihrem verrosteten Pferd und drehten im Ruderhaus an dem Steuerrad aus Teakholz. Danach ging es hinauf auf die Brücke, wo sie den Maschinentelegrafen betätigten und in die Sprachrohre hineinriefen.
»Stell dir nur unseren Schrecken vor, wenn uns eine Geisterstimme mit einem Zu Befehl, Sir antworten würde«, sagte Anthony.
»Oder wenn der Klabautermann mit einem Albatros auf dem Nacken plötzlich auftauchte«, fügte Valerie hinzu. »Das möchte ich wirklich sehen, was du dann tätest.«
»Ich würde ihn das Deck aufwaschen lassen«, erklärte er lachend. »Aber komm jetzt, wir schauen uns mal alles unter Deck an.«
Sie stiegen achtern durch die Lucke hinab und gelangten in eine kleine Messe mit einem zerbrochenen Tisch, ein paar von Grünspan überzogenen Petroleumlampen, die von der Decke hingen, und einer hufeisenförmigen Sitzbank, die der Rundung des Achterschiffs eingepasst, doch ohne Kissen war. In einer Ecke lag unter anderem Zeug eine schmutzige, zerrissene Seekarte zusammen mit einem Nautischen Jahrbuch von 1947 und einer Schrift »Ratschläge für Seeleute«. Der Sonnenschein, der durch das staubige, gesprungene Oberlicht einfiel, schien die Muffigkeit des Ortes noch zu verstärken.
»Hier wäre nicht viel«, meinte Anthony. »Nun möchte ich nur noch wissen, wie es in den Kabinen aussieht.«
Die Kabinen, über deren jeder ein Schildchen Kapitän und Steuermannsmaat befestigt war, lagen am vorderen Ende der Messe, beiderseits des Ganges. Er trat auf der Steuerbordseite in die Kabine des Kapitäns, einen winzigen Raum von ein paar Quadratmetern Fläche, mit einer eingestürzten Koje, einer Sitzbank und einem Kleiderschrank.
»Was für ein trostloser Raum.« Valerie schauderte, obwohl sie sich dagegen wehrte. »Ich wüsste wohl gern... ach, mein Gott!«
Sie unterbrach sich mit einem Schrei, als Anthony die Tür zum Kleiderschrank öffnete. Der Leichnam eines Mädchens, in dessen grünlichblau angelaufenem Gesicht die Augen wie in Todesangst auf gerissen waren, fiel ihnen entgegen und stürzte schlaff zu Boden.
Zweites Kapitel
»Und Sie sind ganz sicher, dass sie tot war?«
»Vollkommen«, erklärte Anthony völlig außer Atem, nachdem er wie ein Wahnsinniger vom Schlepper zurückgerudert war, um ihre Entdeckung mitzuteilen. »Der Leichnam war nicht gerade kalt, aber er fühlte sich doch kühl an und - eben tot.«
»So, so.« Professor Cleghorn spielte mit den Anhängern an seiner Uhrkette. »Irgendwelche Anzeichen von Todesstarre?«
»Ich - nein, das glaube ich nicht.«
»Wie entsetzlich!«, rief Mrs. Cleghorn aus. »Und dass uns dies am ersten Tag unserer Ferien zustoßen muss! Valerie, mein Liebling, was für ein furchtbares Erlebnis für dich.«
»Es war... ja, es war ziemlich scheußlich«, gab Valerie zu, bemüht, zu verbergen, wie sehr diese Entdeckung sie erschüttert hatte. »Es kann ja nichts anderes als Mord sein!«
»Sieht ganz danach aus - und nur eine Stunde oder zwei können seitdem vergangen sein«, bemerkte ihr Vater und nickte. »Haben Sie eine Ahnung, Mrs. Grant, wer das Mädchen sein könnte?«
Helen Grant, die gerade zu den anderen getreten war, als Valerie und Anthony mit ihrer Nachricht eintrafen, sah bleich und entsetzt aus.
»Nicht die geringste«, erklärte sie. »Unsere Köchin Kirstie ist die einzige Frau außer mir auf dieser Insel, und eben noch habe ich sie in der Küche gesehen, wie sie eifrig beim Backen war!«
»Wollen Sie damit sagen, dass es hier keine Familien weiter gibt?«
Helen Grant nickte.
»Wir sind auf Camorach die einzigen Menschen.«
»Wie geheimnisvoll«, bemerkte Joseph Harding. »Man stelle sich nur vor, dass man an einem so einsamen Ort gleich mitten in einen Mord hineinläuft. Mir scheint, wir sollen Gelegenheit erhalten, die britische Polizei im Einsatz zu bewundern.«
»Ja, zuallererst müssen wir die Polizei benachrichtigen«, meinte Cleghorn und nickte. »Haben Sie eine Ahnung, Mrs. Grant, wo Ihr Mann sein könnte?«
»Er ist auf Jagd draußen im Hügelland«, erwiderte Helen Grant hastig. »Er ist gleich nach Ihrer Ankunft hinausgegangen und dürfte wohl jeden Augenblick zurückkommen.«
»Na gut, in seiner Abwesenheit übernehme ich es, die Polizei anzurufen. Haben Sie ein Telefon?«
»Aber natürlich.« Sie lachte nervös auf. »Das ist ja einer der Vorteile, die wir der Luftwaffe verdanken. Sie hat ein Kabel zum Festland verlegt.«
»Gut. Dann rufe ich Invermory an.« Der Professor stapfte in die Halle hinaus, wo der Apparat stand, während die anderen zuhörten, wie er mit seiner klaren, hohen Stimme die wesentlichen Einzelheiten durchgab.
»Ich... es tut mir schrecklich leid, dass dies geschehen ist«, sagte Helen Grant ziemlich verstört. »Es ist ja für alle furchtbar.«
»Es ist nicht Ihre Schuld, Mrs. Grant«, versicherte ihr Harding beruhigend, »und Sie dürfen deswegen nicht zu unglücklieh sein. Natürlich ist es ein tragischer Fall. Aber wir kennen ja die näheren Umstände nicht, und so können wir alles voll und ganz der Polizei überlassen. Zumindest geht es niemand von uns persönlich an.«
»Das stimmt schon«, erklärte Helen, aber ihre Stimme klang ein wenig unsicher, während ihre Finger nervös an ihrer mit Diamanten eingelegten Armbanduhr spielten.
»Immerhin geht es uns insofern an«, warf Mrs. Harding unerwartet ein, »als der Mörder frei auf der Insel umherläuft; und wenn er einmal zuschlagen konnte, so kann er es auch ein zweites Mal!«
»Ach, Liebling, so musst du die Sache nicht ansehen!« Harding sah, dass die Wirkung seiner tröstenden Worte mit schlagartig zunichte gemacht war. »Wir haben keinen Grund zu einer solchen Annahme.«
»Wir haben keinen Grund, irgendetwas anderes anzunehmen«, erklärte seine Frau mit Nachdruck.
»Der Mörder kann sich in einem Boot oder dergleichen davongemacht haben«, wandte er wieder ohne große innere Überzeugung ein, schwieg jedoch unter dem Blick seiner Frau. Dann wurde er nachdenklich. »Na ja, ich gebe zu, wir müssen auch mit dieser Möglichkeit rechnen.«
»Ist das nicht ein geradezu prächtiger Anfang für unsere Ferien!«, rief Mrs. Cleghorn mit spröder Stimme in das lastende Schweigen. »Mit einem Mörder auf einer Insel eingesperrt! Ich habe schon von Anfang an gefürchtet, dass es eine Kateridee war, hierher zu fahren.«
»Inmitten des Lebens stehen wir im Tod«, murmelte plötzlich die nicht mehr ganz junge Miss Gilchrist. Seit Valerie und Anthony atemlos mit ihrer Nachricht hereingeplatzt waren, hatte sie keinen Ton mehr gesagt, wenn auch ihren klaren Vogelaugen nichts entgangen war. Sie schüttelte den Kopf. »In den Sternen steht es geschrieben!«
»Was steht in den Sternen?«, fragte eine Stimme von der Halle her, und alle wandten sich um, als jemand ins Zimmer trat - ein blonder, sonnengebräunter Riese mit starken, blauen Augen. »Ist etwas geschehen?«
»Magnus!« Helen Grant stieß, ohne es zu wollen, einen Seufzer aus und wandte sich mit einem Ausdruck der Erleichterung zu ihm um. »Gott sei Dank, dass Sie da sind!«
»Ist es denn so schlimm?« Er durchquerte den Raum und trat zu ihr. Er trug ein grobes, großkariertes Hemd, das vorn offen war, so dass seine mächtige Brust sichtbar wurde, dazu Seemannshosen und Seemannsstiefel. Sein Auftreten war allerdings allzu selbstsicher und anmaßend. Rasch warf er einen Blick auf die anderen und sah dann wieder Helen an.
»Etwas Entsetzliches, Magnus«, rief sie hastig, die Augen fest auf sein Gesicht gerichtet. »Man hat auf der Gamecock einen Leichnam gefunden! - Ein Mädchen. Sie muss erwürgt worden sein!«
Der Mann zog die breiten Schultern hoch.
»Woher wissen Sie das?«, fragte er.
»Wir haben sie gefunden.« Anthony Stenton löste sich von Valeries Seite und trat vor. »Wir waren an Bord gegangen, um uns ein wenig umzusehen, und sie fiel uns aus dem Schrank in der Kabine des Kapitäns entgegen.«
Magnus fuhr herum und starrte ihn forschend an. Eilig murmelte Helen:
»Magnus McColl... Mr. Stenton... Miss Cleghorn.«
»Erwürgt war sie?«, fragte Magnus McColl, nachdem er zur Begrüßung kurz genickt hatte. »Um wieviel Uhr war denn das?«
»Vor nur einigen Minuten. Wir ruderten sofort zurück, nachdem wir uns vergewissert hatten, dass sie tot war.«
»Wo ist der Major?« Er wandte sich Helen wieder zu.
»Draußen in den Hügeln auf der Jagd«, erwiderte sie und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen.
»Ich habe einen oder zwei Schüsse gehört.« Er nickte, runzelte die Stirn und schritt zur Tür. »Der Sache muss ich gleich nachgehen.«
Im nächsten Augenblick stand jedoch der kleine Professor Cleghorn vor ihm, der ihn mit leichter Neugier betrachtete.
»Sie dürfen bis zum Eintreffen der Polizei nichts unternehmen.« Der Professor sah wie ein etwas ältlicher David gegenüber einem jungen Goliath aus. »Sie ist jetzt von Invermory unterwegs.«
McColl blickte von seiner überragenden Höhe auf ihn nieder.
»Aber ich muss mich vergewissern. Die ganze Geschichte klingt mir äußerst unglaubwürdig.« Er hatte eine tiefe, angenehme Stimme mit jenem gewissen melodiösen Tonfall, wie man ihn im westlichen Hochland häufig antrifft.
»Die Tatsache, dass meine Tochter und ihr Freund beide den Leichnam gesehen haben, dürfte als Bestätigung wohl genügen«, erklärte Cleghorn ruhig. Seine blecherne Stimme stand in seltsamem Gegensatz zu der mächtigen Stimme des anderen. »Niemand darf das Schiff betreten. Es könnte dadurch wertvolles Beweismaterial verloren gehen. Ich habe der Polizei zugesichert, dafür zu sorgen.«
Einen Augenblick lang sah es so aus, als wolle Magnus McColl ihn zur Seite drängen. Dann zögerte er, zuckte mit den Schultern und lachte kurz auf.
»Die Maschinerie der Bürokratie läuft also bereits.«
»Sie mögen unsere Beamten nicht, Mr. McColl?«
Die scharfen blauen Augen betrachteten den Professor abschätzend.
»Ich hasse sie«, erklärte er kategorisch.
»Bis zu einem gewissen Grad bin ich mit Ihnen da einig«, erklärte Cleghorn bedächtig. »Aber sie hat auch ihre Vorteile, wissen Sie, vor allem, wenn man von vornherein alle Übergriffe unmöglich macht.«
»Na gut, ich werde mich also von der Gamecock fernhalten, bis Ihre Polizisten alles ordentlich durcheinandergebracht haben.«
Professor Cleghorn rieb sich die Hände und blickte ihm nach, während McColl mit seinem schwingenden Seemannsgang aus dem Hause schritt.
»Echtes Wikingerblut«, murmelte er. »Wahrscheinlich gehörten seine Vorfahren zu denen, die 1263 die Inseln unter König Haakon überfallen und ausgeplündert haben. Er ist ein typischer Vertreter jener Rasse. Sehr interessant. Ich frage mich, ob...«
»Robert!«
»Ach, entschuldige, meine Liebe. Ja, natürlich. Nun, die Polizei ist unterwegs, und als guten Bürgern bleibt uns nichts anderes übrig, als sitzenzubleiben und ihre Ankunft abzuwarten.« Er warf einen Blick zum Fenster hinaus. Draußen sah man nun Magnus McColl auf der Pier stehen und zum alten Schlepper hinübersehen. »Wer ist das eigentlich?«
»Wer? - Magnus?« Helen Grant fuhr auf und musste sich erst sammeln. »Er - ach, er arbeitet für meinen Mann.«
»Ich hätte gedacht, dass der für niemand arbeitet.« Cleghorn zog verwundert die Augenbrauen hoch. »Das ist doch ein Seeräuber aus den nordischen Sagen, wie er leibt und lebt, der noch niemals etwas von einer Uhr oder von unserer Zeit gehört hat.«
»Tatsächlich, Sie haben damit den Nagel ziemlich genau auf den Kopf getroffen«, rief Helen und lachte etwas sonderbar auf. »Er ist Künstler und lebt allein auf dem Fischerboot dort drüben«, sie deutete auf einen geteerten Kutter, wie er für Loch Fyne charakteristisch war, der etwa in der Mitte der Bucht vor Anker lag. »Er hilft meinem Mann, die Kelpie zu fahren, aber wie Sie ganz richtig erkannten, ist er völlig unberechenbar und arbeitet nur, wenn er Lust hat. Seltsamerweise aber versteht er sich ausgezeichnet auf Maschinen. Da ist er ein Zauberer.«
»Hat also das alte ehrliche Rahsegel seiner Vorfahren gegen die geheimnisvolle Verbrennungsmaschine ausgetauscht. Ich bin sehr gespannt, diesen Künstler und genialen Techniker noch näher kennenzulernen. Eine ganz ungewöhnliche Verbindung.«
»Da kommt ja auch mein Mann!«, rief Helen plötzlich aus, als Major Grant mit einem vollgestopften Jagdrucksack und einer Doppelflinte am Fenster vorbeikam. Sie stürzte hinaus, um ihn zu empfangen.
»Ein gutaussehendes Paar«, meinte Cleghorn, während er langsam zum Fenster hinüberging und beobachtete, wie Helen auf der Terrasse dem Major in aller Hast berichtete. Grant hatte den Rucksack von seiner Schulter gleiten lassen und lauschte ihr ungläubig.
»Eine prächtige Frau«, sagte Harding und nickte. Der Professor blickte fragend auf, denn es berührte ihn sonderbar, dass Harding so betont nur von ihr sprach. Der Amerikaner zögerte, begegnete jedoch dem Blick des anderen und fuhr dann in seinem näselnden Ton bedächtig fort: »Sie werden bald verstehen, was ich meine. Sie ist hier diejenige, die den Kopf hat. Vielleicht ist es unter der Würde eines Grundherrn des Hochlandes, sich um seine Pensionsgäste zu bemühen. Das könnte mir an sich gleichgültig sein. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass Helen die einzige ist, die sich hier um alles kümmert und sich dabei zu Tode rackert.«
»Sie kommen auch nicht gut miteinander aus, Professor«, fügte Mrs. Harding mit leiser Stimme hinzu. »Er behandelt sie ganz einfach schändlich.«
»Ach, du lieber Gott«, seufzte Cleghorn. »Ich dachte, hier sei alles so idyllisch, und kaum sind wir an Land, haben wir es bereits mit einem Mord zu tun und sehen uns unglücklichen Familienverhältnissen gegenüber. Wenn mir diese Insel gehörte, ich würde meiner Frau bestimmt niemals ein böses Wort sagen!«
»Ich bin überzeugt, das tun Sie überhaupt nie, Professor«, meinte Mrs. Harding und strahlte ihn an.
»Urteilen Sie nicht nach dem äußeren Schein. Im Privatleben kann ich ja der reine Teufel sein. Fragen Sie nur meine Frau.« Er lächelte und wandte sich mit den anderen um, da Major Grant gerade das Zimmer betrat.
»Das ist ja etwas ganz Entsetzliches!«, rief Grant aus. Er sah verstört und völlig ratlos aus. »Ich kann es einfach nicht verstehen. Wir sind die einzigen Menschen auf der Insel, und doch sagen Sie, dass auf der Gamecock die Leiche eines Mädchens liegt. War wohl ein ziemlich schwerer Schock für Sie? Aber ich hatte Sie ja auch davor gewarnt, den Schlepper zu betreten.«
»Andererseits war es doch gut, dass wir an Bord gegangen sind!«, rief Anthony aus. »Sonst hätten ja noch Monate darüber verstreichen können, bevor man den Leichnam entdeckt hätte.«
»Ja, das ist natürlich ein Gesichtspunkt, der begründet ist.« Der Major zündete sich eine Zigarette an und blickte dann seine Gäste an. »Nun, ich kann nur sagen, es tut mir unendlich leid, dass dies geschehen ist. Ich nehme an, es wird allerlei Unannehmlichkeiten mit der Polizei geben, aber ich hoffe zumindest, dass dies Ihnen die Ferien nicht verdirbt. Im Übrigen weiß ich, dass mir jetzt etwas guttun würde - und auch die jungen Leute sehen so aus, als könnte ihnen eine Herzstärkung nicht schaden... Helen, wo ist der Whisky...? Und bring dann auch gleich etwas weniger Starkes für Miss Gilchrist.«
»Whisky mag ich nicht«, erklärte Valerie.
»Aber er wird Ihnen guttun.«
»Nein, ich brauche wirklich nichts...«
Sie ließ sich schließlich zu einem Glas Sherry überreden. Grant goss sich aus der Whiskyflasche ein Glas ein, das man als einen verdoppelten Doppelten hätte bezeichnen können, während die anderen je nach Geschmack eingeschenkt erhielten. Als sie dann alle vor ihren Gläsern saßen, fragte der Major Valerie und Anthony über ihren Fund aus, konnte sich jedoch niemand vorstellen, der der Beschreibung des toten Mädchens entsprochen hätte.
»Aber wie in aller Welt ist sie denn an Bord des Schleppers gelangt?«, rief er aus und blickte mit gefurchter Stirn in sein Glas. »Und wie ist ihr Mörder denn entkommen? Uns ist nichts davon bekannt, dass Fremde auf der Insel waren.«
»Und ebenso bedeutsam«, warf Professor Cleghorn ein, »ist doch die Tatsache, dass das arme Mädchen in einem Boot dorthin gebracht worden sein muss. Es wäre doch gewiss leichter gewesen, sie ganz einfach draußen im Sund über Bord zu stoßen, als sich all die Mühe zu machen und das Risiko auf sich zu nehmen, dass sie auf dem Schlepper entdeckt wird. Ich komme damit nicht ins Reine.«
»Ich auch nicht«, nickte Grant. »Aber darüber kann sich ja dann die Polizei den Kopf zerbrechen. Wir wollen uns so weit wie nur möglich aus der Sache heraushalten.«
»Das wird in Anbetracht dessen, dass die beiden jungen Leute den Leichnam fanden, nicht so leicht sein.« Der Professor krümmte den Rücken und blickte wie ein kleiner Junge um sich, der in Gesellschaft Erwachsener einen Streich im Schilde hat. »Ich persönlich sehe voller Erwartung der Gelegenheit entgegen, bei einer Morduntersuchung einen der besten Plätze innezuhaben. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich, wenn auch auf Entfernung, überhaupt mit dergleichen zu tun bekomme.«
»Aber Robert! Wie kannst du denn so reden?« Seine Frau reagierte ganz wie erwartet. »Wie kann man denn nur etwas so Herzloses sagen. Denk doch an das arme Mädchen, das nun tot dort draußen liegt.«
»Das tue ich auch; und deswegen interessiere ich mich auch dafür, wie man ihren Mörder finden wird«, erklärte er sanft.
»Und überdies ist sie tot, das arme Ding, und nichts, was ich sage, kann sie jetzt noch berühren. Ich bin sicher, dass ich nur ausgesprochen habe, was alle anderen denken.« Er wandte sich Grant zu, der sich gerade von neuem Whisky einschenkte: »Interessieren Sie sich für Verbrechen, Major? Ich meine, in einem völlig akademischen Sinn?«
»Nein - nicht besonders.« Grant lehnte sich gegen die geschnitzte Anrichte aus Eichenholz und blickte wieder mit gefurchter Stirn in sein Glas. »Ich habe zu viel damit zu tun, meinen Besitz über Wasser zu halten, als dass ich mich um dergleichen kümmern könnte.« Dann blickte er jäh auf, und es zuckte um seinen Mund: »Warum bitten Sie nicht Miss Gilchrist, ein Horoskop oder etwas ähnliches auszuarbeiten? Vielleicht könnte sie Ihnen noch vor Ankunft der Polizei die richtige Antwort geben!«
»Miss Gilchrist?« Aller Augen wandten sich der schlanken alten Dame zu, die hochaufgerichtet in einem Sessel am Fenster saß und ganz ruhig strickte. »Würden Sie...?«
»Natürlich wird sie«, fuhr der Major fort, als sie ihre Nadeln niederlegte. »Sie ist eine richtige alte Wahrsagerin. Vor ein paar hundert Jahren hätte man sie auf einem Scheiterhaufen als Hexe verbrannt. Los, Miss Gilchrist, können Sie nicht etwas in der Angelegenheit tun?«
Die alte Dame nahm mit einer energischen Bewegung einen Schluck von ihrem Orangensaft, bevor sie erwiderte: »Das ist keine Angelegenheit zum Scherzen, Major Grant.«
»Aber ich bin ja todernst.«
»Haben Sie wirklich das zweite Gesicht?«, rief Mrs. Harding aus und wandte sich ihr mit plötzlichem Interesse zu. »Ich habe mir so sehr gewünscht, während ich in Europa bin, jemand zu begegnen, der es hat. Nein, ist das nicht wirklich wunderbar?«
»Ich besitze einige außergewöhnliche seelische Fähigkeiten«, gab Miss Gilchrist vorsichtig zu, »und ich interessiere mich sehr für das Okkulte. Das bedeutet jedoch nicht Schwarze Magie und Satanskult«, dabei blickte sie Major Grant anzüglich an, »keinen solchen Unsinn wie Voraussagen der Zukunft und Handleserei.«
»Glauben Sie, Sie könnten den Mörder mit Hilfe des Okkulten finden?«, fragte Mrs. Harding.
»Nein.« Wieder klirrten Miss Gilchrists Nadeln. »Hätte ich genügende Angaben über das tote Mädchen, einschließlich der genauen Stunde ihrer Geburt, könnte ich etwas über ihr Leben und über die Menschen, mit denen sie zusammenkam, aussagen. Wenn jedoch die Polizei ihre Identität feststellt, bin ich überzeugt, dass sie das alles selbst herausfindet, und außerdem möchte ich mit etwas so Traurigem nichts zu tun haben.«
»Wenn es ihr jedoch nicht gelingt?«, fuhr Mrs. Harding hartnäckig fort.
Miss Gilchrist lehnte es jedoch ab, sich auf eine so fragwürdige Angelegenheit einzulassen, und man begann bereits, sich etwas zu langweilen, als endlich ein Motorboot in Sicht kam, das gerade um die Nordspitze der Insel herumschoss und Kurs auf die Pier nahm.
»Die Polizei«, sagte Major Grant und betrachtete die drei uniformierten Gestalten, einen Mann in Zivil und Sandy Duncan, den Bootsverleiher aus Invermory, am Steuer. »Sie scheinen gleich mit einem kräftigen Aufgebot zu kommen.« Er ging zur Tür, wandte sich dann jedoch zu Valerie und Anthony um. »Es ist wohl besser, Sie beide kommen gleich mit. Man wird Sie als erste verhören wollen.«
Unauffällig schloss sich Professor Cleghorn der Gruppe an und schob seinen Arm unter den seiner Tochter, während sie zur Pier hinabgingen.
»Sie werden auch mich sprechen wollen, weil ich es gemeldet habe«, sagte er leise zu ihr, und sie nickte und drückte dabei ein wenig seinen Arm vor Erregung. Sie war froh, dass er bei ihr war.
Ein Polizeiinspektor erhob sich und grüßte sie, als sich das Motorboot der Pier näherte.
»Guten Tag, Major Grant. Wir erhielten telefonisch Meldung über einen Leichenfund an Bord der Gamecock.«
»Stimmt, Inspektor Forbes. Zwei meiner Gäste haben sie gefunden.«
»Sind sie da?... Gut. Kommen Sie an Bord, die Einzelheiten können wir dann auf der Fahrt hinüber besprechen. Es muss nur alles schnell gehen.«
Inspektor Forbes, ein kräftiger Mann von ungefähr vierzig Jahren mit grauem Haar und kurzgestutztem Schnurrbart, erweckte den Eindruck, als sei er auf jeden Fall Herr der Lage. Als das Motorboot von der Pier wegscherte, stellte er schnell die anderen vor: Dr. Anderson, den Polizeiarzt, Oberwachtmeister Keith und Wachtmeister McKillop, und machte sich dann gleich an die Arbeit.
»Nun, Mr. Stenton, schildern Sie kurz die näheren Umstände. Mit den Einzelheiten befassen wir uns später.«
Anthony wiederholte in Umrissen, wie sie die Leiche gefunden hatten, während Valerie zustimmend nickte.
»Wie spät war es?«
»Ich muss leider zugeben, dass wir das nicht genau festgestellt haben«, sagte er, während Sandy Duncan die Fahrt herabsetzte und das Boot am Radkasten auf Steuerbord des Schleppers längsseits brachte. »Es muss so etwa gegen fünf Uhr gewesen sein.«
»Es war fünf Minuten nach fünf, als ihr mit der Nachricht ins Haus gestürzt kamt«, half Professor Cleghorn nach, »und einige Minuten später habe ich dann Invermory angerufen.«
»Ihr Anruf erreichte uns elf Minuten nach fünf«, bestätigte der Inspektor und nickte. »Das mag einstweilen als Zeitpunkt genügen.«
Er trat, noch während er sprach, auf das Dollbord und schwang sich an Deck des Schleppers. Valerie und Anthony folgten ihm zusammen mit dem Arzt und dem Oberwachtmeister. Die anderen wurden angewiesen, im Motorboot zu bleiben.
»Nun gehen Sie voraus, junger Mann«, sagte er zu Anthony.
Nacheinander stiegen sie achtern die Treppe hinab, wobei der beleibte Oberwachtmeister Keith noch von der Anstrengung, an Bord zu gelangen, schnaufte und Valerie nur zögernd als letzte folgte. Sie wollte wohl dabei sein und schrak doch instinktiv davor zurück, die armselige, verzerrte Gestalt mit dem verfärbten Gesicht noch einmal sehen zu müssen. Ihr Herz schlug schmerzhaft, aber sie riss all ihre Energie zusammen.
Anthony erfüllten ganz ähnliche Gefühle, jedoch hätte ihn nichts dazu verleiten können, sie zu verraten. Er konnte sich vor Valerie keine Blöße geben und war entschlossen, sich so aufzuführen, als mache es ihm nichts aus, gelegentlich auch einmal mit einem Mord zu tun zu haben.
»Hier wären wir, Inspektor«, sagte er unnötig laut, stieß die Kabinentür auf und trat zur Seite. »Wir waren... du lieber Gott!«
»Was ist denn los?« Inspektor Forbes war ihm hart auf den Fersen gefolgt.
Anthony blickte völlig verwirrt in der Kabine umher. »Die Leiche... Sie ist verschwunden!«, stieß er hervor.
Forbes drängte sich an ihm vorbei und blickte in aller Eile forschend um sich. Dann riss er die Tür des Kleiderschrankes auf. Er war leer, mit Ausnahme einer alten Socke, die in einer Ecke lag. Einen Augenblick starrte er hinein und wandte sich dann wieder heftig Anthony zu.
»Wie kann sie verschwunden sein?«, fragte er.
»Wie soll denn ich das wissen?« Anthony empfand diese Frage als äußerst ungerechtfertigt. »Als wir gingen, lag die Leiche hier am Boden, so wie sie aus dem Schrank gestürzt war - und die Schranktür stand offen.«
»Mir scheint, ich habe mir meinen Samstagabend nur wegen eines Narrenstreiches verderben lassen«, bemerkte Dr. Anderson, ein schmächtiger, nüchtern aussehender Mann, bissig.
Inspektor Forbes sah Anthony scharf an.
»Das ist doch nicht etwa ein übler Studentenulk, Mr. Stenton?«, fragte er.
»Guter Gott, nein!« Vor Empörung schoss Anthony das Blut ins Gesicht. »Ich sage Ihnen doch, das tote Mädchen war da! Ich habe es berührt - und gesehen.«
»Wir beide haben sie gesehen«, rief Valerie und drängte sich an der unförmigen Gestalt des Oberwachtmeisters Keith vorbei, der mit der Mächtigkeit eines gewaltigen Götzenbildes den Eingang blockierte. »Es würde uns doch im Traum nicht einfallen, eine solche Geschichte zu erfinden, und auf unsere Beobachtung können wir uns verlassen!«
Die scharfen grauen Augen des Inspektors ruhten einen Augenblick durchbohrend auf den beiden. Dann nahm er eine Taschenlampe aus seiner Tasche, hockte sich nieder und begann das Innere des Schrankes sorgfältig zu untersuchen. Brummend richtete er sich wieder auf.
»Etwas muss vor kurzem hier noch verstaut gewesen sein«, erklärte er und wandte sich dem Oberwachtmeister zu. »Durchsuchen Sie das ganze Schiff. Lassen Sie sich von Wachtmeister McKillop dabei helfen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ein Leichnam, der ganz von allein verschwindet... da geht es immerhin nicht ganz mit rechten Dingen zu.«
»Also glauben Sie uns jetzt?«, fragte Anthony in kriegerischem Ton, als sich der Oberwachtmeister davontrollte.