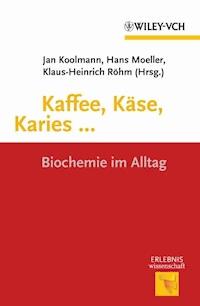
Kaffee, Käse, Karies ... E-Book
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Erlebnis Wissenschaft
- Sprache: Deutsch
What is the kick we get from our morning cup of coffee or tea and why are we attracted by the smell of spices or perfume? How do the holes get in the cheese and why should you not clean your teeth after drinking a glass of wine?
The authors have succeeded in explaining everyday objects in a scientific way to reveal hidden biochemical processes. This informative and richly illustrated book solves commonplace riddles in a readily comprehensible and entertaining manner, which you would probably not associate with biochemistry.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema
Froböse, R. Wenn Frösche vom Himmel fallenDie verrücktesten Naturphänomene253 Seiten 2007 Broschur ISBN: 978-3-527-32619-8
Voss-de Haan, P. Physik auf der SpurKriminaltechnik heute316 Seiten mit 58 Abbildungen 2005 Broschur ISBN: 978-3-527-40944-0
Emsley, J. Fritten, Fett und FaltencremeNoch mehr Chemie im Alltag285 Seiten 2004 Broschur ISBN: 978-3-527-32620-4
Bell, H. P., Feuerstein, T., Güntner, C. E., Hölsken, S., Lohmann, J. K. (Hrsg.) What‘s Cooking in Chemistry?How Leading Chemists Succeed in the Kitchen243 Seiten mit 149 Abbildungen 2003 Broschur ISBN: 978-3-527-32621-1
Herausgeber
Prof. Dr. Jan KoolmanInstitut für Physiologische Chemie Biochememische Endokrinologie Deutschhausstraße 1-2 35037 Marburg
Prof. Dr. Hans MoellerUniversitäts-Kinderklinik Rümelinstraße 72070 Tübingen
Prof. Dr. K.-H. RöhmInstitut für Physiologische Chemie Universität Marburg Karl-von-Frisch-Straße 1 35043 Marburg
Die Boxen wurden von T. Brandt, E. Hedderich, J. Koolman und K. Stegmann geschrieben. Timo Ulrichs hat die Grafik gestaltet, die chemischen Formeln hat K.-H. Röhm gestaltet.
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
ISBN: 978-3-527-32622-8 ePDF ISBN: 978-3-527-62848-3 ePub ISBN: 978-3-527-64110-9 mobi ISBN: 978-3-527-64111-6
Vorwort
Der Mensch gestaltet Alltag und Umfeld mit vielfältigen biochemischen Prozessen: vom Kochen und Backen bis zur Körperhygiene, von der Brauerei, der Käseherstellung bis hin zur Abwassertechnik. All dies sind wichtige Kulturtechniken. Viele haben eine lange Geschichte und sind untrennbar mit der Entstehung von Hochkulturen verbunden, z. B. die Ledergewinnung oder der Weinbau. Die meisten dieser Verfahren sind durch handwerkliche Erfahrung entstanden, wurden aber vielfach in unserem Jahrhundert durch die biochemischen Wissenschaften theoretisch begründet und teilweise auch in der Praxis verbessert.
Diese Biochemie im Alltag“ war das Thema eines Kompaktseminars für 26 Studierende der Biochemie, Chemie, Humanbiologie, Medizin und der Physik – einige sind inzwischen promoviert – zusammen mit drei Dozenten im Sport- und Studienheim der Universität Marburg im Kleinwalsertal.
Ziel des einwöchigen Seminars war es, Wissenschaft fachübergreifend zu erarbeiten und verständlich darzustellen. Die Studierenden behandelten in Referaten ausgewählte Techniken und Verfahren, in denen Biochemie im Alltag angewandt wird. Die Auswahl der Themen war willkürlich und folgte den Interessen der Teilnehmer.
Am Ende des Seminars beschlossen die Teilnehmer unerwartet, die Referate als Buch zu veröffentlichen. Es folgte ein beschwerlicher Weg des Schreibens und Überarbeitens. Die Redaktionsarbeit lag hauptsächlich bei den Studierenden. Sie bestimmten den Charakter des Buches, der unter anderem dadurch geprägt ist, daß die Individualität der Beiträge der einzelnen Autoren erhalten blieb.
Wir Dozenten sehen in diesem Buch das Ergebnis akademischer Lehre, wie wir sie uns wünschen, aber nicht als Regelfall erwarten können: ergebnisorientiert und realitätsbezogen, aber auch neugierig, kreativ und mit Freude an der Sache. Deshalb möchten wir danken:
den studentischen Autoren, die freiwillig umfangreiche Arbeit in das Ausarbeiten der Referate und Schreiben ihrer Beiträge gesteckt haben und geduldig Änderungen ihrer Werke ertrugen,dem studentischen Redaktionskomitee für die engagierte und kompetente Arbeit. Viel häufiger als vorausgesehen saß der Teufel zäh im Detail und mußte dort mühselig aufgespürt und entfernt werden.dem studentischen Zeichner Timo Ulrichs für seine grafische Interpretation der wissenschaftlichen Texte,dem Fachbereich Humanmedizin der Philipps-Universität Marburg (und damit dem Steuerzahler) für den finanziellen Zuschuß, der den Studierenden die Teilnahme am Seminar erleichtert hat.Marburg und Tübingen, im Dezember 1997
Jan Koolman, Hans Moeller und Klaus-Heinrich Röhm
Im Anfang war …
… das Gewürz. Seit die Römer bei ihren Fahrten und Kriegen zum erstenmal an den brennenden oder betäubenden, den beizenden oder berauschenden Ingredienzien des Morgenlandes Geschmack gefunden, kann und will das Abendland die especeria“, die indischen Spezereien, in Küche und Keller nicht mehr missen. Denn unvorstellbar schal und kahl bleibt bis tief ins Mittelalter die nordische Kost. Noch lange wird es dauern, ehe die heute gebräuchlichsten Feldfrüchte wie Kartoffel, Mais und Tomate in Europa dauerndes Heimrecht finden, noch nützt man kaum die Zitrone zum Säuern, den Zucker zur Süßung, noch sind die feinen Tonika des Kaffees, des Tees nicht entdeckt; selbst bei Fürsten und Vornehmen täuscht stumpfe Vielfresserei über die geistlose Monotonie der Mahlzeiten hinweg. Aber wunderbar: bloβ ein einziges Korn indischen Gewürzes, ein paar Stäubchen Pfeffer, eine trockene Muskatblüte, eine Messerspitze Ingwer oder Zimt dem gröbsten Gerichte zugemischt, und schon spürt der geschmeichelte Gaumen fremden und schmackhaft erregenden Reiz. Zwischen dem krassen Dur und Moll von Sauer und Süß, von Scharf und Schal schwingen mit einmal köstliche kulinarische Obertöne und Zwischentöne; sehr bald können die noch barbarischen Geschmacksnerven des Mittelalters an diesen neuen Incitantien nicht genug bekommen. Eine Speise gilt erst dann als richtig, wenn toll überpfeffert und kraß überbeizt; selbst ins Bier wirft man Ingwer, und den Wein hitzt man derart mit zerstoßenem Gewürz, bis jeder Schluck wie Schießpulver in der Kehle brennt. Aber nicht nur für die Küche allein benötigt das Abendland so gewaltige Mengen der especeria“; auch die weibliche Eitelkeit fordert immer mehr von den Wohlgerüchen Arabiens und immer neue, den geilen Moschus, das schwüle Ambra, das süße Rosenöl, Weber und Färber müssen chinesische Seiden und indische Damaste für sie verarbeiten, Goldschmiede die weißen Perlen von Ceylon und die bläulichen Diamanten aus Narsingar ersteigern. Noch gewaltiger fördert die katholische Kirche den Verbrauch orientalischer Produkte, denn keines der Milliarden und Abermilliarden Weihrauchkörner, die in den tausend und abertausenden Kirchen Europas der Mesner im Räucherfasse schwingt, ist auf europäischer Erde gewachsen; jedes einzelne dieser Milliarden und Abermilliarden muß zu Schiff und zu Lande den ganzen unübersehbaren Weg aus Arabien gefrachtet werden. Auch die Apotheker sind ständige Kunden der vielgerühmten indischen Specifica, als da sind Opium, Kampfer, das kostbare Gummiharz, und sie wissen aus guter Erfahrung, daß längst kein Balsam und keine Droge den Kranken wahrhaft heilkräftig erscheinen will, wenn nicht auf dem porzellanenen Tiegel mit blauen Lettern das magische Wort arabicum“ oder indicum“ zu lesen ist. Unaufhaltsam hat durch seine Abseitigkeit, seine Rarität und Exotik und vielleicht auch durch seine Teuernis alles Orientalische für Europa einen suggestiven, einen hypnotischen Reiz gewonnen.
aus: Stefan Zweig (1995) Magellan, der Mann und seine Tat. S. Fischer Verlag, Frankfurt/M.
Inhaltsverzeichnis
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























