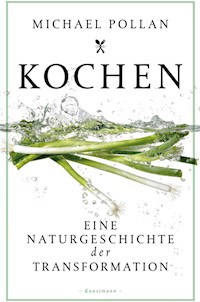22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Drei psychoaktive Pflanzen – Kaffee, Schlafmohn und Peyote-Kaktus –, die uns beleben, beruhigen oder unser Bewusstsein verändern, erkundet Michael Pollan in diesem spannenden Buch: ihre Kultur, ihre Wirkung und die Tabus, mit denen sie behaftet sind. Von allem, was Pflanzen den Menschen zur Verfügung stellen – Nahrung, Medizin, Duft, Geschmack, Schönheit –, ist sicher das Kurioseste, dass wir sie nutzen, um unser Bewusstsein zu verändern: es anzuregen, zu beruhigen oder den Zustand unserer mentalen Erfahrung komplett zu verändern. Pollan erkundet drei sehr verschiedene psychoaktive Pflanzen – Kaffee/Koffein, Schlafmohn/Opium und den Peyote-Kaktus/Meskalin – und macht dabei klar, wie überaus seltsam ihre jeweilige Wirkung wahrgenommen, eingeschätzt und beurteilt wird. Die besondere Kultur, die sich um jede dieser Pflanzen gebildet hat, erforscht er unter anderem, indem er sie konsumiert (oder, im Fall von Kaffee, versucht, nicht zu konsumieren). Er erzählt von der enormen Anziehungskraft, die psychoaktive Pflanzen in allen Kulturen auf Menschen hatten und haben, und von den mächtigen Tabus, die mit ihnen verbunden sind. Grandios verbindet Pollan Geschichte, Naturwissenschaft, Memoir und Reportage und stellt den Diskurs über Drogen damit in ein völlig neues Licht. Über diese Pflanzen gibt es sehr viel mehr zu sagen, als nur ihre Regulierung zu debattieren. Denn wenn wir sie in unseren Körper aufnehmen und sie unser Bewusstsein verändern lassen, sind wir zutiefst mit der Natur verbunden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
Drei psychoaktive Pflanzen – Kaffee, Schlafmohn und Peyote-Kaktus –, die uns beleben, beruhigen oder unser Bewusstsein verändern, erkundet Michael Pollan in diesem spannenden Buch: ihre Kultur, ihre Wirkung und die Tabus, mit denen sie behaftet sind.
Von allem, was Pflanzen den Menschen zur Verfügung stellen – Nahrung, Medizin, Duft, Geschmack, Schönheit –, ist sicher das Kurioseste, dass wir sie nutzen, um unser Bewusstsein zu verändern: es anzuregen, zu beruhigen oder den Zustand unserer mentalen Erfahrung komplett zu verändern. Pollan erkundet drei sehr verschiedene psychoaktive Pflanzen – Kaffee/Koffein, Schlafmohn/Opium und den Peyote-Kaktus/Meskalin – und macht dabei klar, wie überaus seltsam ihre jeweilige Wirkung wahrgenommen, eingeschätzt und beurteilt wird. Die besondere Kultur, die sich um jede dieser Pflanzen gebildet hat, erforscht er unter anderem, indem er sie konsumiert (oder, im Fall von Kaffee, versucht, nicht zu konsumieren). Er erzählt von der enormen Anziehungskraft, die psychoaktive Pflanzen in allen Kulturen auf Menschen hatten und haben, und von den mächtigen Tabus, die mit ihnen verbunden sind. Grandios verbindet Pollan Geschichte, Naturwissenschaft, Memoir und Reportage und stellt den Diskurs über Drogen damit in ein völlig neues Licht. Über diese Pflanzen gibt es sehr viel mehr zu sagen, als nur ihre Regulierung zu debattieren. Denn wenn wir sie in unseren K örper aufnehmen und sie unser Bewusstsein verändern lassen, sind wir zutiefst mit der Natur verbunden.
Über den Autor
Michael Pollan, geboren 1955 auf Long Island, ist ein vielfach ausgezeichneter Journalist und Professor an der Berkeley Graduate School of Journalism der University of California, Berkeley. Er hat mehrere Sachbücher geschrieben, Kochen – eine Naturgeschichte der Transformation wurde 2015 von Bild der Wissenschaft als Wissensbuch des Jahres ausgezeichnet und von Netflix als vierteilige Serie unter dem Titel Cooked verfilmt. Zuletzt erschien Verändere dein Bewusstsein (2019).
MICHAEL POLLAN
KAFFEEMOHNKAKTUS
EINE KULTURGESCHICHTEPSYCHOAKTIVER PFLANZEN
Aus dem Englischen vonThomas Gunkel
Verlag Antje Kunstmann
INHALT
Einführung
KAFFEE
MOHN
KAKTUS
Dank
Fußnoten
Auswahlbibliografie
Index
EINFÜHRUNG
Von den vielen Bereichen, in denen Menschen auf Pflanzen zurückgreifen – Ernährung, Schönheit, Medizin, Parfüm, Geschmack, Kleidung –, ist ihr Gebrauch zur Bewusstseinsveränderung sicherlich der seltsamste: zur Anregung oder Beruhigung, zur Manipulation oder vollständigen Veränderung unserer geistigen Erfahrungen. Wie die meisten Menschen gebrauche ich Tag für Tag etliche Pflanzen auf diese Weise. Jeden Morgen beginne ich meinen Tag unweigerlich mit dem Heißwasseraufguss einer von zwei Pflanzen, von denen ich abhängig bin (und das ist keine Übertreibung), um den geistigen Nebel zu lichten, meine Konzentration zu schärfen und mich auf den vor mir liegenden Tag einzustellen. Gewöhnlich betrachten wir Koffein nicht als Droge und unseren täglichen Konsum nicht als Abhängigkeit, doch das liegt nur daran, dass Kaffee und Tee legal sind und unsere Sucht gesellschaftlich akzeptiert ist. Doch was ist dann eigentlich eine Droge? Und warum ist es erlaubt, aus den Blättern von Camellia sinensis Tee zuzubereiten, während das Gleiche mit den Samenkapseln von Papaver somniferum, wie ich unter Gefahr feststellen musste, eine Straftat ist?
Jeder, der eine handfeste Definition von Drogen erstellen will, muss letztlich scheitern. Ist Hühnersuppe eine Droge? Wie steht es mit Zucker? Künstlichen Süßstoffen? Kamillentee? Oder mit einem Placebo? Wenn wir eine Droge nur als etwas definieren, das nach der Einnahme eine Veränderung bewirkt, sei es in Körper oder Geist (oder bei-dem), dann kommen wohl all diese Stoffe infrage. Aber müssten wir nicht imstande sein, Nahrungsmittel von Drogen zu unterscheiden? Angesichts dieses Dilemmas zieht sich die Arzneimittelzulassungsbehörde FDA damit aus der Affäre, dass sie Drogen in einer Zirkeldefinition als »Stoffe außer Nahrungsmitteln« bezeichnet, die in der amtlichen Arzneimittelliste, das heißt seitens der FDA, als Drogen eingestuft sind. Keine große Hilfe.
Das Ganze wird auch nicht viel klarer, wenn das Attribut »illegal« hinzukommt: Eine illegale Droge ist etwas, das die Regierung dazu erklärt. Es kann kein Zufall sein, dass davon fast ausschließlich Stoffe betroffen sind, die das menschliche Bewusstsein verändern können. Oder vielleicht sollte ich eher sagen, die das menschliche Bewusstsein derart verändern können, dass es den reibungslosen gesellschaftlichen Abläufen und den Interessen der Mächtigen zuwiderläuft. Kaffee und Tee zum Beispiel, die ihren Nutzen für den Kapitalismus in vielerlei Hinsicht sattsam unter Beweis gestellt haben, nicht zuletzt, weil sie uns zu leistungsfähigeren Arbeitern machen, laufen keine Gefahr, verboten zu werden, während Psychedelika – die nicht giftiger sind als Koffein und bei Weitem nicht so abhängig machen – seit Mitte der 1960er-Jahre, zumindest in der westlichen Welt, als Bedrohung der gesellschaftlichen Normen und Bräuche betrachtet werden.
Doch auch diese Einstufungen sind nicht so unerschütterlich wie man glauben könnte. Zu unterschiedlichen Zeiten haben die Behörden der arabischen Welt und Europas den Kaffee verboten, weil sie die Menschen, die sich versammelten, um ihn zu trinken, als politisch bedrohlich empfanden. Während ich diese Zeilen schreibe, scheinen Psychedelika gerade einen Identitätswechsel zu durchlaufen. Da die Forschung nachgewiesen hat, dass Psilocybin bei der Behandlung psychischer Krankheiten nützlich sein kann, dürften manche Psychedelika schon bald von der FDA als Arzneien zugelassen werden: Das heißt, sie werden als hilfreich und nicht mehr als bedrohlich für die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft betrachtet.
Zufällig ist das genau die Sichtweise, die indigene Völker auf diese Stoffe hatten. In vielen indigenen Gemeinschaften bekräftigt der zeremonielle Gebrauch des Psychedelikums Peyote die gesellschaftlichen Normen, indem er die Menschen zusammenbringt, um die Traumata von Kolonialismus und Enteignung zu heilen. Die amerikanische Regierung erkennt das im ersten Verfassungszusatz festgehaltene Recht der Ureinwohner an, Peyote als Teil der freien Ausübung ihrer Religion einzunehmen, doch der Rest von uns genießt dieses Recht nicht, obwohl wir Peyote in ähnlicher Art und Weise gebrauchen. In diesem Fall ändert also statt der Droge die Identität des Konsumenten ihren rechtlichen Status.
Der Umgang mit Drogen ist unaufrichtig. Aber es stimmt nicht ganz, dass unsere Pflanzentabus völlig willkürlich sind. Wie die angeführten Beispiele zeigen, billigen die Gesellschaften bewusstseinsverändernde Drogen, die die Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Regeln unterstützen, und verbieten solche, die sie untergraben. Deshalb lassen sich an den akzeptierten Stoffen die Ängste und Wünsche der Gesellschaft ablesen.
Seit ich als Jugendlicher anfing zu gärtnern und Cannabis anzubauen versuchte, bin ich fasziniert von der Anziehungskraft dieser machtvollen Pflanzen und der ebenso machtvollen Tabus und Befürchtungen, mit denen wir sie umgeben. Inzwischen weiß ich, dass wir uns, wenn wir diese Pflanzen unserem Körper zum Zwecke der Bewusstseinsveränderung zuführen, zutiefst auf Natur einlassen.
Es gibt auf der Welt nur wenige Kulturen, die in ihrer Umgebung nicht mindestens eine dieser Pflanzen oder Pilze, in den meisten Fällen sogar eine ganze Reihe davon, entdeckt haben, die in irgendeiner Form das Bewusstsein verändern. Durch ein vermutlich langes und gefährliches Ausprobieren haben die Menschen Pflanzen ermittelt, die von der Last körperlicher Schmerzen befreien, die uns leistungsfähiger oder geselliger machen, die Ehrfurcht oder Verzückung auslösen, unsere Vorstellungskraft nähren, über Zeit und Raum hinausweisen, Träume, Visionen und mystische Erfahrungen in Gang setzen und uns unseren Vorfahren oder Göttern nahebringen. Offenbar reicht uns Menschen das normale, alltägliche Bewusstsein nicht. Wir versuchen, es zu verändern, zu vertiefen und manchmal zu transzendieren, und haben in der Natur eine ganze Sammlung von Molekülen entdeckt, die uns dazu befähigen.
Kaffee, Mohn, Kaktus ist eine persönliche Erforschung dreier dieser Moleküle und der bemerkenswerten Pflanzen, von denen sie erzeugt werden: das Koffein in Kaffee und Tee, das Morphin im Schlafmohn und das vom Peyote- und vom San-Pedro-Kaktus produzierte Meskalin. Das erste dieser Moleküle ist heute überall legal, das zweite zumeist illegal (es sei denn, es wurde von einem Pharmakonzern gereinigt und von einem Arzt verschrieben), und das dritte gilt in den Vereinigten Staaten als illegal, sofern man keinem Stamm der Urbevölkerung angehört. Jedes repräsentiert eine der drei groben Kategorien psychoaktiver Stoffe: der Downer (Opium), der Upper (Koffein) und das, was ich als Outer betrachte (Meskalin). Oder, um es wissenschaftlicher auszudrücken: Ich befasse mich mit einem Beruhigungsmittel, einem Aufputschmittel und einem Halluzinogen.
Zusammen genommen decken diese drei pflanzlichen Drogen einen Großteil des Spektrums menschlicher Erfahrung mit psychoaktiven Substanzen ab, vom täglichen Konsum des Koffeins, der beliebtesten psychoaktiven Droge auf dem Planeten, über den zeremoniellen Gebrauch von Meskalin seitens der Urbevölkerung bis zum jahrhundertealten Gebrauch von Opiaten zur Schmerzlinderung. Dieses Kapitel ist zur Zeit des Drogenkriegs angesiedelt, in den chaotischen Jahren, als die Regierung ein paar Gärtnern, die Mohn anbauten, um einen milden narkotischen Tee zu kochen, mehr Aufmerksamkeit widmete als einem Pharmakonzern, der wissentlich Millionen von Amerikanern nach seinem von der FDA zugelassenen Opiat OxyContin süchtig machte. Einer der Gärtner war ich.
Jede dieser Geschichten erzähle ich aus mehreren Perspektiven und mit unterschiedlicher Sichtweise: historisch, anthropologisch, biochemisch, botanisch oder persönlich. In allen Fällen habe ich etliche Gehirnzellen aufs Spiel gesetzt, da ich ohne Selbstversuche nicht weiß, wie ich die Erfahrung der Bewusstseinsveränderung beschreiben soll. Doch beim Koffein war der Selbstversuch von Abstinenz statt von Konsum geprägt, und das erwies sich als viel schwieriger.
Eins dieser Kapitel besteht aus einem Essay, den ich schon vor fünfundzwanzig Jahren verfasst habe, als der Drogenkrieg in vollem Gange war, und er weist noch die Narben dieser angstvollen, paranoiden Zeit auf. Die anderen Geschichten sind vom Abebben dieses Kriegs beeinflusst, dessen Ende inzwischen in Sicht zu sein scheint. Bei der Wahl von 2020 stimmten die Oregoner dafür, den Besitz jeglicher Drogen zu entkriminalisieren und speziell Therapien, bei denen Psilocybin verwendet wird, zu legalisieren. Ein in Washington, D.C., eingereichtes Volksbegehren fordert die Entkriminalisierung1 »entheogener Pflanzen und Pilze«. (»Entheogen«, was im Griechischen »Offenbarung des Gottes [Göttlichen] im Innern« heißt, ist eine andere Bezeichnung für Psychedelika, die 1979 in der Hoffnung, diese Wirkstoffklasse vom Makel der Gegenkultur zu befreien und den spirituellen Gebrauch zu betonen, dem sie Tausende von Jahren diente, von einer Gruppe Religionswissenschaftler geprägt wurde.) Bei derselben Wahl stimmte New Jersey zusammen mit vier traditionell republikanischen Staaten – Arizona, Mississippi, Montana und South Dakota – dafür, die Marihuanagesetze zu liberalisieren, und erhöhte die Anzahl der Staaten, die den Marihuanakonsum in irgendeiner Form legalisiert haben, auf sechsunddreißig.
Beim Schreiben von Kaffee, Mohn, Kaktus hat mich die Überzeugung geleitet, dass das Abflauen des Drogenkriegs mit seinem grob vereinfachenden Narrativ über »Keine Macht den Drogen« einen Raum geschaffen hat, in dem wir über unsere uralte Beziehung zu den bewusstseinsverändernden Pflanzen und Pilzen, mit denen uns die Natur gesegnet hat, andere, viel interessantere Geschichten erzählen können.
Das Wort »gesegnet« benutze ich in vollem Bewusstsein der menschlichen Tragödien, die mit dem Konsum von Drogen einhergehen können. Viel besser als wir verstanden die alten Griechen die Doppelnatur von Drogen, was sich in der Mehrdeutigkeit des Begriffs pharmakon widerspiegelt. Ein pharmakon kann, je nach Gebrauch, Dosis, Zweck oder Set und Setting2, eine Arznei oder ein Gift sein. (Es gibt noch eine dritte Bedeutung, auf die man sich während des Drogenkriegs oft berief: ein pharmakos ist ein Sündenbock, jemand, auf den eine Gruppe die Schuld an ihren Problemen schieben kann.) Drogenmissbrauch ist real, doch dabei geht es nicht so sehr um einen Gesetzesverstoß, sondern eher um das ungesunde Verhältnis zu einer Substanz, egal ob legal oder illegal, bei dem sich der Verbündete oder die Arznei in einen Feind verwandelt hat. Die gleichen Opiate, die 2019 durch eine Überdosis zum Tod von mehr als fünfzigtausend Amerikanern führten, machen Operationen erträglich oder erleichtern das Sterben. Wenn das kein Segen ist!
Die Geschichten, die ich in diesem Buch erzähle, stellen die drei psychoaktiven Substanzen in den größeren Kontext unserer Beziehung zur Natur. Einer der zahllosen Fäden, die uns mit der Natur verbinden, verknüpft die Pflanzenchemie mit dem menschlichen Bewusstsein. Und da das Ganze nun mal eine Beziehung ist, müssen wir die Perspektive der Pflanze ebenso darlegen wie unsere eigene. Wie erstaunlich ist es doch, dass so viele Pflanzenarten auf die Rezepte für Moleküle verfallen sind, die genau zu den Rezeptoren im menschlichen Gehirn passen. Und dass diese Moleküle unser Schmerzempfinden ausschalten, uns aufputschen oder uns das Gefühl nehmen können, ein vereinzeltes Ich zu sein. Da drängt sich die Frage auf: Was haben die Pflanzen davon, Moleküle zu entwickeln, die als menschliche Neurotransmitter gelten können und eine so starke Wirkung auf uns ausüben?
Die meisten von Pflanzen produzierten Moleküle, die das Bewusstsein von Tieren verändern, sind zunächst Verteidigungsmittel: Alkaloide wie Morphin, Koffein und Meskalin sind bitter schmeckende Gifte, die verhindern sollen, dass Tiere die dazugehörigen Pflanzen fressen, und sie, falls sie sich nicht davon abschrecken lassen, vergiften sollen. Doch Pflanzen sind klug, und im Lauf der Evolution haben sie gelernt, dass es nicht unbedingt die klügste Strategie ist, einen Plagegeist einfach zu töten. Da ein tödliches Pestizid bei der Schädlingspopulation schnell zu Resistenzen führen und seine Wirksamkeit verlieren würde, haben die Pflanzen subtilere, geschicktere Strategien entwickelt: Chemikalien, die auf das Bewusstsein von Tieren abzielen, die diese verwirren, orientierungslos machen oder ihnen den Appetit verderben – und genau das ist die zuverlässige Wirkung von Koffein, Meskalin und Morphin.
Auch wenn die meisten psychoaktiven Moleküle, die von Pflanzen erzeugt wurden, zunächst Gifte waren, entwickelten sie sich manchmal in die entgegengesetzte Richtung und wurden Lockstoffe. Wissenschaftler haben vor Kurzem entdeckt, dass einzelne Arten in ihrem Blütenkelch Nektar mit Koffein produzieren, und das ist der letzte Ort, an dem man erwarten würde, dass eine Pflanze ein giftiges Getränk kredenzt. Diese Pflanzen haben herausgefunden, dass sie die Bestäuber mit einem kleinen Schluck Koffein anlocken können und, was noch besser ist, Koffein offenbar das Gedächtnis von Bienen schärft und sie zu zuverlässigeren, leistungsfähigeren und härter arbeitenden Bestäubern macht. Eine ähnliche Wirkung wie bei uns.
Sobald wir herausgefunden hatten, was Koffein, Morphin und Meskalin bei uns bewirken konnten, rückten die Pflanzen, die die größte Menge dieser Chemikalien produzieren, in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Wir verbreiteten ihre Gene über die ganze Welt, erweiterten ihren Lebensraum beträchtlich und gingen auf ihre Bedürfnisse ein. Und inzwischen ist unser Schicksal mit dem Schicksal dieser Pflanzen eng verwoben. Was als Krieg begann, hat sich zu einer Ehe entwickelt.
Warum bemühen wir Menschen uns so, unser Bewusstsein zu verändern, und warum schränken wir dieses universelle Verlangen dann mit Gesetzen und Regeln, mit Tabus und Ängsten ein? Diese Fragen beschäftigen mich, seit ich vor mehr als dreißig Jahren begonnen habe, über unser Verhältnis zur Natur zu schreiben. Vergleicht man dieses Verlangen mit den anderen Bedürfnissen, die wir mithilfe der Natur befriedigen wollen – sei es Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Schönheit oder was auch immer –, so scheint der Drang zur Bewusstseinsveränderung bei Weitem nicht so viel, falls überhaupt etwas, zu unserem Erfolg oder Überleben beizutragen. Eigentlich könnte man den Wunsch, sein Bewusstsein zu verändern, sogar als schädlich betrachten, da veränderte Bewusstseinszustände uns der Gefahr von Unfällen aussetzen oder uns verwundbarer machen können. Außerdem sind viele dieser pflanzlichen Chemikalien giftig, und andere, wie Morphin, haben ein hohes Suchtpotenzial.
Wenn das Verlangen unserer Spezies nach Bewusstseinsveränderung universell und eine menschliche Gegebenheit ist, dann müsste sie einen Nutzen bieten, der die Risiken ausgleicht, sonst hätte die natürliche Selektion die Drogenkonsumenten längst ausgemerzt. Nehmen wir zum Beispiel den Nutzen von Morphin als Schmerzmittel, wodurch es schon vor Tausenden von Jahren zu einer der wichtigsten Arzneien wurde.
Bewusstseinsverändernde Pflanzen befriedigen auch andere menschliche Bedürfnisse. Bei Menschen, die in einem eintönigen Leben gefangen sind, sollten wir den Nutzen einer Substanz nicht unterschätzen, die Langeweile vertreiben und unterhaltsam sein kann, indem sie im Bewusstsein neue Empfindungen und Gedanken auslöst. Wie ich in der Pandemie festgestellt habe, können manche Drogen die Konturen einer Welt erweitern, die von Sachzwängen bestimmt ist. Drogen, die Geselligkeit fördern, befriedigen uns nicht nur, sondern führen vermutlich auch zu einer größeren Nachkommenschaft. Stimulanzien wie Koffein verbessern die Konzentration, machen uns lern- und arbeitsfähiger und fördern rationales, lineares Denken. Das menschliche Bewusstsein ist stets in Gefahr, sich zu verrennen und den Geist Grübelschleifen vollziehen zu lassen. Pilzliche Chemikalien wie Psilocybin können uns aus diesen Bahnen befreien, festgefahrene Gehirnstrukturen auflockern und frische Denkmuster ermöglichen.
Psychedelische Drogen können uns – und manchmal unserer Kultur – auch nützlich sein, indem sie die Fantasie anregen und bei den Menschen, die sie zu sich nehmen, kreativitätsfördernd wirken. Das soll nicht heißen, dass alle Gedanken, die in einem veränderten Bewusstsein auftreten, nützlich sind; auf die meisten trifft das nicht zu. Doch zuweilen dürfte ein stolperndes Gehirn auf eine neuartige Idee, die Lösung für ein Problem oder eine neue Sichtweise stoßen, die der Gemeinschaft nützt und vielleicht den Lauf der Geschichte ändert. Es spricht viel dafür, dass die Einführung des Koffeins im Europa des 17. Jahrhunderts eine neue, rationalere (und nüchternere) Denkweise auslöste, die zum Zeitalter der Aufklärung führte.
Es ist sinnvoll, sich diese psychoaktiven Moleküle als Mutagene vorzustellen, die jedoch eher in der menschlichen Kultur als in der Biologie agieren. Genauso wie die zerstörerische Kraft von Strahlung, der man ausgesetzt ist, Genmutationen auslösen, Veränderungen bewirken und neue Merkmale hervorbringen kann, die sich für die Spezies mitunter als günstig erweisen, steuern psychoaktive Drogen, die im menschlichen Bewusstsein agieren, manchmal nützliche neue Meme zur Evolution der Kultur bei – konzeptionelle Durchbrüche, frische Metaphern, neuartige Theorien. Nicht immer, nicht einmal oft, sondern nur gelegentlich, ändert sich irgendetwas beim Aufeinandertreffen des Bewusstseins mit einem Pflanzenmolekül. Wenn es eine Naturgeschichte der menschlichen Vorstellungskraft gibt, und davon ist auszugehen, kann dann ein Zweifel bestehen, dass die Pflanzenchemie sie mitgeprägt hat?
Psychedelische Substanzen können Erfahrungen mit Ehrfurcht und mystischer Verbundenheit begünstigen, die den spirituellen Impuls des Menschen nähren – einigen Religionswissenschaftlern zufolge3 könnten sie ihn sogar hervorgerufen haben. Die Vorstellung vom Jenseits, von einer verborgenen Dimension der Realität oder einem Leben nach dem Tod – auch das könnten Meme sein, die durch Visionen, ausgelöst von psychoaktiven Molekülen im menschlichen Geist, in die Kultur eingeführt wurden. Drogen sind nicht die einzige Möglichkeit, um diese Art mystischer Erfahrung im Kern vieler religiöser Traditionen herbeizuführen – Meditation, Fasten und Abgeschiedenheit können ähnliche Ergebnisse erzielen –, doch sie sind ein bewährtes Instrument dafür. Der spirituelle oder zeremonielle Gebrauch von pflanzlichen Drogen kann auch helfen, die Menschen zusammenzuschweißen, und eine stärkere soziale, von einem verminderten Selbstempfinden begleitete Verbundenheit fördern. Wir haben gerade erst zu verstehen begonnen, wie die Beziehung des Menschen zu psychoaktiven Pflanzen unsere Geschichte geprägt hat.
Vermutlich sollte es uns nicht überraschen, dass Pflanzen, die über solche Kräfte und Möglichkeiten verfügen, von ähnlich starken Gefühlen, Gesetzen, Ritualen und Tabus umgeben sind. Darin spiegelt sich die Auffassung wider, dass Bewusstseinsveränderungen für den Einzelnen und die Gesellschaft gefährlich sein können und, wenn so machtvolle Instrumente in die Hände der falschen Leute geraten, das Ganze richtig schiefgehen kann. Wir müssen noch viel lernen von den indigenen Kulturen, die eine lange Erfahrung mit Psychedelika wie Meskalin oder Ayahuasca haben: Der Gebrauch dieser Substanzen läuft nie beliebig ab, sondern stets zielgerichtet, eingebunden in Rituale und unter der Aufsicht von erfahrenen Älteren. Diese Leute wissen, dass die Pflanzen dionysische Energien entfesseln, die außer Kontrolle geraten können, wenn man nicht vorsichtig ist.
Doch das stumpfe Instrument eines Drogenkriegs hat uns davon abgehalten, uns mit diesen Mehrdeutigkeiten und den wichtigen Fragen, die sie über unser Wesen aufwerfen, auseinanderzusetzen. Die undifferenzierte Darstellung von Drogen und das Beharren darauf, alle in einen Topf zu werfen, haben uns zu lange daran gehindert, klar über die Bedeutung und das Potenzial dieser sehr unterschiedlichen Substanzen nachzudenken. Der rechtliche Status dieses oder jenes Moleküls ist völlig uninteressant. Genau wie Nahrung ist eine psychoaktive Droge nichts Lebendiges – ohne ein menschliches Gehirn ist sie inaktiv–, sondern eher eine Beziehung; damit etwas passiert, sind ein Molekül und ein Bewusstsein nötig. Dieses Buch geht davon aus, dass die drei geschilderten Beziehungen unseren tiefsten menschlichen Bedürfnissen und Bestrebungen, unseren Bewusstseinsprozessen und unserer Verwobenheit mit der Natur den Spiegel vorhalten.
KAFFEE
Vielleicht ist der allererste Satz nicht der richtige Ort für dieses Geständnis, ausgerechnet in dem Moment, in dem Sie überlegen, ob Sie mir ein, zwei Stunden Ihrer Aufmerksamkeit schenken sollen, doch mitten in den Recherchen für dieses Kapitel hatte ich eine Vertrauenskrise, die mich daran zweifeln ließ, dass dieses Thema für irgendwen, ja sogar für mich selbst, dessen vermeintlich glänzende Idee es war, von Interesse sein könnte. Ich begann ernsthaft zu bezweifeln, dass ein langer Essay über Koffein die Zeit und Mühe wert war, die es in Anspruch nehmen würde, ihn zu verfassen, und fragte mich, warum ich das je geglaubt hatte. Ich steckte in der Bredouille. Wir steckten in der Bredouille. Doch im Gegensatz zu mir haben Sie die Wahl: Sie können an dieser Stelle das Buch aus der Hand legen.
Vor dieser Krise war ich fröhlich umhergezogen, hatte Interviews geführt, zahllose wissenschaftliche Werke (wie sich herausstellte, ist Koffein eine der am besten untersuchten psychoaktiven Substanzen) und Geschichtsbücher gelesen (durch die Einführung des Kaffees wurde der Lauf der Geschichte im Westen entscheidend verändert), war nach Südamerika gereist, um eine Kaffee-Finca zu besuchen, und hatte alle möglichen koffeinhaltigen Getränke probiert, als ich plötzlich wie Karl der Kojote im Roadrunner-Zeichentrickfilm zufällig nach unten blickte und feststellen musste, dass unter mir keine Straße mehr war, sondern, so weit mein Blick reichte, nur noch die endlose, leere Weite der Sinnlosigkeit. Was um alles in der Welt tat ich da?
Doch vielleicht wäre es angebrachter zu fragen: Was tat ich nicht? Denn zu diesem Zeitpunkt ging etwas mit mir vor, das mit ziemlicher Sicherheit für den plötzlichen Abfall des Kabinendrucks bei diesem Projekt verantwortlich war: Ich hatte von einem Moment auf den anderen völlig auf Koffein verzichtet.
Nachdem ich jahrelang morgens einen großen Kaffee getrunken hatte, tagsüber gefolgt von mehreren Tassen grünem Tee und einem gelegentlichen Cappuccino nach dem Mittagessen, hatte ich dem Koffein radikal abgeschworen. Das war nicht mein unbedingter Wille gewesen, doch ich war widerwillig zu dem Schluss gelangt, dass mein Essay es erforderte. Einige der Fachleute, die ich interviewte, hatten behauptet, ich könne die Rolle des Koffeins in meinem Leben – seine unmerkliche, aber tiefgreifende Macht – nicht richtig verstehen, ohne davon abzulassen und irgendwann mutmaßlich wieder darauf zurückzugreifen. Roland Griffiths, weltweit einer der führenden Forscher zu stimmungsverändernden Drogen und in starkem Maße dafür verantwortlich, dass die Diagnose »Koffeinentzugssyndrom« ins Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (abgekürzt als DSM-5), die Bibel der psychiatrischen Diagnostik, aufgenommen wurde, erzählte mir, er habe sein eigenes Verhältnis zum Koffein erst begriffen, als er darauf verzichtete und eine Reihe von Selbstversuchen durchführte. Er drängte mich, es ihm nachzutun.
Dahinter steckt der Gedanke, dass man das Fahrzeug, mit dem man fährt, nicht beschreiben kann, ohne anzuhalten, auszusteigen, und das Ding von außen genau in Augenschein zu nehmen. Das trifft wahrscheinlich auf alle psychoaktiven Drogen zu, gilt aber besonders für Koffein, denn die spezielle Bewusstseinsqualität, für die es beim regelmäßigen Konsumenten verantwortlich ist, fühlt sich nicht verändert oder verzerrt an, sondern eher normal und glasklar. Für die meisten von uns ist ein unter dem Einfluss von Koffein stehendes Bewusstsein einfach der Normalzustand. Etwa neunzig Prozent der Menschen nehmen regelmäßig Koffein zu sich und machen es zur meistkonsumierten psychoaktiven Droge auf der Welt, der einzigen, die wir (in Form von Limonade) auch Kindern geben. Nur wenige von uns betrachten Koffein als Droge, geschweige denn den täglichen Konsum als Sucht. Koffein ist so allgegenwärtig, dass man leicht die Tatsache übersieht, dass man sich unter seinem Einfluss nicht im Normalzustand, sondern einem veränderten Bewusstseinszustand befindet. Zufällig sind wir alle damit vertraut, deshalb fällt es uns nicht mehr auf.
Also beschloss ich zum Wohle des Essays – das heißt, Ihnen zuliebe, werter Leser –, einen Selbstversuch in Abstinenz durchzuführen. Am Beginn dieses Experiments war mir nicht in den Sinn gekommen, dass ich durch den Verzicht auf Koffein meine Fähigkeit unterminieren könnte, die Geschichte des Koffeins zu erzählen, ein Problem, das ich nicht zu lösen wusste.
Vielleicht hätte ich damit rechnen müssen. Die Wissenschaft hat es dargelegt, und ich hatte die vorhersehbaren Symptome von Koffeinentzug zur Kenntnis genommen: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Trägheit, Konzentrationsprobleme, verringerte Motivation, Reizbarkeit, Verzweiflung, mangelndes Selbstvertrauen(!) und Übellaunigkeit – das Gegenteil von Euphorie. In einem gewissen Grad wies ich alle Symptome auf, doch hinter der scheinbar glimpflichen Rubrik »Konzentrationsprobleme« versteckt sich nichts anderes als eine existenzielle Bedrohung der Arbeit eines Autors. Wie kann man erwarten, etwas zu schreiben, wenn man sich nicht konzentrieren kann? Alle Autoren stehen vor der Aufgabe, die blühende Vielfalt der Welt und unserer Erfahrung davon buchstäblich in überschaubare Proportionen zu bündeln und sie dann Wort für Wort durch das Nadelöhr der Grammatik zu zwängen. Es grenzt an ein Wunder, dass jemand dieses geistige Kunststück bewältigen kann, so kommt es einem am dritten Tag des Koffeinentzugs jedenfalls vor. Aber noch bevor sich der Autor erhoffen kann, sich dieser steilen Klippe der Unmöglichkeit zu stellen und sie zu erklimmen, muss er oder sie das Selbstvertrauen – die Handlungsfähigkeit und Stärke – aufbringen, das erforderlich ist, um weiterzumachen. Es ist nicht so wichtig, ob es Einbildung ist, doch das Gefühl, dass man es mit einer Geschichte zu tun hat, von der die Welt erfahren muss, und nur man selbst sie erzählen kann, ist genau das, was man braucht, um sie zu erzählen. Man verzeihe mir die männliche Metapher, aber es hängt viel von dieser mentalen Erektion ab. Ich habe festgestellt, dass sie ihrerseits zu einem nicht geringen Teil von 1,3,7-Trimethylxanthin abhängt, dem winzigen organischen Molekül, das die meisten von uns unter dem Namen Koffein kennen.
Der erste Tag meines Entzugs, der am 10. April begann, war mit Abstand der schwierigste, in einem Maße, dass die Vorstellung, etwas zu schreiben oder auch nur zu lesen, sich sofort als vergeblich erwies. Ich hatte den dunklen Tag so lange wie möglich hinausgeschoben und mir wie jeder Süchtige alle möglichen Ausreden zurechtgelegt. »Mich erwartet eine stressreiche Woche«, sagte ich mir. »Wahrscheinlich nicht der beste Zeitpunkt für einen kalten Entzug.« Natürlich gab es gar keinen »guten Zeitpunkt« – stets hatte ich einen Grund, warum ich einen scharfen Verstand brauchte und mir die »grippeähnlichen Symptome«, die die Forscher für möglich hielten, nicht leisten konnte. »I wanna do right«, wie die Countrysängerin Gillian Welch schmachtete, »but not right now.« Ich will richtig handeln, aber nicht jetzt. So war es auch bei mir, Tag für Tag. Zauderei am Beginn des Schreibprojekts ist für mich nichts Ungewöhnliches, doch diesmal hielt sie wochenlang an. Und irgendwann saß ich in der Klemme, weil keine journalistische Arbeit mehr zu verrichten war und alles, was zwischen mir und dem Schreiben des Buches stand, der Verzicht auf Kaffee war – genau das, was es mir unmöglich machen würde zu schreiben.
Ich legte ein Datum fest und beschloss, daran festzuhalten.
Der 10. April, ein Mittwoch, rückte heran. Den von mir interviewten Forschern zufolge hatte der Entzug bereits in der Nacht begonnen, während ich schlief, an der »Talsohle« der Kurve, die die tägliche Wirkung des Koffeins anzeigte. Die erste Tasse Tee oder Kaffee am Tag verleiht die größte Kraft – das Glücksgefühl! –, nicht wegen ihrer euphorisierenden und stimulierenden Eigenschaften, sondern weil sie die auftretenden Entzugssymptome unterdrückt. Das gehört zur Heimtücke des Koffeins. Seine Wirkweise oder »Pharmakodynamik« passt so perfekt mit dem Rhythmus des menschlichen Körpers zusammen, dass die morgendliche Tasse Kaffee genau rechtzeitig kommt, um die drohenden psychischen Qualen, die von der gestrigen Tasse in Gang gesetzt wurden, abzuwenden. Tagtäglich bietet sich Koffein als optimale Lösung des Problems an, das von ihm selbst hervorgebracht wird. Genial!
Zu meinem Morgenritual mit Judith gehört es, nach dem Frühstück und der heimischen Gymnastik etwa einen Kilometer »zum Kaffee zu gehen«, wie die Immobilienmakler es gern ausdrücken. Aus irgendeinem Grund machen wir zu Hause keinen Kaffee, sondern besorgen uns einen im Cheese Board, einer örtlichen Bäckerei mit Käseverkauf, wo wir ihn aus einem mit einer warmen Pappmanschette umhüllten Pappbecher trinken. (Ressourcenvergeudung, ich weiß.) Um mir etwas vorzumachen, behielt ich alles an diesem Morgenritual bei – den Spaziergang zur Bäckerei und das heiße Getränk in einem Pappbecher –, nur dass ich mich an der Kasse zwang, statt des üblichen koffeinreduzierten großen Kaffees einen Pfefferminztee zu bestellen. (Ja, ich war bei meinem Kaffeekonsum eher zurückhaltend.) Nachdem ich jahrelang »das Übliche« gesagt hatte, sah der Barista mich erstaunt an. »Ich bin zurzeit abstinent«, sagte ich zu meiner Rechtfertigung.
An diesem Morgen fiel die angenehme Auflösung des geistigen Nebels aus, den der erste Schluck Koffein im Bewusstsein bewirkt. Der Nebel legte sich über mich und wich nicht vom Fleck. Es war kein schreckliches Gefühl – ich bekam keine schlimmen Kopfschmerzen –, doch ich war den ganzen Tag lang benommen, als hätte sich zwischen mich und die Realität ein Schleier gesenkt, eine Art Filter, der bei Licht und Schall bestimmte Wellenlängen verschluckte. Ich schrieb in mein Notizbuch: »Mein Bewusstsein scheint nicht so klar zu sein wie üblich, als wäre die Luft verdichtet und würde meine Wahrnehmung verlangsamen.« Ich konnte arbeiten, war aber zerstreut. »Ich fühle mich wie ein stumpfer Bleistift«, schrieb ich. »Randständiges drängt sich in mein Bewusstsein und lässt sich nicht ignorieren. Ich kann mich höchstens eine Minute lang konzentrieren. Fühlt es sich so an, wenn man ADS hat?«
Mittags betrauerte ich die Tatsache, dass Koffein für unbestimmte Zeit aus meinem Leben verschwunden war. Ich vermisste schmerzlich, was Judith als »Tasse voll Optimismus« bezeichnete; das gleiche Getränk, das Alexander von Humboldt, der große deutsche Naturforscher, »konzentrierter Sonnenschein« nannte. (Humboldt hatte einen Papagei, der Jakob hieß und nur einen einzigen Satz sagen konnte: »Viel Kaffee, viel Zucker.«) Doch in diesem Augenblick hätte es gar nicht mal Optimismus sein müssen. »Was mir fehlt«, schrieb ich, »hat nichts mit einem Rauschzustand oder Euphorie zu tun, es ist bloß mein gewohntes alltägliches Bewusstsein. Ist das mein neuer Normalzustand? Gott, hoffentlich nicht.«
In den nächsten Tagen begann ich mich besser zu fühlen – der Schleier hob sich –, doch ich war nicht ganz auf der Höhe, und mit der Welt verhielt es sich ebenso. Am Ende der Woche war ich an einem Punkt angelangt, an dem ich glaubte, die Schuld an meiner Geistesverfassung (und der enttäuschenden Arbeitsleisung) nicht dem Koffeinentzug geben zu können, und doch kam mir die Welt in diesem neuen Normalzustand trister vor. Auch ich kam mir trister vor. Morgens war es am schlimmsten. Ich begriff, wie wesentlich Koffein für die tägliche Aufgabe ist, sich nach dem Zerfasern des Bewusstseins im Schlaf wieder zusammenzufügen. Diese Rekonsolidierung des Ichs – das tägliche Spitzen des geistigen Bleistifts – dauerte viel länger als sonst und fühlte sich nie vollständig an. Ich begann Koffein für einen unverzichtbaren Bestandteil beim Aufbau eines Ichs zu halten. Meinem Ich fehlte es nun an diesem Baustoff, und das erklärt vielleicht, warum mir das Ziel, diesen Essay zu schreiben – eigentlich je wieder irgendetwas zu schreiben –, inzwischen unerreichbar vorkam.
Ich spreche hier von einer Chemikalie – dem Koffein –, aber natürlich geht es in Wirklichkeit um eine Pflanze oder in diesem Fall um zwei Pflanzen: Coffea und Camellia sinensis, bzw. Tee, die im Lauf der Evolution entdeckten, wie man eine Chemikalie produziert, die die meisten Menschen süchtig macht1. Das ist eine erstaunliche Leistung, und obwohl es bei der Entwicklung des Moleküls nicht die Absicht der Pflanzen gewesen war – in der Evolution gibt es keinen Plan, sondern nur blinden Zufall, der mitunter eine so gute Anpassung hervorbringt, dass sie reich belohnt wird –, nahm das Schicksal dieser Pflanzenart und dieser Tierspezies, als das Molekül den Weg ins menschliche Gehirn gefunden hatte, eine folgenschwere Wendung.
Die Anpassung erwies sich als so kunstvoll, dass sie den Pflanzen erlaubte, ihre Anzahl und ihren Lebensraum beträchtlich zu vergrößern. Im Falle Coffeas, deren Verbreitungsgebiet vorher auf ein paar Zipfel Ostafrikas und Südarabiens beschränkt gewesen war, bewirkte ihre Anziehungskraft auf unsere Spezies, dass sie den ganzen Planeten umrunden und ein breites Gebiet besiedeln konnte, das von Afrika bis nach Ostasien, Hawaii und Mittel- und Südamerika reicht und mehr als zehn Millionen Hektar umfasst. Der Weg von Camellia sinensis führt von ihrem Ursprung in Südwestchina (unweit von Tibet und Myanmar) in westlicher Richtung bis Indien und östlich bis Japan und umfasst ein Gebiet von mehr als vier Millionen Hektar. Die beiden gehören gemeinsam mit den essbaren Gräsern Reis, Weizen und Mais zu den weltweit erfolgreichsten Pflanzen. Doch verglichen mit den Arten, die unsere Unterstützung gewannen, weil sie unseren Kalorienbedarf so vortrefflich stillen, beinhaltete der Weg von Tee und Kaffee zur Weltherrschaft etwas viel Subtileres und Entbehrlicheres: ihre Fähigkeit, unser Bewusstsein auf erstrebenswerte und nützliche Weise zu verändern. Und anders als bei den essbaren Gräsern, deren fetthaltige Samen wir bei fast jeder Mahlzeit verzehren, geht es uns bei den Tee- und Kaffeepflanzen nur um die Koffeinmoleküle und ein paar charakteristische Aromen, die wir aus ihren Blättern und Samen gewinnen. Also verringern wir lediglich das Gewicht ihrer riesigen Biomasse, bevor wir sie einfach auf Mülldeponien beseitigen. Diese äußerst wertvollen landwirtschaftlichen Erzeugnisse werden tonnenweise aus den Tropen in die höheren Breiten geliefert, um dort kurz in heißem Wasser aufgebrüht und dann achtlos entsorgt zu werden. Ist es nicht ökologischer Irrsinn, all diese Blätter und Samen um die halbe Welt zu transportieren, nur um den Geschmack von Wasser zu verändern?
Kaffee und Tee hatten ihre eigenen Gründe für die Produktion des Koffeinmoleküls, und wie so oft bei den sogenannten sekundären Metaboliten, die von Pflanzen erzeugt werden, dient es dem Schutz vor Fressfeinden. In hohen Dosen ist Koffein für Insekten tödlich. Sein bitterer Geschmack soll sie davon abhalten, an den Pflanzen zu nagen. Und Koffein scheint auch herbizide Eigenschaften zu haben, um zu verhindern, dass konkurrierende Pflanzen keimen, die in dem Gebiet zu wachsen versuchen, in dem Jungpflanzen Wurzeln geschlagen oder später ihre Blätter abgeworfen haben.
Viele der von Pflanzen erzeugten psychoaktiven Moleküle sind giftig, aber wie schon Paracelsus gesagt hat: Die Dosis macht das Gift. Was in einer bestimmten Dosis tödlich ist, kann in einer anderen eine dezente, angenehme Wirkung haben. Die interessante Frage ist, warum so viele von Pflanzen erzeugte Schutzchemikalien bei Tieren in nicht tödlichen Dosen psychoaktiv sind. Eine Theorie besagt, dass die Pflanze den Fressfeind nicht unbedingt töten, sondern ihn nur entwaffnen will. Wie die lange Geschichte des Wettrüstens der pflanzlichen Schutzchemikalien gegen Insekten zeigt, ist die Tötung des Fressfeindes nicht unbedingt die beste Strategie, da das Gift nach Widerstand selektiert und ihn unschädlich macht. Wenn es hingegen gelingt, den Feind zu verwirren – ihn von seinem Mahl abzulenken oder ihm den Appetit zu verderben, wie viele psychoaktive Substanzen es tun –, dürfte die Pflanze besser dran sein, da sie sich rettet und zugleich die Kraft ihres Schutzgifts bewahrt.
Koffein verringert tatsächlich den Appetit und verwirrt Insektengehirne. In einem berühmten Experiment der NASA in den 1990er-Jahren fütterten die Forscher Spinnen mit einer Vielzahl psychoaktiver Substanzen, um zu sehen, wie sich das auf ihre Fähigkeit des Netzwebens auswirken würde. Die unter dem Einfluss von Koffein stehende Spinne webte ein seltsam kubistisches und völlig untaugliches Netz mit schrägen Winkeln, die Löcher so groß, dass kleine Vögel hindurchpassten, schlichtweg unsymmetrisch und ohne Mittelpunkt. (Das Netz war viel abstruser als bei den Spinnen, die Cannabis oder LSD erhalten hatten.) Bei berauschten Insekten ist es wie bei berauschten Menschen wahrscheinlicher, dass sie leichtsinnig werden und dadurch die Aufmerksamkeit von Vögeln oder anderen Raubtieren auf sich ziehen, die freudig tun, was die Pflanze will, indem sie sich das tänzelnde oder taumelnde Tierchen schnappen und es vertilgen.
Die meisten pflanzlichen Chemikalien oder Alkaloide, die die Menschen genutzt haben, um die Textur des Bewusstseins zu verändern, dienten ursprünglich dem Schutz der Pflanzen. Doch auch in der Welt der Insekten macht die Dosis das Gift, und wenn sie gering genug ist, kann eine Schutzchemikalie einen ganz anderen Zweck erfüllen: die treue Verbundenheit von Bestäubern zu gewinnen und abzusichern. Genau das scheint zwischen Bienen und bestimmten koffeinproduzierenden Pflanzen abzulaufen, in einer symbiotischen Beziehung, die uns vielleicht etwas Wichtiges über unser eigenes Verhältnis zum Koffein erzählen kann.
Die Geschichte beginnt in den 1990er-Jahren, als deutsche Forscher die überraschende Entdeckung machten, dass mehrere Pflanzengruppen – darunter nicht nur Kaffee und Tee, sondern auch die Citrus-Familie und eine Handvoll andere Gattungen – in ihrem Nektar Koffein produzieren, eine Substanz, die Insekten eher anlocken als abwehren soll. War das Zufall, und das Koffein war aus anderen Pflanzenteilen ausgetreten, oder konnte es eine diabolische Anpassung sein?
Als Geraldine Wright auf die deutsche Abhandlung stieß, war sie eine junge, von Botanik auf Insektenkunde umgestiegene Dozentin an der Newcastle University in England. »Wir hatten keine Ahnung, warum sich Koffein im Nektar befand«, sagte sie mir. Also führte Wright, die inzwischen einen Lehrstuhl in Zoologie an der University of Oxford innehat, ein einfaches, nicht besonders kostspieliges Experiment durch, um es herauszufinden. Sie fing ein paar Honigbienen ein, steckte sie in kleine Bienenzwangsjacken und brachte sie in einem Gitter aus bienengroßen, dachlosen Kammern unter, aus denen nur ihre Köpfe ragten. Mit einer Pipette gab Wright ihren Bienen unterschiedliche Zuckerwassermischungen mit und ohne Koffeinkonzentrationen zu fressen. Jedes Mal, wenn sie einer Biene einen Tropfen Pseudonektar gab, fügte sie einen Duftstoff hinzu. Dadurch wollte sie sehen, wie schnell die Bienen lernten, den Duft mit einer attraktiven Nahrungsquelle zu verknüpfen.
»Simpler Aufbau, einfache Durchführung, keine Fördermittel«, beschrieb sie die primitiven Bedingungen. Gut, aber wie ermittelt man die Nahrungsmittelvorlieben einer Biene? »Auch das ist einfach«, sagte Wright. »Wenn sie etwas haben wollen, strecken sie die Fresswerkzeuge und den Rüssel aus.«
Wright stellte fest, dass ihre Bienen den Duft, der mit dem koffeinhaltigen Nektar verbunden war, besser erkannten als den, der nur mit Saccharose verbunden war. (Ihre Ergebnisse erschienen 2013 in einem Science-Artikel mit dem Titel »Koffein in Blütennektar verbessert bei Bestäubern das Belohnungsgedächtnis«.) Sogar bei Konzentrationen, die so gering waren, dass die Bienen sie nicht schmecken konnten, half ihnen das Koffein, einen speziellen Duft zu erkennen und zu bevorzugen.
Man kann verstehen, warum das für eine Blume nützlich wäre: Es würde bewirken, dass der Bestäuber sich an sie erinnert und zuverlässiger zu ihr zurückkehrt. Oder, wie die Insektenkundlerin es in dem Artikel ausgedrückt hat, koffeinhaltiger Nektar erhöht die »Bestäubertreue«, die ansonsten Blumenkonstanz genannt wird. Die Blume muss ihrem Bestäuber eine geringe Koffeindosis verabreichen, damit er sich an sie erinnert, nach mehr verlangt und sie anderen Pflanzen vorzieht, die ihm nicht den gleichen Rausch bieten.
Eigentlich wissen wir nicht, ob die Bienen irgendetwas empfinden, wenn sie Koffein zu sich nehmen, wir wissen nur, dass die Chemikalie ihnen hilft, sich zu erinnern – und das scheint Koffein, wie wir sehen werden, auch bei uns zu bewirken. Weitere Experimente, mit größerem Budget und ausgefeilterem Aufbau, bei denen künstliche Blumen in naturalistischerer Kulisse verwendet wurden, haben Wrights Ergebnis reproduziert: Bienen können sich besser an Blumen erinnern, die ihnen koffeinhaltigen Nektar bieten, und kehren zuverlässiger zu ihnen zurück. Außerdem ist die Macht dieser Wirkung so groß, dass Bienen selbst dann zu jenen Blumen zurückkehren, wenn kein Nektar mehr vorhanden ist. Ein von Margaret J. Couvillon durchgeführtes, 2015 in Current Biology veröffentlichtes Experiment (»Koffeinhaltige Nahrung veranlasst Honigbienen zu verstärkter Nahrungssuche und augeprägterem Rekrutierungsverhalten«) warf die Cui-Bono-Frage auf: Wer hat von diesem koevolutionären Arrangement zwischen Bestäubern und koffeinproduzierenden Pflanzen den größeren Nutzen? Die Antwort scheint zu lauten: die Pflanze.
Couvillon zeigte auf, dass sich Bienen so gut an koffeinhaltige Blumen erinnerten und so begeistert von ihnen waren, dass »die Häufigkeit der Nahrungssuche, die Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit ihres Schwänzeltanzes und die dauerhafte Bindung an den Nahrungsort [zunahmen] und zu einer Vervierfachung der Rekrutierung auf Kolonieebene führten« – das heißt, dass nach Couvillons Schätzung die koffeinhaltigen Blumen von viermal so vielen Bienen aufgesucht wurden wie diejenigen, die nur Nektar zu bieten hatten. Doch der Überschwang der Bienen übersteigt jeglichen denkbaren Nutzen für sie und macht das Ganze irrational: »Das Koffein veranlasst die Bienen, die Qualität der Nahrung zu überschätzen, und verleitet die Kolonie zu suboptimalen Strategien der Nahrungssuche«, wodurch wahrscheinlich »die Honigspeicherung reduziert« wird, da sie auch noch zu den koffeinhaltigen Blumen zurückkehrten, als deren Nektar längst erschöpft war. Couvillon kam zu dem Schluss, dass »die Beziehung zwischen Bestäuber und Pflanze [deshalb] eher ausbeuterisch als mutualistisch« ist. Dass die Pflanze den Bienen Koffein bietet, »ähnelt der Verabreichung von Drogen, durch die beim Bestäuber die Wahrnehmung der Nahrungsqualität verändert wird und diese wiederum sein individuelles Verhalten ändert«. Es ist eine schaurig bekannte Geschichte: Ein vertrauensseliges Tier wird von der intelligenten Neurochemie einer Pflanze dazu verleitet, gegen seine eigenen Interessen zu handeln.
Es stellt sich eine Reihe unangenehmer Fragen: Könnte es sein, dass wir Menschen mit diesen glücklosen Bienen im selben Boot sitzen? Werden auch wir von koffeinhaltigen Pflanzen dazu verleitet, nach ihrer Pfeife zu tanzen und dabei gegen unsere eigenen Interessen zu handeln? Wer ist in unserer Beziehung zu den koffeinproduzierenden Pflanzen der Stärkere?
Es gibt verschiedene Wege, diese Frage anzugehen, und eine gute Möglichkeit ist der Versuch, zwei weitere Fragen zu beantworten: Ist die Entdeckung des Koffeins durch den Menschen für unsere Zivilisation Fluch oder Segen? Und wie steht es mit unserer Spezies, was nicht genau dasselbe sein dürfte?
Im Fall des Koffeins können wir in der Geschichtsschreibung nach Antworten suchen, da die Bekanntschaft mit Koffein erstaunlicherweise noch nicht lange besteht. Auch wenn es schwer vorstellbar ist, bis zum 17. Jahrhundert war die westliche Zivilisation weder mit Kaffee noch mit Tee in Berührung gekommen. Tatsächlich trafen Kaffee, Tee und Schokolade (die ebenfalls Koffein enthält) erst im selben Jahrhundert – in den 1650er-Jahren – in England ein, und so können wir eine Vorstellung von der Welt vor und nach der Ankunft des Koffeins bekommen. In Ostafrika war der Kaffee schon ein paar Jahrhunderte vorher bekannt – er soll gegen 850 n. Chr. in Äthiopien entdeckt worden sein –, doch er ist viel jünger als andere psychoaktive Substanzen wie Alkohol, Cannabis oder die Psychedelika Psilocybin, Ayahuasca und Peyote, die in der menschlichen Kultur schon seit Jahrtausenden eine Rolle spielen. Tee ist ebenfalls älter als Kaffee und wurde spätestens 1000 v. Chr. in China entdeckt und als Arznei verwendet, auch wenn er erst zwischen 618 und 907 n. Chr. in der Tang-Dynastie als Freizeitgetränk populär wurde.
Man kann durchaus sagen, dass die Ankunft des Koffeins in Europa … alles veränderte. Das klingt übertrieben, ich weiß, und über andere Entwicklungen in der »materiellen Kultur« bekommen wir oft etwas Ähnliches zu hören – dass die Entdeckung von X oder Y (ein Erzeugnis der Neuen Welt, irgendeine Erfindung oder Erkenntnis) »die moderne Welt erschuf«. Das bedeutet gewöhnlich, dass das Aufkommen von X oder Y eine verändernde Wirkung auf die Wirtschaft, den Alltag oder die Lebenshaltung hatte. Aber wie beim Koffeinmolekül selbst, das rasch jede Zelle des Körpers erreicht, der es aufgenommen hat, liefen die von Kaffee und Tee bewirkten Veränderungen auf einer fundamentaleren Ebene ab – auf der Ebene des menschlichen Geistes. Kaffee und Tee leiteten eine Veränderung des geistigen Wetters ein, sie schärften den Verstand, der vom Alkohol vernebelt gewesen war, befreiten die Menschen von den natürlichen Rhythmen ihres Körpers und der Sonne und ermöglichten neue Arbeitsformen und vermutlich auch neue Denkweisen. Nachdem das Koffein eine neue Form von Bewusstsein nach Europa gebracht hatte, beeinflusste es einfach alles, vom Welthandel über den Imperialismus, den Sklavenhandel, den Arbeitsplatz, die Naturwissenschaften, die Politik, bis zu den gesellschaftlichen Beziehungen und wohl auch dem Rhythmus der englischen Prosa.
Es heißt, dass die Beschäftigung des Menschen mit der Kaffeepflanze mit einem aufmerksamen Ziegenhirten im heutigen Äthiopien beginnt, einem der wenigen Orte in Afrika, wo der strauchartige Baum wild wächst. Dieser Geschichte zufolge bemerkte im 9. Jahrhundert ein Hirte namens Kaldi, dass seine Ziegen sich launisch verhielten und die ganze Nacht wach blieben, wenn sie die roten Beeren der Coffea-arabica-Pflanze gefressen hatten. Kaldi erzählte dem Abt eines örtlichen Klosters von seiner Beobachtung, der aus den Beeren ein Getränk zubereitete und die stimulierenden Eigenschaften des Kaffees entdeckte.
Schon möglich. Was wir aber wissen, ist, dass seit dem 15. Jahrhundert in Ostafrika Kaffee angebaut und auf der arabischen Halbinsel damit Handel getrieben wurde. Anfangs wurde das neue Getränk als Konzentrationshilfe angesehen und von Sufis im Jemen genutzt, um bei der Ausübung ihrer religiösen Bräuche nicht einzudösen. (Tee begann auch als eine Art spirituelles Koffein für buddhistische Mönche, die bei langen Meditationsübungen wach bleiben wollten.) Innerhalb eines Jahrhunderts waren in den Städten der arabischen Welt unzählige Kaffeehäuser aus dem Boden geschossen. 1570 gab es allein in Konstantinopel mehr als sechshundert davon, und mit dem Osmanischen Reich breiteten sie sich nach Norden und Westen aus. Diese neuen öffentlichen Orte waren Brutstätten von Klatsch und Nachrichten, Lokalitäten, an denen man sich für Darbietungen und Spiele versammelte. Kaffeehäuser waren relativ liberale Einrichtungen, wo sich die Gespräche oft um Politik drehten, und zu verschiedenen Zeiten staatliche und geistliche Machthaber versuchten, sie zu schließen, aber nie lange und nie mit großem Erfolg. (1511 wurde in Mekka vor Gericht wegen der gefährlich berauschenden Wirkung über ein Fass Kaffee verhandelt, doch das Urteil und das folgende Verbot wurden vom Sultan von Kairo rasch revidiert.) Wie die Verteidiger des Kaffees zu Recht betonten, wird das Getränk im Koran nirgends erwähnt. Und so bot der Kaffee der islamischen Welt eine geeignete Alternative zum Alkohol, der im Koran ausdrücklich verboten ist, und wurde bekannt als kahve, was frei übersetzt »Wein Arabiens« bedeutet. Die Vorstellung, dass Kaffee irgendwie den Widerpart zu Alkohol darstellt, hielt sich sowohl im Osten als auch im Westen und zeigt sich heute in dem verbreiteten Irrglauben, schwarzer Kaffee sei ein Mittel gegen Trunkenheit.
Die islamische Welt war damals in vielerlei Hinsicht höher entwickelt als Europa, in Wissenschaft, Technik und Gelehrsamkeit. Ob diese geistige Blüte etwas mit der vorherrschenden Stellung des Kaffees (und dem Verbot von Alkohol) zu tun hatte, ist schwer zu beweisen, doch wie der deutsche Historiker Wolfgang Schivelbusch geltend macht, schien das Getränk »wie geschaffen für eine Kultur, die den Alkohol verboten und die neuzeitliche Mathematik hervorgebracht hat«. Auch in China fiel die Beliebtheit des Tees in der Tang-Dynastie mit einem goldenen Zeitalter zusammen. Und die tiefgreifenden Auswirkungen, die das Aufkommen des Kaffees in Europa hatte, verleihen dem Gedanken eines Kausalzusammenhangs eine gewisse Plausibilität.
Die Europäer waren schon lange von den exotischen Gebräuchen des »Orients« fasziniert, und dieses tintenschwarze heiße Getränk weckte bald ihre Neugier. Ein Venezianer, der 1585 nach Konstantinopel reiste, vermerkte, dass die Einheimischen »die Gewohnheit haben,