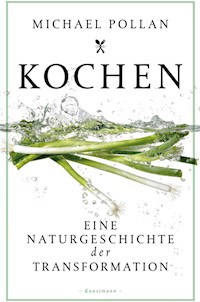
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wie kommen wir in unserem täglichen Leben zu einem tieferen Verständnis der Natur und der besonderen Rolle unserer Spezies darin? Am besten geht man dazu einfach in die Küche, meint Michael Pollan. Und das tut er in seinem neuen, aufregenden Buch "Kochen" und vermisst das Terrain der Küche auf ungewohnte Weise. Pollan beschäftigt sich mit den vier klassischen Elementen – Feuer, Wasser, Luft und Erde –, die das, was die Natur uns liefert, in köstliches Essen und Trinken verwandeln, und geht selbst noch einmal in die Lehre: Bei einem Barbecue-Meister lernt er die Magie des Feuers kennen; ein Chez-Panisse-Koch weist ihn in die Kunst des Schmorens ein; ein Bäcker bringt ihm bei, wie Mehl und Wasser durch Luft in duftendes Brot verwandelt werden; und die 'Fermentos', eine Gruppe verrückter Genies, zu denen ein Brauer und ein Käser gehören, zeigen ihm, wie Pilze und Bakterien eine erstaunliche Alchemie zustande bringen. In all diesen Verwandlungsprozessen nehmen die Köche eine besondere Position ein: die zwischen Natur und Kultur. Mit Pollan lernen auch die Leser, wie uns das Kochen verbindet: mit Pflanzen und Tieren, mit der Erde und den Bauern, unserer Geschichte und Kultur und natürlich mit den Menschen, mit denen und für die wir kochen. Wenn wir die Freude am Kochen zurückgewinnen, das ist das Fazit dieses wunderbaren Buchs, öffnet sich die Tür zu einem reicheren Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 713
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Michael Pollan
KOCHEN
Eine Naturgeschichteder Transformation
Aus dem Englischen von Katja Hald,Enrico Heinemann und Renate Weitbrecht
Verlag Antje Kunstmann
Für Judith und Isaacund für Wendell Berry
INHALT
Vorwort:Warum kochen?
Kapitel IFeuerGeschöpfe der Flamme
Kapitel IIWasserEin Rezept in sieben Schritten
Kapitel IIILuftDie Schule eines Amateurbäckers
Kapitel IVErdeDas kalte Feuer der Gärung
Nachwort»Handgeschmack«
Anhang IVier Rezepte
Anhang IIEine kurze Liste von Büchern über das Kochen
Ausgewählte Quellen
Danksagung
VORWORT
Warum kochen?
I.
An einem bestimmten Punkt in der späten Mitte meines Lebens machte ich die unerwartete, aber erfreuliche Entdeckung, dass die Antwort auf mehrere der Fragen, die mich am meisten beschäftigten, tatsächlich ein und dieselbe war.
Kochen.
Einige dieser Fragen waren privater Natur. Zum Beispiel: Was war das Allerwichtigste, was wir als Familie tun konnten, um unsere Gesundheit und unser allgemeines Wohlbefinden zu verbessern? Oder: Wie konnte ich einen besseren Draht zu meinem pubertierenden Sohn finden? Als der beste Weg erwies sich neben den gängigen Verfahren des Kochens und Zubereitens eine spezielle Form davon, nämlich das Brauen. Andere Fragen waren dagegen etwas politischer. Schon seit Jahren hatte ich nach der Antwort auf eine Frage gesucht, die mir oft gestellt wird: Was ist das Wichtigste, was ein Durchschnittsmensch tun kann, um dazu beizutragen, die amerikanische Nahrungsmittelwirtschaft zu reformieren und sie gesünder und nachhaltiger zu machen? Eine weitere, damit zusammenhängende Frage lautet: Wie können Menschen, die in einer hoch spezialisierten Konsumgesellschaft leben, von ihr unabhängiger werden? Schließlich waren da noch die eher philosophischen Fragen, über die ich brütete, seit ich mit dem Bücherschreiben begann. Zum Beispiel die, wie wir in unserem täglichen Leben zu einem tieferen Verständnis der Natur und der besonderen Rolle unserer Spezies darin kommen können. Natürlich kann man sich mit derlei Fragen auf einem Waldspaziergang auseinandersetzen, ich stellte allerdings fest, dass man auf weit interessantere Antworten stößt, indem man einfach in die Küche geht.
Das hätte ich, wie gesagt, nie erwartet. Kochen gehörte immer zu meinem Leben, allerdings eher so wie meine Möbel, also nicht als Untersuchungsobjekt und Forschungsfeld, geschweige denn war es eine Leidenschaft. Ich schätzte mich glücklich, ein Elternteil – meine Mutter – zu haben, das gerne kochte und uns fast jeden Abend eine köstliche Mahlzeit vorsetzte. Da ich als Kind oft in der Küche herumhing, während meine Mutter das Essen zubereitete, kam ich an diesem Ort ganz gut zurecht, als ich schließlich in eine eigene Wohnung zog. Dort kochte ich zwar, wenn ich Zeit dazu hatte, doch ich nahm mir selten Zeit dafür und dachte auch nicht groß darüber nach. So hatten sich meine Kochkenntnisse kaum weiterentwickelt, als ich dreißig wurde. Ehrlich gesagt verließ ich mich bei der Zubereitung meiner erfolgreichsten Gerichte stark auf die Kochkünste anderer, wenn ich etwa meine leckere Salbeibutter über fertig gekaufte Ravioli träufelte. Ab und zu schaute ich in ein Kochbuch oder schnitt ein Rezept aus der Zeitung aus, um mein kleines Repertoire durch ein neues Gericht zu erweitern. Oder ich kaufte ein neues Küchenutensil, allerdings lagen die meisten dieser Anschaffungen am Ende unbenutzt im Schrank herum.
Im Rückblick überrascht mich mein geringes Interesse am Kochen, da mein Interesse an allen anderen Gliedern der Nahrungskette immer groß war. Seit meinem achten Lebensjahr habe ich gegärtnert, besonders Gemüse angebaut, und es hat mir immer Spaß gemacht, mich auf Farmen herumzutreiben und über Landwirtschaft zu schreiben. Ich habe auch schon recht viel über das andere Ende der Nahrungskette geschrieben – über das Essen, meine ich, und über den Einfluss unserer Ernährung auf unsere Gesundheit. Aber über die mittleren Glieder der Nahrungskette, über die Verwandlung von Natur in Dinge, die wir essen und trinken, machte ich mir eigentlich keine großen Gedanken.
Das änderte sich erst, als ich ein merkwürdiges Paradox zu ergründen versuchte, das mir beim Fernsehen bewusst geworden war: Wie kommt es, dass wir Amerikaner in einer Zeit, in der wir die Zubereitung unserer Mahlzeiten zunehmend der Lebensmittelindustrie überlassen, immer mehr Zeit damit zubringen, über Nahrungsmittel nachzudenken und anderen Leuten im Fernsehen beim Kochen zuzusehen? Je weniger wir in unserem eigenen Leben selbst kochen, desto mehr faszinieren uns anscheinend Nahrungsmittel und deren Zubereitung durch andere.
Die Amerikaner befinden sich, was dieses Thema betrifft, offenbar in einem Zwiespalt. Statistiken bestätigen, dass wir von Jahr zu Jahr weniger selbst kochen und immer mehr Fertiggerichte kaufen. Die Zeit, die in amerikanischen Haushalten auf die Zubereitung von Mahlzeiten verwendet wird, halbierte sich seit der Mitte der 60er-Jahre, in denen ich meiner Mutter beim Kochen zuschaute, auf knapp 27 Minuten pro Tag. Die Amerikaner verbringen damit weniger Zeit als der Rest der Welt, der generelle Abwärtstrend ist jedoch global. Gleichzeitig reden wir dafür mehr übers Kochen – und sehen anderen beim Kochen zu, lesen Bücher darüber und gehen in Restaurants, in denen wir live mitverfolgen können, wie dort gekocht wird. Wir leben in einer Zeit, in der Profiköche prominent sind, einige von ihnen sind so berühmt wie Sport- oder Filmstars. Die gleiche Tätigkeit, die viele Menschen als Plackerei betrachten, gelangte irgendwie in den Rang eines beliebten Zuschauersports. Wenn man sich überlegt, dass 27 Minuten weniger Zeit sind, als eine Folge von Top Chef oder The Next Food Network Star dauert, wird einem klar, dass inzwischen Millionen von Menschen mehr Zeit damit zubringen, Kochsendungen im Fernsehen anzuschauen, als selbst zu kochen. Ich muss wohl nicht darauf hinweisen, dass wir die Gerichte, die im Fernsehen gekocht werden, nicht zu essen bekommen.
Das ist schon eigenartig. Schließlich schauen wir uns ja auch keine Fernsehsendungen übers Nähen, Sockenstopfen oder den Ölwechsel beim Auto an und lesen auch keine Bücher darüber. Diese drei anderen häuslichen Tätigkeiten haben wir nur zu gern anderen überlassen – und dann umgehend aus unserem Bewusstsein verbannt. Kochen hingegen ist irgendwie etwas anderes. Diese Arbeit, oder dieser Prozess, hat sich einen emotionalen oder psychologischen Reiz bewahrt, dem wir uns nicht ganz entziehen können oder wollen. Und tatsächlich fragte ich mich, nachdem ich etliche Kochsendungen im Fernsehen angeschaut hatte, ob das Kochen, das mir immer als etwas Selbstverständliches erschienen war, es vielleicht verdiente, etwas ernster genommen zu werden.
Ich entwickelte ein paar Theorien, um das »Kochparadox«, wie ich es nannte, zu erklären. Die erste und naheliegendste lautet, dass anderen beim Kochen zuzusehen eigentlich gar kein neues menschliches Verhalten ist. Selbst als noch »alle« kochten, gab es viele, die hauptsächlich zuschauten: Männer zum größten Teil und Kinder. Die meisten von uns erinnern sich gerne daran, wie sie früher in der Küche ihrer Mutter bei der Arbeit zuschauten. Ihre Kochkünste sahen manchmal aus wie Hexerei, und das Ergebnis war üblicherweise ein leckeres Essen. Im alten Griechenland gab es für »Koch«, »Metzger« und »Priester« nur ein Wort – mageiros. Es hat eine gemeinsame etymologische Wurzel mit dem Wort »Magie«. Ich jedenfalls sah immer fasziniert zu, wenn meine Mutter ihre magischsten Gerichte zauberte, zum Beispiel ihre panierten Hähnchenrouladen Kiew. Wenn man sie mit einem scharfen Messer aufschnitt, quollen geschmolzene Butter und würzige Kräuter heraus. Selbst wenn meine Mutter nur gewöhnliches Rührei machte, fand ich es fesselnd, wie der klebrige gelbe Schleim die Form von duftenden Goldnuggets annahm. Noch das alltäglichste Gericht durchläuft einen magischen Verwandlungsprozess, nach dem es etwas mehr ist als die Summe seiner Zutaten. Und in fast jedem Gericht finden sich neben den kulinarischen Zutaten auch die Bestandteile einer Geschichte: ein Anfang, eine Mitte und ein Ende.
Dann sind da noch die Köche selbst, die Helden, die diese kleinen Verwandlungsschauspiele aufführen. Die Rhythmen und Abläufe ihrer Arbeit verschwinden zwar allmählich aus unserem eigenen Alltag, dennoch ziehen sie uns an. Diese Arbeit wirkt so viel konkreter und befriedigender als die eher abstrakten Tätigkeiten, die die meisten von uns heutzutage in ihren Jobs ausführen. Köche haben es nicht nur mit Tastaturen oder Bildschirmen zu tun, sondern nehmen so ursprüngliche Dinge wie Pflanzen, Tiere und Pilze in die Hände. Und sie arbeiten mit den Urelementen Feuer, Wasser, Luft und Erde. Sie beherrschen sie und nutzen sie für ihre köstliche Alchemie. Wie viele von uns üben noch Tätigkeiten aus, bei denen sie in so direktem Kontakt zur materiellen Welt stehen, der – vorausgesetzt, die Hähnchenrouladen Kiew laufen nicht vorzeitig aus oder das Soufflé fällt zusammen – am Ende zu einem so befriedigenden und appetitlichen Ergebnis führt?
Der Grund, warum wir gerne Kochsendungen ansehen und Bücher übers Kochen lesen, könnte also sein, dass das Kochen einige Aspekte hat, die wir wirklich vermissen. Wir denken vielleicht, wir hätten nicht genug Zeit, Energie oder Kochkenntnisse, um jeden Tag selbst zu kochen, wir wollen das Kochen jedoch nicht vollständig aus unserem Leben verschwinden sehen. Wenn es, wie Anthropologen meinen, eine prägende menschliche Tätigkeit ist – der Akt, mit dem nach Lévi-Strauss Kultur überhaupt beginnt –, dann sollte es uns nicht überraschen, dass es tiefe emotionale Saiten in uns berührt, wenn wir zusehen, wie sich die Prozesse des Kochens vor uns offenbaren.
Die Vorstellung, das Kochen sei eine entscheidende menschliche Tätigkeit, ist nicht neu. So schrieb der schottische Autor James Boswell 1773 den Satz »Kein Tier ist ein Koch« und nannte den Homo sapiens »das kochende Tier«. Womöglich hätte er diese Definition noch einmal überdacht, wenn er die Tiefkühlabteilungen unserer heutigen Supermärkte hätte sehen können. Fünfzig Jahre später behauptete der französische Gastrosoph Jean Anthelme Brillat-Savarin in seiner Physiologie des Geschmacks, das Kochen mache uns zu dem, was wir sind. Indem es die Menschen lehrte, das Feuer zu nutzen, habe es am stärksten zur Entwicklung der Zivilisation beigetragen. 1964 berichtete Lévi-Strauss in Das Rohe und das Gekochte, dass in vielen Kulturen der Welt eine ganz ähnliche Auffassung herrscht, wonach das Kochen als symbolische Handlung den Unterschied zwischen Mensch und Tier ausmacht.
Für Lévi-Strauss war das Kochen eine Metapher für die Verwandlung von roher in gekochte Natur durch den Menschen. In den Jahrzehnten nach der Veröffentlichung von Das Rohe und das Gekochte griffen andere Anthropologen seine Vorstellung auf, die Erfindung des Kochens könne der evolutionäre Schlüssel zu unserer Menschlichkeit sein. Vor einigen Jahren veröffentlichte Richard Wrangham, ein Anthropologe und Primatenforscher von der Harvard-Universität, ein bestechendes Buch mit dem Titel Feuer fangen, in dem er argumentierte, es sei die Erfindung des Kochens durch unsere frühen Vorfahren – und nicht die Herstellung von Werkzeugen, der Verzehr von Fleisch oder die Sprache – gewesen, die uns vom Affen abhob und menschlich machte. Seiner »Kochhypothese« zufolge veränderte das Aufkommen gekochter Nahrung den Verlauf der menschlichen Evolution. Weil diese Kost energiereicher und leichter verdaulich war, konnten die Gehirne unserer Vorfahren wachsen (denn Gehirne sind notorische Energiefresser) und ihre Verdauungsorgane schrumpfen. Da es viel mehr Zeit und Energie kostet, rohe Nahrung zu kauen und zu verdauen, haben Primaten unserer Größe einen deutlich größeren Verdauungstrakt als wir und verbringen viel mehr Zeit mit Kauen – etwa sechs Stunden am Tag.
Das Kochen nahm uns also sozusagen einen Teil der Arbeit des Kauens und Verdauens ab und vollzog ihn außerhalb unseres Körpers, unter Verwendung äußerer Energiequellen. Zudem konnten wir mit dieser neuen Technologie viele mögliche Kalorienlieferanten entgiften und uns dadurch neue Nahrungsquellen erschließen, die andere Lebewesen nicht nutzen konnten. Als die Menschen nicht mehr den ganzen Tag lang große Mengen roher Nahrung sammeln und stundenlang kauen mussten, konnten sie die so gesparte Zeit und Energie für andere Zwecke wie die Entwicklung einer Kultur nutzen.
Tatsächlich bescherte uns das Kochen aber nicht nur die Mahlzeit, sondern auch die Möglichkeit, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort gemeinsam zu essen. Das war etwas Neues unter der Sonne, denn als wir noch den ganzen Tag mit der Suche nach roher Nahrung beschäftigt waren, aßen wir wahrscheinlich unterwegs und allein, wie alle anderen Tiere – beziehungsweise wie die Konsumenten industriell verarbeiteter Nahrung, zu denen wir in den letzten Jahrzehnten geworden sind, die sich an einer Tankstelle Fertigsnacks besorgen und sie allein futtern, wann immer und wo immer sie wollen. Doch als wir uns zu gemeinsamen Mahlzeiten ums Feuer versammelten, Augenkontakt herstellten, Essen teilten und Selbstbeherrschung übten, förderte dies unsere Zivilisierung. Um dieses Feuer herum »wurden wir zahmer«, schrieb Wrangham.
So veränderte uns das Kochen, und zwar nicht nur, indem es uns geselliger und umgänglicher machte. Sobald es uns erlaubte, unsere kognitive Kapazität auf Kosten der Kapazität unseres Verdauungssystems zu erweitern, gab es kein Zurück mehr: Unsere großen Gehirne und kleinen Verdauungsorgane machten uns von gekochtem Essen abhängig. (Rohköstler aufgemerkt!) Das bedeutet, dass das Kochen nun eine Notwendigkeit ist – es wurde sozusagen in unsere Biologie einprogrammiert. Was Winston Churchill einmal über Architektur sagte – »Zuerst gestalten wir Gebäude, dann gestalten sie uns« –, könnte auch übers Kochen gesagt werden. Zuerst veränderten wir unsere Nahrung, dann veränderte sie uns.
Sollte das Kochen für die menschliche Identität, Biologie und Kultur von so entscheidender Bedeutung sein, wie Wrangham annimmt, leuchtet es ein, dass sein Rückgang beträchtliche Konsequenzen für das moderne Leben hat. Sind diese Konsequenzen alle negativ? Keineswegs. Die Möglichkeit, einen großen Teil der Kocharbeit Unternehmen zu überlassen, befreite die Frauen von ihrer traditionell alleinigen Verantwortung für die Ernährung der Familie und erleichterte es ihnen, außer Haus zu arbeiten und Karriere zu machen. Diese Alternative zum Selbstkochen verhinderte oder entschärfte viele der Konflikte und häuslichen Streitigkeiten, die eine derart große Veränderung der Geschlechterrollen und der Familiendynamik auslösen musste. Sie half uns, alle möglichen anderen Belastungen des Familienlebens – wie längere Arbeitstage oder übervolle Terminkalender der Kinder – zu bewältigen, und sparte uns Zeit, die wir nun in andere Aktivitäten investieren konnten. Überdies brachte sie erheblich mehr Abwechslung in unseren Speiseplan. Selbst Leute ohne Kochkenntnisse und mit wenig Geld können an jedem Abend der Woche eine andere Küche genießen. Alles, was es dazu braucht, ist eine Mikrowelle.
Das sind große Vorteile. Doch was sie uns kosten, beginnen wir erst jetzt zu begreifen. Das industrielle Kochen hat gravierende Auswirkungen auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Unternehmen kochen ganz anders als Privatleute oder Profiköche, weshalb wir ihre Tätigkeit auch nicht kochen nennen, sondern »Lebensmittelverarbeitung«. Sie verwenden in der Regel viel mehr Zucker, Fett und Salz als Leute, die für andere Leute kochen. Und sie setzen neue chemische Zutaten ein, die in privaten Speisekammern kaum zu finden sind, um ihre Lebensmittel haltbarer zu machen und frischer aussehen zu lassen, als sie sind. Deshalb überrascht es nicht, dass der Rückgang des Selbstkochens mit einer Zunahme von Fettleibigkeit und aller ernährungsbedingten chronischen Krankheiten einhergeht.
Der Siegeszug des Fast Food und der Niedergang des Selbstkochens haben auch die Tradition der gemeinsamen Mahlzeit ausgehöhlt. Wir haben uns daran gewöhnt, unterschiedliche Dinge zu essen, oft unterwegs und allein. Statistiken besagen, dass wir mehr Zeit damit verbringen, »nebenher zu essen«, als richtige Mahlzeiten einzunehmen: Der fast ständige Nebenher-Konsum von Fertigsnacks wird inzwischen »secondary eating« genannt, während »primary eating« die recht deprimierende Bezeichnung für die altehrwürdige Tradition der Mahlzeit ist.
Die gemeinsame Mahlzeit ist keine Belanglosigkeit, sondern ein Grundpfeiler des Familienlebens. Dabei lernen unsere Kinder die Kunst der Konversation und die Umgangsformen der Zivilisation: Sie lernen sich mitzuteilen, anderen zuzuhören, zu warten, bis sie an der Reihe sind, Streitigkeiten beizulegen, zu argumentieren, ohne zu beleidigen. Die sogenannten »kulturellen Widersprüche des Kapitalismus« – seine Tendenz, die stabilisierenden sozialen Formen, von denen er abhängt, zu untergraben – prägen die heutigen amerikanischen Essgewohnheiten ebenso wie all die grellbunt verpackten Fertigprodukte, die die Lebensmittelindustrie erfolgreich auf unsere Esstische brachte.
Ich weiß, das sind recht pauschale Argumente für die zentrale Bedeutung des Kochens (und des Nicht-Kochens) in unserem Leben, und ein oder zwei Einwände sind durchaus in Ordnung. Unser Entscheidungsspielraum ist heute natürlich größer, als ich ihn darstellte. Wir haben nicht nur die Wahl, entweder eine Mahlzeit von Grund auf selbst zu kochen oder von Unternehmen zubereitetes Fast Food zu konsumieren. Die meisten von uns entscheiden sich für irgendetwas dazwischen. Wir bewegen uns zwischen den beiden Polen hin und her, je nach Wochentag, Anlass oder Stimmung. Vielleicht kochen wir am einen Abend alles selbst und am anderen gehen wir essen oder bestellen uns eine Mahlzeit nach Hause, oder wir improvisieren und nutzen dabei die vielfältigen und praktischen Möglichkeiten, uns das Kochen zu vereinfachen, die eine industrialisierte Lebensmittelwirtschaft bietet: die Packung Spinat aus der Tiefkühltruhe, die Dose Wildlachs aus der Speisekammer, die fertig gekauften Ravioli aus einem Laden in der Nachbarschaft oder vom anderen Ende der Welt. Seit vor über einem Jahrhundert die ersten abgepackten Lebensmittel in die Küchen gelangten, hat sich die Definition von »selbst kochen« verändert – so sehr, dass sie es mir erlaubte, meine Fertigravioli mit selbst gemachter Salbeibuttersoße als kulinarische Heldentat zu betrachten. Unter der Woche greifen die meisten von uns beim Kochen mal mehr und mal weniger auf verarbeitete Lebensmittel zurück. Neu ist jedoch, dass inzwischen sehr viele Leute an den meisten Abenden Fertiggerichte essen, die sie nur noch warm machen müssen. Alles andere hat die Lebensmittelindustrie bereitwillig für sie erledigt. »Auf ein Jahrhundert abgepackter Lebensmittel folgt nun ein Jahrhundert abgepackter Mahlzeiten«, erklärte mir ein Lebensmittelmarktforscher.
Das ist nicht nur ein Problem für unser aller Gesundheit oder unser Familienleben. Uns geht auch das Bewusstsein dafür verloren, wie unser Essen uns mit der Welt verbindet. Wir entfernen uns immer weiter von jeder direkten physischen Beteiligung an den Prozessen, durch die Rohstoffe der Natur in eine gekochte Mahlzeit verwandelt werden, und dadurch verändert sich unser Verständnis von Nahrung. Es ist tatsächlich schwer zu glauben, dass ein Essen etwas mit Natur, menschlicher Arbeit oder Fantasie zu tun hat, wenn es fertig zubereitet aus einer bunten Packung kommt. Essen wird einfach zu einem weiteren Konsumgut, zu etwas Abstraktem. Und sobald das geschieht, werden wir zu einer leichten Beute für Unternehmen, die künstliche Versionen von echter Nahrung verkaufen – ich nenne sie essbare nahrungsähnliche Substanzen. Am Ende versuchen wir uns von Bildern zu ernähren.
Vielleicht wurmt es einige Leser, dass ein Mann diese Entwicklungen kritisiert. Denn immer wenn ein Mann die Bedeutung des Kochens betont, klingt das für gewisse Leute, als wolle er die Uhr zurückdrehen und die Frauen wieder in die Küche schicken. Aber das habe ich überhaupt nicht im Sinn. Ich bin zu der Auffassung gelangt, dass das Kochen zu wichtig ist, um es nur einem Geschlecht oder einem Familienmitglied zu überlassen. Männer und Kinder sollten ebenfalls in der Küche aktiv werden, und das nicht nur aus Gründen der Fairness oder Gleichberechtigung, sondern weil sie dort so viel zu gewinnen haben. Tatsächlich konnte sich die Lebensmittelindustrie vor allem deshalb in diesen Bereich unseres Lebens hineindrängen, weil das Kochen so lange als »Frauenarbeit« abgestempelt wurde, die nicht wichtig genug war, um von Männern oder Jungen erlernt zu werden.
Es ist allerdings schwer zu sagen, was am Anfang stand: Wurde das Kochen abgewertet, weil diese Arbeit hauptsächlich von Frauen verrichtet wurde, oder blieb das Kochen größtenteils an ihnen hängen, weil die Gesellschaft diese Arbeit gering schätzte? Das Thema Küchenarbeit und Geschlechterpolitik, auf das ich in Teil II näher eingehen werde, ist hoch kompliziert und war es wohl schon immer. Seit der Antike haben bestimmte Sonderformen des Kochens einen hohen Prestigewert: Homers Krieger grillten ihr Fleisch selbst, ohne dass dies ihrem Heldenstatus oder ihrer Männlichkeit Abbruch tat. Und seither genießen Männer, die in der Öffentlichkeit oder berufsmäßig – also gegen Bezahlung – kochen, gesellschaftliche Anerkennung. Allerdings erlangten Profiköche erst in unserer Zeit den Status von Künstlern. Doch während des größten Teils der Menschheitsgeschichte wurde das meiste Essen von Frauen gekocht, die diese Arbeit außerhalb der Öffentlichkeit verrichteten und dafür keine gesellschaftliche Anerkennung erhielten. Abgesehen von den wenigen Ausnahmesituationen, in denen Männer für das Essen zuständig waren – bei religiösen Opferritualen, Grillfesten am Nationalfeiertag oder in Vier-Sterne-Restaurants –, war das Kochen traditionell Frauensache, ein wesentlicher Bestandteil der Hausarbeit und der Fürsorge für die Kinder. Deshalb verdiente es keine weitere – das heißt männliche – Beachtung.
Doch gibt es möglicherweise noch einen anderen Grund, der nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Janet A. Flammang, eine Politikwissenschaftlerin und Feministin, die eloquent die soziale und politische Bedeutung der »Arbeit mit Nahrungsmitteln« aufzeigte, vermutet in einem kürzlich erschienenen Buch mit dem Titel The Taste for Civilization, dass das Problem etwas mit den Nahrungsmitteln selbst zu tun hat, die von ihrer Natur her zur falschen Seite – zur weiblichen Seite – des Geist-Körper-Dualismus der westlichen Kultur gehören.
»Nahrung wird mit dem Tastsinn, dem Geruchssinn und dem Geschmackssinn wahrgenommen, die in der Hierarchie der Sinne einen niedrigeren Rang einnehmen als das Sehvermögen und das Gehör, die beiden Sinne, über die wir nach landläufiger Meinung Wissen erlangen«, schreibt sie. »In Philosophie, Religion und Literatur wird Nahrung meistens mit dem Körper, dem Tierischen, dem Weiblichen und dem Appetit in Verbindung gebracht – mit Dingen, die zivilisierte Männer durch Wissen und Vernunft zu überwinden suchten.«
Sehr zu ihrem Schaden.
II.
Die Prämisse dieses Buches lautet, dass das Kochen eine der interessantesten und lohnendsten menschlichen Tätigkeiten überhaupt ist, wobei es so allgemein definiert wird, dass es das ganze Spektrum an Techniken umfasst, die Menschen entwickelten, um Rohstoffe der Natur in nahrhafte und wohlschmeckende Speisen und Getränke zu verwandeln. Wirklich zu schätzen und zu verstehen begann ich dies jedoch erst, als ich mich aufmachte, es selbst zu lernen. In den drei Jahren, in denen einige begabte Lehrerinnen und Lehrer mich mit den vier wichtigsten Verwandlungen vertraut machten, die wir kochen nennen – dem Grillen über einem Feuer, dem Kochen mit Flüssigkeit, dem Brotbacken und dem Fermentieren aller möglichen Nahrungsmittel –, erwarb ich eine ganz andere Art von Wissen, als ich erhofft hatte. Klar, am Ende meiner Ausbildung gelang mir manches recht gut – besonders stolz bin ich auf mein Brot und einige meiner Schmorgerichte. Aber ich lernte auch einiges über die Natur und unsere Verbundenheit mit ihr, was ich, glaube ich, auf keine andere Art hätte lernen können. Ich lernte viel mehr, als ich je erwartet hätte, über die Natur von Arbeit und die Bedeutung von Gesundheit, über Traditionen und Rituale, über Selbstvertrauen, Gemeinschaft und die Rhythmen des täglichen Lebens. Und ich weiß nun aus eigener Erfahrung, wie befriedigend es ist, Speisen und Getränke, die ich bisher nur konsumierte, selbst herzustellen, und dies außerhalb eines merkantilen Zusammenhangs, aus reinem Vergnügen.
Dieses Buch erzählt die Geschichte meiner Ausbildung in der Küche, aber auch in der Bäckerei, der Molkerei, der Brauerei und in der Restaurant-Küche, also an einigen jener Orte, an denen in unserer heutigen Kultur ein Großteil des Kochens stattfindet. Es ist in vier Teile untergliedert, je einen für jede der großen Verwandlungen von Natur in Kultur, die wir kochen nennen. Wie ich zu meiner freudigen Überraschung feststellte, entspricht jede Verwandlung einem der klassischen Elemente – Feuer, Wasser, Luft und Erde – und hängt von ihm ab.
Ich weiß nicht genau warum, doch diese Elemente wurden jahrtausendelang und in vielen verschiedenen Kulturen als die vier unteilbaren und unzerstörbaren Bestandteile betrachtet, die die Natur ausmachen. Und sie spielen in unserer Vorstellungswelt nach wie vor eine große Rolle. Die moderne Wissenschaft verwarf zwar das traditionelle Konzept von den vier Elementen und reduzierte jedes davon auf noch elementarere Substanzen und Kräfte – das Wasser auf Wasserstoff- und Sauerstoffmoleküle, das Feuer auf einen Prozess schneller Oxidation etc. –, doch dies hat unsere gelebte Erfahrung der Natur oder unsere Vorstellung von ihr nicht wirklich verändert. Die Wissenschaft ersetzte die vier großen Elemente durch ein Periodensystem der 118 Elemente, die sie dann auf noch winzigere Teilchen reduzierte, doch diese Neuigkeiten sind bei unseren Sinnen und in unseren Träumen noch nicht angekommen.
Kochen zu lernen bedeutet auch, dass man sich mit den Gesetzen der Physik und der Chemie sowie mit Erkenntnissen der Biologie und Mikrobiologie vertraut macht. Ich stellte jedoch fest, dass die älteren vorwissenschaftlichen Elemente, allen voran das Feuer, für das Verständnis der größten Verwandlungen, aus denen das Kochen besteht, von großer Bedeutung sind, jedes auf seine eigene Weise. Denn jedes Element steht für andere Techniken der Verwandlung von Natur in Kultur, aber auch für eine andere Haltung gegenüber der Welt, eine andere Art von Arbeit und eine andere Stimmung.
Feuer ist das erste Element (beim Kochen sowieso), deshalb begann meine Ausbildung mit der elementarsten und frühesten Form des Kochens: dem Grillen von Fleisch. Mein Vorhaben, die Kunst des Kochens mit Feuer zu erlernen, führte mich weit weg von meinem Gartengrill, zu den Grillmeistern des östlichen North Carolina, wo man unter Fleischzubereitung immer noch ein ganzes Schwein versteht, das sehr langsam über einem glimmenden Holzfeuer gebraten wird. Dort lernte ich, unter Anleitung eines erfahrenen und energischen Grillmeisters, eine Form des Kochens kennen, deren Grundelemente ein Tier, Holz, Feuer und Zeit sind, und fand einen klar markierten Weg in die Vorgeschichte des Kochens: Ich begriff, was unsere frühen Vorfahren, die Urmenschen, dazu trieb, sich um das Kochfeuer zu versammeln, und wie diese Erfahrung sie veränderte. Ein großes Tier zu töten und über einem Feuer zu braten, war immer ein mit Emotionen befrachteter und spirituell aufgeladener Akt. Diese Kochform war von Anfang an mit Opferritualen verbunden, und ich stellte fest, dass deren Echos selbst heute, im 21. Jahrhundert, noch nachhallen, wenn gegrillt wird. Damals wie heute ist die Stimmung beim Kochen über einem Feuer heroisch, männlich, theatralisch, voll Prahlerei, unironisch und ein bisschen, mitunter auch mehr als nur ein bisschen, lächerlich.
Tatsächlich ist das Grillen alles, was das Kochen mit Wasser, das Thema von Teil II, nicht ist. Historisch gesehen kommt diese Methode nach dem Kochen mit Feuer, denn sie setzte die Erfindung des Kochtopfs voraus, und dieses Artefakt der Menschheitsgeschichte ist erst etwa zehntausend Jahre alt. Nun verlagert sich das Kochen nach drinnen, in den häuslichen Bereich. In diesem Kapitel widme ich mich dem alltäglichen Kochen zu Hause, seinen Techniken und Freuden sowie dem Unmut daran. Der zweite Teil dieses Buchs nimmt, passend zu seinem Thema, die Form eines einzigen langen Rezepts an und beschreibt Schritt für Schritt die uralten Techniken, die Großmütter entwickelten, um aus gewöhnlichsten Zutaten ein köstliches Essen zu zaubern: ein paar aromatische Pflanzen, etwas Fett, einige Stückchen Fleisch und ein paar Stunden Zeit zu Hause. Auch hier ging ich bei einem großartigen Profi in die Lehre, allerdings kochten wir meistens bei mir daheim in der Küche und oft mit Unterstützung meiner Familie. Das Zuhause und die Familie sind eng mit dem Thema von Teil II verknüpft.
In Teil III geht es um das Element Luft. Es ist alles, was einen schön aufgegangenen Laib Brot von einem kümmerlichen Brei aus gemahlenem Getreide unterscheidet. Indem wir herausfanden, wie wir unserer Nahrung Luft zuführen konnten, erhöhten wir sie und uns. Und verbesserten auf diese Weise erheblich, was die Natur uns in einer Handvoll Grassamen gibt. Die Geschichte der westlichen Zivilisation ist gleichzeitig die Geschichte des Brotes, dessen Herstellung wohl die erste wichtige Technologie der »Nahrungsmittelverarbeitung« ist. (Das Gegenargument kommt von den Bierbrauern, deren Technologie möglicherweise früher entwickelt wurde.) Dieses Kapitel, das in verschiedenen Bäckereien im ganzen Land spielt, unter anderem in einer Wonder-Bread-Fabrik, beschreibt, wie ich zwei persönliche Ziele verfolgte: ein perfektes, besonders lockeres und bekömmliches Brot zu backen, sowie den genauen historischen Zeitpunkt zu lokalisieren, an dem das Kochen seine verhängnisvolle Wendung nahm: nämlich wann die Zivilisation Nahrungsmittel so zu verarbeiten begann, dass sie nicht nährstoffreicher, sondern nährstoffärmer wurden.
So unterschiedlich diese ersten drei Kochmethoden sind, bei allen wird Hitze benötigt. Nicht so bei der vierten. Wie die Erde selbst ist die variantenreiche Kunst der Fermentierung darauf angewiesen, dass biologische Prozesse organische Materie von einem Zustand in einen anderen verwandeln, in dem sie interessanter und nährstoffreicher ist. Dieser Verwandlungsprozess ist der wundersamste von allen: Pilze und Bakterien, von denen viele aus der Erde stammen, erzeugen für uns intensive appetitliche Aromen und starke berauschende Getränke, indem sie ihre unsichtbare Arbeit der schöpferischen Zerstörung verrichten. Dieser Teil ist in drei Kapitel untergliedert, in denen die Fermentierung von Gemüse (zu Sauerkraut, Kimchi und Pickles aller Art), von Milch (zu Käse) und von Alkohol (zu Met und Bier) behandelt wird. Einige »Fermentos«, wie die Spezialisten auf diesem Gebiet sich nennen, zeigten mir die raffinierten Techniken, mit denen der Zersetzungsprozess gesteuert wird. Andere erklärten mir die gravierenden Folgen des modernen Krieges gegen Bakterien, die erotischen Aspekte von Ekel und die etwas verdrehte Vorstellung, dass der Alkohol, den wir durch einen Gärungsprozess gewannen, uns selbst zum Gären brachte.
Ich hatte das Glück, dass all diese Profis, bei denen ich in die Lehre gehen durfte, weibliche wie männliche, ebenso begabt wie großzügig waren. Die Köche, Bäcker, Brauer, Pickler und Käsemacher nahmen sich Zeit für mich, machten mich mit ihren Techniken vertraut und verrieten mir ihre Rezepte. Man könnte meinen, ich wäre bei der Auswahl meiner Lehrmeister unbewusst einseitig vorgegangen, denn am Ende waren viel mehr Männer als Frauen darunter. Das hatte ich nicht erwartet, doch sobald ich beschlossen hatte, mich lieber von Profis als von Amateurköchen unterrichten zu lassen – in der Hoffnung auf eine möglichst gründliche Ausbildung –, war es wahrscheinlich unvermeidlich, dass gewisse Klischees verstärkt wurden. Wie sich herausstellte, sind Grillmeister fast ausnahmslos Männer, ebenso wie Brauer und Bäcker (mit Ausnahme der Konditoren), während relativ viele Käsemacher Frauen sind. Ich entschied mich, bei einem weiblichen Küchenchef zu lernen, wie man Topfgerichte zubereitet, und wenn ich dadurch das Klischee unterstrich, dass das häusliche Kochen Frauenarbeit ist, dann nur aus einem Grund: Ich wollte mich mit genau dieser Frage näher beschäftigen. Wir können nur hoffen, dass all die Geschlechterklischees rund ums Kochen bald überwunden werden, doch wer annimmt, dies sei bereits geschehen, macht sich etwas vor.
Alles in allem ist dieses Buch ein Ratgeber, jedoch ein sehr spezieller. Jeder seiner vier Teile umkreist ein einziges Grundrezept – für ein Barbecue, ein Schmorgericht, ein Brot oder ein paar fermentierte Nahrungsmittel –, und am Ende sollten jede Leserin und jeder Leser das nötige Rüstzeug haben, um es nachzukochen, falls sie oder er das möchte. (Die genauen Rezepte stehen im Anhang I.) Obwohl alle von mir beschriebenen Speisen und Getränke in einer ganz gewöhnlichen Küche hergestellt werden können, geht es nur in einem Teil des Buches direkt um die Art von Arbeit, die die meisten Leute unter »häuslichem Kochen« verstehen. So handelt es sich bei mehreren Rezepten um solche für Dinge, die die meisten Leserinnen und Leser wahrscheinlich nie selbst herstellen werden – Bier, Käse oder Brot zum Beispiel. Ich hoffe allerdings, dass sie es doch tun, denn ich stellte fest, dass man viel lernen kann, wenn man sich, zumindest einmal, an diese ehrgeizigeren und zeitaufwendigeren Formen des Kochens heranwagt. Das dabei erworbene Wissen mag zunächst nicht besonders nützlich erscheinen, doch es verändert nachhaltig die eigene Einstellung zu Nahrung und zu allem, was in der Küche möglich ist. Ich will versuchen, das zu erklären.
Das Kochen ist im Grunde kein Einzelprozess, sondern besteht aus verschiedenen Techniken, die zu den wichtigsten gehören, die die Menschen je erfanden. Sie veränderten uns zunächst als Spezies und anschließend auf der Ebene der Gruppe, der Familie und des Individuums. Diese Techniken reichen von der kontrollierten Nutzung des Feuers über die Manipulation von bestimmten Mikroorganismen, um Getreide in Brot oder Alkohol zu verwandeln, bis hin zur Mikrowelle – der letzten großen Erfindung. Das Kochen ist also in Wirklichkeit eine Abfolge mehr oder weniger komplexer Prozesse, und dieses Buch versteht sich unter anderem als eine Natur- und Sozialgeschichte dieser Verwandlungen, von denen nur noch einige Bestandteil unseres Alltagslebens sind. Heute halten die meisten von uns das Käsemachen und Bierbrauen für »extreme« Formen des Kochens, weil sie sich noch nie darin versuchten, früher hingegen fanden all diese Verwandlungen ganz selbstverständlich zu Hause statt, und jeder wusste zumindest in groben Zügen, was dabei zu tun war. Heutzutage scheinen wir nur noch eine Handvoll Kochtechniken zu beherrschen. Das ist nicht nur ein Wissens-, sondern auch ein gewisser Machtverlust. Und es ist durchaus möglich, dass es der nächsten Generation bereits so exotisch und ehrgeizig – so »extrem« – erscheinen wird, eine Mahlzeit von Grund auf selbst zu kochen, wie den meisten von uns heute, selber Bier zu brauen, Brot zu backen oder Sauerkraut einzulegen.
Wenn das geschieht – wenn wir nicht mehr wissen, wie man diese wundervollen Dinge selbst herstellt –, wird Nahrung jeden Bezug zur Arbeit menschlicher Hände, zur Natur der Pflanzen und Tiere, zur Fantasie, zur Kultur und zum sozialen Leben verloren haben. Und sich stattdessen auf dem Weg in den Äther der Abstraktion befinden, wo sie zu nichts weiter als einem Energielieferanten oder zum bloßen Bild wird. Wie also können wir sie wieder auf die Erde zurückholen?
Ich behaupte in diesem Buch, dass der beste Weg, uns wieder bewusst zu machen, was Nahrung wirklich ist, und ihr wieder den Platz in unserem Leben zu geben, den sie verdient, darin besteht, die physischen Prozesse ihrer traditionellen Herstellung beherrschen zu lernen. Die gute Nachricht ist, dass uns das jederzeit möglich ist, egal wie begrenzt unsere Kochkenntnisse sind. Meine eigene Lehrzeit machte es erforderlich, dass ich meine Küche und meine Komfortzone verließ und mich in entlegenere Gefilde des Kochens begab, in der Hoffnung, dort die grundlegenden Fakten zu dessen verschiedenen Formen zu erfahren und herauszufinden, was genau an diesen Verwandlungsprozessen dazu beitrug, uns zu dem zu machen, was wir sind. Meine vielleicht erfreulichste Erkenntnis war jedoch, dass die Wunder der Kochkunst, selbst ihre anspruchsvollsten Formen, auf einer Magie beruhen, die uns allen nach wie vor zugänglich ist, sogar in unserer eigenen Küche.
Ich sollte hinzufügen, dass mir diese Reise großen Spaß machte, wahrscheinlich den größten, den ich je hatte, während ich angeblich »arbeitete«. Welche Entdeckung ist erfreulicher als die, dass man etwas Köstliches oder auch Berauschendes, von dem man bisher annahm, dass man es immer auf dem Markt würde kaufen müssen, tatsächlich selbst herstellen kann? Welcher Zustand ist entspannender als der, in dem die Grenze zwischen Arbeit und Spiel in einer Wolke aus Brotmehl oder duftendem Dampf aus einem kochenden Kessel verschwindet?
Selbst aus scheinbar völlig misslungenen Kochexperimenten lernte ich unerwartet nützliche Dinge. Wenn man schon probiert hat, Gemüse einzulegen, Bier zu brauen und ein ganzes Schwein langsam zu grillen, traut man sich beim alltäglichen Kochen viel mehr zu, und in mancher Hinsicht wird es auch einfacher. Was ich von den Grillmeistern lernte, half mir, meine Grillkünste im eigenen Garten zu perfektionieren. Das Arbeiten mit Brotteig lehrte mich, in der Küche auf meine Hände und Sinne und deren Botschaften zu vertrauen, was mich von Rezepten und dem Messbecher unabhängiger machte. Seit ich einige Zeit in traditionellen Bäckereien und in einer Wonder-Bread-Fabrik verbrachte, weiß ich besser, was ein gutes Brot ausmacht, und schätze es noch viel mehr. Das Gleiche gilt für eine Ecke Käse und eine Flasche Bier: Was bisher nur ein – gutes oder schlechtes – Produkt war, erwies sich als viel mehr – als eine Leistung, als eine Ausdrucksform und als etwas Verbindendes. An sich würde schon diese Steigerung des Ess- und Trinkvergnügens allein die ganze sogenannte Arbeit rechtfertigen.
Aber die vielleicht wichtigste Erkenntnis, die ich bei dieser Arbeit gewann, war, dass uns das Kochen in ein ganzes Netz sozialer und ökologischer Beziehungen einbindet: mit Pflanzen und Tieren, mit dem Boden, mit Bauern, mit den Mikroben in uns und um uns herum, und natürlich mit den Leuten, die das, was wir kochen, ernährt und erfreut. Was ich in der Küche vor allem lernte, war, dass Kochen verbindet. In all seinen Varianten, von den alltäglichen bis zu den extremen, weist es uns in der Welt eine ganz besondere Position zu, an der wir mit der natürlichen Welt auf der einen Seite und der sozialen Welt auf der anderen konfrontiert sind. Der Koch steht genau zwischen Natur und Kultur. Er übernimmt die Rolle des Vermittlers zwischen den beiden Welten und bringt sie zusammen. Diese Arbeit verwandelt sowohl die Natur als auch die Kultur und, wie ich dabei herausfand, den Koch ebenfalls.
III.
Mit der Zeit wurde ich in der Küche immer sicherer. Ähnlich wie das Gärtnern nimmt einen das Kochen auf eine angenehme Art in Anspruch, ohne einen intellektuell allzu sehr zu fordern. Es lässt einem reichlich Raum für Tagträume und Reflexionen. Ich dachte dabei unter anderem über die Frage nach, warum ich freiwillig eine Arbeit verrichtete, die in unserer Zeit eigentlich unnötig geworden ist, eine Arbeit, für die ich weder besonders begabt noch qualifiziert bin, sodass ich vielleicht nie wirklich gut darin werde. Das ist die unausgesprochene Frage, die in der modernen Welt immer im Raum steht, wenn wir etwas kochen. Warum machen wir uns diese Mühe?
Rein rational betrachtet ist wohl selbst das tägliche Kochen zu Hause keine kluge Nutzung unserer Zeit – vom Brotbacken oder Fermentieren von Kimchi ganz zu schweigen. Diese Auffassung vertraten zumindest die Zagats – das Ehepaar, das die Zagat-Restaurantführer herausgibt – in einem Artikel über die Gastronomie, der kürzlich im Wall Street Journal erschien. Statt nach der Arbeit heimzugehen und zu kochen, sollten die Leute lieber eine Stunde länger im Büro bleiben und das tun, was sie gut können, und dann preiswerte Restaurants das tun lassen, was diese am besten können, meinten die Zagats.
Das ist, in Kurzform, das klassische Argument für die Arbeitsteilung, der wir, wie Adam Smith und unzählige andere betonten, viele Segnungen der Zivilisation verdanken. Sie ermöglicht es mir, davon zu leben, dass ich vor einem Bildschirm sitze und schreibe, während andere meine Nahrung anbauen, meine Kleidung nähen und die Energie erzeugen, die mein Haus beleuchtet und heizt. Wahrscheinlich verdiene ich mehr Geld, wenn ich eine Stunde lang schreibe oder unterrichte, als ich spare, wenn ich eine Woche lang selbst koche. Die Spezialisierung hat unbestreitbar große soziale und wirtschaftliche Vorteile. Aber sie schwächt uns auch. Sie erzeugt Hilflosigkeit, Abhängigkeit und Ignoranz und untergräbt letztendlich jedes Verantwortungsbewusstsein.
Unsere Gesellschaft weist uns sehr begrenzte Rollen zu: Wir stellen bei der Arbeit ein bestimmtes Produkt her und konsumieren in der restlichen Zeit eine ganze Menge anderer Produkte, und einmal im Jahr oder so schlüpfen wir kurz in die Rolle des Staatsbürgers und geben eine Stimme ab. Wir delegieren die Erfüllung buchstäblich all unserer Bedürfnisse und Wünsche an Spezialisten der einen oder anderen Art – für unsere Mahlzeiten sind die lebensmittelverarbeitenden Unternehmen zuständig, für unsere Gesundheit die Ärzte, für unsere Unterhaltung Hollywood und die Medien, für unsere geistige Gesundheit die Psychotherapeuten oder die Pharmakonzerne, für den Naturschutz die Umweltschützer, für politische Maßnahmen die Politiker und so weiter. Allmählich können wir uns kaum noch vorstellen, irgendetwas selbst zu tun, außer der Arbeit, mit der wir unser Leben bestreiten. Wir glauben, dass wir alles andere verlernt haben oder dass andere es besser können. Unlängst etwa hörte ich von einer Agentur, die, falls man keine Zeit findet, seine alten Eltern zu besuchen, stellvertretend eine nette Person bei ihnen vorbeischickt. Anscheinend meinen wir, dass nur Fachleute oder spezielle Einrichtungen oder bestimmte Produkte unsere täglichen Bedürfnisse befriedigen und unsere Probleme lösen können. Diese erlernte Hilflosigkeit ist natürlich von großem Vorteil für die Unternehmen, die sich darum reißen, all diese Dinge für uns zu erledigen.
In unserer komplexen Wirtschaft besteht das Problem mit der Arbeitsteilung darin, dass sie es uns erschwert, die konkreten Auswirkungen unserer täglichen Handlungen und damit unsere Verantwortung für sie zu erkennen. Die Spezialisierung lässt uns leicht vergessen, wie viel Dreck das Kohlekraftwerk produziert, das unsere Hightech-Bildschirme leuchten lässt, oder welche Knochenarbeit es ist, die Erdbeeren für unser Müsli zu pflücken, oder was für ein elendes Dasein das Schwein fristete, das starb, damit wir seinen Schinken genießen können. Die Spezialisierung verschleiert unsere Verwicklung in all das, was unbekannte andere Spezialisten irgendwo auf der Welt für uns tun.
Was ich am Kochen vielleicht am meisten schätze, ist, dass es ein wirkungsvolles Korrektiv dieser Lebensweise ist – eine Möglichkeit, etwas an ihr zu verändern, die wir alle nach wie vor haben. Wenn man eine Schweineschulter zerlegt, wird man zwangsläufig daran erinnert, dass dies die Schulter eines großen Säugetiers ist, die aus verschiedenen Muskelgruppen besteht, deren ursprünglicher Zweck nicht darin bestand, uns zu ernähren. Die Arbeit selbst weckt bei mir ein größeres Interesse an der Geschichte des Schweins: Wo kam es her? Und auf welchem Weg gelangte es in meine Küche? Sein Fleisch fühlt sich eher an wie ein Naturprodukt als wie ein Industrieprodukt, eigentlich gar nicht wie ein Produkt. Und der Anbau des Blattgemüses, das ich zu diesem Schwein serviere und das im späten Frühjahr fast so schnell nachzuwachsen scheint, wie ich es schneiden kann, erinnert mich ständig an die Fülle der Natur, an das tägliche Wunder der Verwandlung von Lichtphotonen in etwas Köstliches.
Die Beschäftigung mit diesen Pflanzen und Tieren, die Erzeugung und Zubereitung von zumindest einem Teil des eigenen Essens haben die heilsame Wirkung, dass sie die Verbindungen wieder sichtbar werden lassen, die durch Supermärkte und Fertiggerichte erfolgreich ins Undurchschaubare gerückt wurden, aber natürlich nach wir vor bestehen. Gleichzeitig übernimmt man dadurch auch wieder eine gewisse Mitverantwortung und wird zumindest ein wenig bedachter in seinen Äußerungen.
Das gilt besonders für Äußerungen über »die Umwelt«, die plötzlich nicht mehr »irgendwo da draußen« ist, sondern viel näher erscheint. Denn was ist die Umweltkrise, wenn nicht eine Krise unserer Lebensweise? Das große Problem ist nicht mehr und nicht weniger als das Gesamtergebnis unzähliger kleiner alltäglicher Entscheidungen, die größtenteils wir Verbraucher treffen – die Konsumausgaben machen fast drei Viertel der amerikanischen Wirtschaft aus –, und die übrigen fällen andere im Namen unserer Bedürfnisse und Wünsche. Wenn die Umweltkrise letztlich eine Krise des Charakters ist, wie Wendell Berry uns in den 1970ern erklärte, dann werden wir uns früher oder später auf dieser Ebene mit ihr auseinandersetzen müssen – zu Hause, in unseren Gärten und Küchen.
Sobald man diese Sichtweise einnimmt, erscheint der alltägliche Wirkungskreis Küche in einem ganz neuen Licht. Sie wird wichtiger, als wir uns je vorstellen konnten. Der unausgesprochene Grund, warum politische Reformer von Wladimir Iljitsch Lenin bis Betty Friedan die Frauen aus der Küche holen wollten, war, dass dort nichts von Bedeutung stattfand – nichts, was ihren Talenten, ihrer Intelligenz und ihren Überzeugungen entsprach. Die einzig angemessenen und anerkannten Arenen, um etwas zu bewirken, waren der Arbeitsplatz und der öffentliche Raum. Aber das war, bevor die Umweltkrise sich abzeichnete und die gravierenden Auswirkungen der Industrialisierung unseres Essens auf unsere Gesundheit erkennbar wurden. Öffentliches Engagement wird immer nötig sein, um die Welt zu verändern, doch in unserer Zeit genügt das nicht mehr. Wir müssen auch unsere Lebensweise ändern, denn die Orte unseres täglichen Umgangs mit der Natur – unsere Küchen, Gärten, Häuser, Autos – sind heute für das Schicksal der Welt von größerer Bedeutung als je zuvor.
Kochen oder nicht kochen wird also zu einer wichtigen Frage. Ich weiß, das ist etwas überspitzt formuliert. Kochen hat für unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Bedeutungen. Es ist selten eine Alles-oder-Nichts-Option. Doch selbst wenn man an mehr Abenden kocht als bisher, am Sonntag ein paar Mahlzeiten für die Woche zubereitet oder vielleicht ab und zu versucht, etwas selbst zu machen, was man bisher immer fertig kaufte, sind diese kleinen Veränderungen eine Art Votum. Ein Votum wofür genau? Nun, in einer Welt, in der nur noch wenige von uns gezwungen sind, überhaupt zu kochen, ist die Entscheidung, es trotzdem zu tun, ein Protest gegen die Spezialisierung – gegen die totale Rationalisierung des Lebens. Gegen das Vordringen kommerzieller Interessen in die allerletzten Winkel unseres Lebens. Wenn wir aus Vergnügen kochen, in unserer Freizeit, erklären wir uns unabhängig von den Unternehmen, die aus jeder Minute unseres Tages eine weitere Gelegenheit zum Konsum ihrer Produkte machen wollen. Und wenn ich es mir recht überlege, auch aus jeder Nacht: Schlaftablette gefällig? Es bedeutet, die lähmende Vorstellung zurückzuweisen, wonach die Herstellung von etwas, zumindest in unserer Freizeit, eine Arbeit ist, die am besten von jemand anderem erledigt wird, und dass die einzig legitime Form von Freizeit und Muße Konsum ist. Diese Abhängigkeit nennen Marketingfachleute »Freiheit«.
Das Kochen verwandelt nicht nur Pflanzen und Tiere. Es verwandelt auch uns – von bloßen Konsumenten in Produzenten. Nicht restlos und nicht ständig, doch schon eine kleine Verschiebung des Verhältnisses zwischen diesen beiden Identitäten beschert uns zutiefst befriedigende und überraschende Erfolgserlebnisse. Deshalb lädt dieses Buch alle Leserinnen und Leser dazu ein, das Verhältnis zwischen Produktion und Konsum in ihrem Leben zu verändern, sei es auch nur ein kleines bisschen. Jeder kann lernen, einen Teil dessen, was er zum Leben braucht, selbst herzustellen. Die regelmäßige Anwendung dieser einfachen Fertigkeiten steigert unser Selbstvertrauen und vergrößert unsere Freiheit, zugleich verringert sie unsere Abhängigkeit von kühl agierenden Konzernen. Wenn wir keines unserer täglichen Bedürfnisse selbst erfüllen können, fließt ihnen nicht nur unser Geld zu, sondern auch unsere Macht. Doch sobald wir beschließen, mehr Verantwortung für unsere Ernährung zu übernehmen, erlangen wir diese verlorene Macht wieder, und das Geld fließt an uns und an die Allgemeinheit zurück. Das war eine frühe Erkenntnis aus der wachsenden Bewegung für den Wiederaufbau einer lokalen Lebensmittelwirtschaft, deren Erfolg letztlich von unserer Bereitschaft abhängt, uns mehr Gedanken über unsere Ernährung zu machen und mehr selbst zu kochen. Nicht jeden Tag, nicht jede Mahlzeit – aber öfter als bisher, so oft wie möglich.
Das Kochen gibt uns die im modernen Leben so seltene Gelegenheit, ganz unmittelbar für uns selbst und für unsere Familie tätig zu werden. Wenn das nicht sein »Leben bestreiten« ist, dann weiß ich nicht, was das überhaupt heißen soll.
Wirtschaftlich gesehen ist das für einen Amateurkoch vielleicht nicht immer die effizienteste Nutzung seiner Zeit, auf emotionaler Ebene fällt die Bilanz dafür großartig aus. Denn ist etwas weniger egoistisch, weniger entfremdete Arbeit und weniger Zeitverschwendung, als für Menschen, die man liebt, etwas Köstliches und Nahrhaftes zu kochen?
Beginnen wir also.
Am Anfang, mit dem Feuer.
»Das Braten ist zugleich nichts und alles.«
MARQUIS DE CUSSY, L’art culinaire
»Als man sich gegenseitig auffraß und es viel Schlimmes gab, da trat ein Mann auf mit Erfindergeist und schlachtete als erster Mensch ein Tier als Opfer, briet das Fleisch, und weil es weitaus besser schmeckte als das Menschenfleisch, verzehrten sie sich nicht mehr gegenseitig …«
ATHENAIOS, Das Gelehrtenmahl
»Denn diese Kunst, sie ist ein Königreich von Rauch.«
DEMETRIUS, Der Areopagit
I.AYDEN, NORTH CAROLINA
Wenn man in die South Lee Street, die Lebensader dieser etwas verödeten kleinen Stadt, einbiegt, riecht man einen göttlichen Duft nach Holzfeuer und gebratenem Schweinefleisch, dessen Quelle laut GPS allerdings noch über einen halben Kilometer weit entfernt sein muss. Für einen Mittwochnachmittag im Mai sitzen entlang der Lee Street erstaunlich viele Erwachsene auf den Veranden vor ihren Häusern – einige weiß, die meisten schwarz – und beobachten das Geschehen. Sie nippen dabei an bernsteinfarbenen Getränken, die auch Tee sein könnten. Es ist nicht schwer zu erraten, weshalb Ayden so verödet ist. Die Stadt liegt eine Stunde von der nächsten Interstate entfernt, weit abgeschieden von so ziemlich allem Handel und Wandel. Die großen Ladenketten des Landes haben ihre Supermärkte zwanzig Kilometer nördlich in Greenville aufgestellt und damit alle geschäftlichen Aktivitäten aus Aydens Zentrum abgezogen. Die Rollläden der meisten Geschäfte bleiben inzwischen geschlossen. Früher konnte Ayden mit drei Grillrestaurants aufwarten. Heute gibt es nur noch eines, dessen Ruf sich jedoch weit genug verbreitet hat, um jeden Tag ein paar hungrige Reisende von der Interstate anzulocken. Das früher größtenteils von der Landwirtschaft geprägte Wirtschaftsleben der Stadt leidet unter dem Niedergang des Tabakanbaus – zwischen den blassen Maisfeldern findet man nur noch wenige Hektar der smaragdgrünen Tabakfelder – und dem zeitgleichen Aufkommen der CAFOs (Concentrated Animal Feeding Operations). Die Küstenebene North Carolinas gehört zu jenen Landstrichen, die den Profiten der industriellen Schweinefleischproduktion geopfert wurden, einem Industriezweig, der die Zahl der Landwirte in einer Region drastisch senkt, während gleichzeitig die Schweinepopulation extrem anwächst. Lange vor den lockenden Düften des gegrillten Fleischs waren mir entlang der grauen Straßen Richtung Ayden auch schon weniger angenehme Ausdünstungen in die Nase gestiegen.
Mein Ziel an diesem sonnigen Nachmittag im Mai war das Skylight Inn, das einzige noch existierende Grillrestaurant Aydens, und selbst ohne den Duft nach Eichen- und Hickoryholz hätte ich das Lokal unmöglich verfehlen können. Es befindet sich in einem kuriosen, um nicht zu sagen lächerlichen Backsteingebäude, einem gedrungenen, achteckigen Bauwerk, gekrönt von einem silbernen Mansardendach, auf dem sich eine Replik der Kuppel des Kapitols in Washington befindet. Über der Kuppel weht die amerikanische Flagge. Diese unförmige Hochzeitstorte legt den Verdacht nahe, dass an der Planung kein Architekt beteiligt war. Man hat eher den Eindruck, der Entwurf sei unter Einfluss von Alkohol auf einer Papierserviette entstanden. Die silberne Kuppel wurde 1984 errichtet, nachdem National Geographic das Skylight Inn ein paar Jahre zuvor zum »Kapitol des Barbecues« erklärt hatte. Es hat übrigens kein Dachfenster, skylight, merkwürdig, da die Erbauer sonst alles ziemlich wörtlich nahmen. Über dem Parkplatz ragt eine Plakatwand mit dem Werbespruch If it’s not cooked with wood it’s not Bar-B-Q (»Was nicht mit Holz gegrillt wird, ist kein echtes Barbecue«) und einer Porträtzeichnung von Pete Jones, dem verstorbenen Gründer des Restaurants. Jones heizte seine Grills zum ersten Mal im Jahr 1949 an, doch die Tafel weist darauf hin, dass die Familie schon sehr viel länger im Barbecue-Geschäft tätig ist: »Wir pflegen die Tradition unserer Familie seit 1830.« Der Familienlegende zufolge, soll ein Vorfahre namens Skilton Dennis im Jahr 1830 den ersten Barbecue-Betrieb North Carolinas, wenn nicht gar der ganzen Welt, eröffnet haben, als er unweit von hier aus einem Planwagen gegrilltes Schweinefleisch mit Maisbrotfladen verkaufte. Samuel Jones, Enkel von Pete und einer der drei Jones-Männer, die die Familientradition auch heute noch pflegen, nennt diese Pioniere des Barbecue-Geschäfts ganz ohne Ironie »unsere Ahnen«.
Das alles und noch vieles mehr wusste ich schon, bevor ich meinen Fuß zum ersten Mal ins Skylight Inn setze: Ich hatte die Zusammenfassungen mündlicher Überlieferungen gelesen und mir Dokumentarfilme zum Thema angeschaut. Heute gibt es über das Barbecue in den Südstaaten kaum noch etwas Wissenswertes, das nicht schon haarklein dokumentiert und überschwänglich gepriesen worden wäre. Diese ehemals wenig beachtete, volkstümliche Kochtradition ist aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht und erstaunlich selbstbewusst geworden. Jeder Grillmeister aus dem Süden, der etwas auf sich hält – und an Selbstbewusstsein mangelt es den meisten von ihnen nun wirklich nicht –, hat Unmengen markiger Sprüche auf Lager, die denen eines Politikers an Volkstümelei und Abgedroschenheit in nichts nachstehen. Und auch an Gelegenheiten, diese Sprüche an den Mann zu bringen, mangelt es nicht, sei es auf Grillwettbewerben, vor interessierten Journalisten oder auf wissenschaftlichen Kongressen, organisiert von der Southern Foodways Alliance.
Ich selbst war in North Carolina allerdings weniger auf der Suche nach einem markigen Spruch als vielmehr nach einem wirklich neuen Geschmackserlebnis und der Bestätigung einer Theorie, die sich kurz gefasst so formulieren lässt: Wenn von den wenigen Methoden, die sich der Mensch ausgedacht hat, um Gaben der Natur in nahrhafte und schmackhafte Speisen zu verwandeln, das Kochen mit Feuer die erste und elementarste war, dann müsste – zumindest für einen Amerikaner – das Grillen eines kompletten Schweins über einem Holzfeuer eigentlich die reinste und ursprünglichste Form dieser Kunst sein. Nachdem ich mich ausführlich darüber informiert hatte, wie man das macht und welchen Platz das Grillen eines Schweins in einer Gemeinschaft oder Kultur einnehmen kann, hoffte ich, auch etwas über die tiefere Bedeutung dieser eigenartigen und ausschließlich menschlichen Betätigung zu erfahren, die wir Kochen nennen. Und natürlich wollte ich nebenbei auch meine eigenen Grillkünste ein wenig verbessern. Das Kochen ist inzwischen ein solcher Marketinghype geworden, so geräteintensiv und prätentiös, dass der Versuch, es auf seine Grundelemente zu reduzieren und es ganz nüchtern zu betrachten, eine gute Methode zu sein schien, diese Tätigkeit ganz neu zu begreifen, und ich hatte gute Gründe zu glauben, dass die Grillhütte des Skylight Inn der richtige Ort dafür sein könnte.
Die Suche nach Authentizität ist ein problematisches und oft auch zweifelhaftes Unterfangen, ganz besonders im Süden der Vereinigten Staaten und in Zeiten eines gesteigerten gastronomischen Qualitätsbewusstseins. Als ich eine Freundin, Küchenchefin in Chapel Hill, fragte, wohin sie gerne für ein Barbecue gehe, konnte ich sie in ihrer E-Mail fast seufzen hören: »Jedes Mal wenn ich durch North Carolina fahre, denke ich, ich müsste gleich auf das perfekte Grillrestaurant stoßen, eines, in dem die Zeit stehen geblieben ist. Aber bislang habe ich es noch nicht gefunden.« Bis nach Ayden hinaus hatte es meine Freundin allerdings noch nicht geschafft, deshalb gestattete ich mir, weiter zu hoffen.
Ich suchte also eine Antwort auf die drängende Ausgangsfrage: Was ergibt Schweinefleisch plus Holzfeuerrauch plus Zeit? Und das eben im Grill hinter dem Skylight Inn. Laut einem Barbecue-Historiker – ja, es gibt tatsächlich Grill-Historiker – handelte es sich bei der Familie Jones um »Barbecue-Fundamentalisten«, die sich seit mehreren Generationen weigerten, von ihrer Urformel abzuweichen: dem sehr langsamen Grillen ausschließlich ganzer Schweine auf »selbst hergestellten« Eichen- und Hickorykohlen. Fertige Holzkohle verschmähen sie als minderwertiges modernes Zeug und das Verwenden von Soße als »Vertuschung schlecht ausgeführten Grillhandwerks«. Dem verführerischen Geruch nach zu urteilen, der aus ihren Kaminen drang, hatte die Familie Jones sich und ihren Kunden mit der Treue zu alten Traditionen einen guten Dienst erwiesen. Und er rechtfertigte auch die heldenhafte Verteidigung ihrer »aussterbenden Kunst« gegen die bedrohlichen Angriffe feindlicher Mächte: die Kontrollen des Gesundheitsamts, die wachsende Kritik der Feuerwehr, die Annehmlichkeiten von Gas und Edelstahl, der Mangel an Feuerholz, die Allgegenwärtigkeit der Fast-Food-Ketten und seitens der Grillmeister der Wunsch nach ordentlichem Nachtschlaf, aus dem sie nicht ständig durch Träume von einem Großbrand gerissen wurden. Oder besser gesagt Sirenen. Ich hatte gehört, dass in der Grillhütte des Skylight Inn regelmäßig Feuer ausgebrochen und sie schon mehr als einmal völlig niedergebrannt war. Jeder, der auf offenem Feuer kocht, wird bestätigen, dass es dabei nur auf eines ankommt: Kontrolle. Die zu behalten scheint aber auch im 21. Jahrhundert sehr viel schwieriger zu sein, als man gemeinhin annimmt.
••••••••••
Die Beherrschung des Feuers haben Menschen vor Urzeiten erlernt; sie markiert einen so entscheidenden Wendepunkt in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, dass zahlreiche Mythen und Theorien dazu entstanden sind. Einige davon sind schlicht aberwitzig, und zwar nicht nur die aus grauer Vorzeit. Etwa die These von Sigmund Freud, die er in Das Unbehagen in der Kultur in einer Fußnote aufstellt. Freud führt die Kontrolle des Feuers auf den folgenreichen Moment zurück, als der Mann – und er meint in diesem Kontext tatsächlich den Mann – erstmals den Drang überwand, jedes Feuer, auf das er zufällig stieß, auszupinkeln. Jahrtausendelang hatte sich dieser Drang als scheinbar unbezwingbar erwiesen, zum großen Nachteil unserer Zivilisation, die erst aufblühte, nachdem er unterdrückt werden konnte. Möglicherweise aus dem Grund, dass Frauen nicht besonders gut geeignet sind, mit einem Urinstrahl Feuer zu löschen, wurde diese Beschäftigung zu einer wichtigen Form männlichen Wettbewerbs und war laut Freud, was nicht wirklich überrascht, homoerotisch geprägt. Das Kochen auf offenem Feuer ist bis heute eine Domäne, in der Männer miteinander konkurrieren, und diejenigen unter uns, die sich diesem Konkurrenzkampf stellen, sollten froh sein, dass Freud nicht da ist, um uns seine Analyse dessen anzudienen, was genau wir da eigentlich treiben.
Der Lauf der Menschheitsgeschichte nahm an jenem schicksalhaften Tag eine Wendung, als es einem ungewöhnlich beherrschten Mann dämmerte, dass er nicht zwingend ins Feuer pinkeln musste, sondern es stattdessen am Brennen halten und sinnvoll nutzen konnte: um sich daran zu wärmen oder sein Abendessen darauf zu grillen. Freud war der Ansicht, dieser Fortschritt sei, wie viele wertvolle Errungenschaften der Zivilisation, der einzigartigen menschlichen Fähigkeit zu verdanken, Begierden und Triebe, denen andere Tiere blindlings gehorchen müssen, zu beherrschen oder zu unterdrücken. Wobei freilich kein Tier bekannt ist, das jemals Feuer durch Pinkeln gelöscht hätte. Selbstbeherrschung ist für Freud die Voraussetzung für die Beherrschung des Feuers und diese große Kulturleistung folglich der Lohn für einen Triebverzicht.
In all den Stunden, die ich bislang mit Grillmeistern vor glimmenden Holzscheiten verbrachte, habe ich Freuds Feuerthese noch nie erwähnt. Ich bezweifle, dass sie gut ankäme. Gelegentlich habe ich allerdings eine zweite, ähnlich obskure Theorie zum Besten gegeben, die immerhin ein Körnchen poetischer Wahrheit enthält und oft ein Lächeln auf das rußgeschwärzte, von Schweißspuren zerfurchte Gesicht der Grillspezialisten zaubert.
Diese These propagiert der englische Schriftsteller Charles Lamb (1775–1834) in seiner Abhandlung über Schweinebraten. Er behauptet dort, Fleisch wurde so lange roh gegessen, bis in China ein junger Mann namens Bo-bo, der einfältige Sohn des Schweinehirten Ho-ti, durch Zufall die Kunst des Grillens entdeckte. Eines Tages, Ho-ti sammelte gerade Futter für die Schweine, brannte sein pyromanisch veranlagter Sohn, der zudem »ein echter Tölpel« war, versehentlich die Hütte der Familie ab und verkohlte dabei einen Wurf Ferkel. Er stand vor den qualmenden Überresten und überlegte, wie er das seinem Vater beibringen sollte, und dabei »stieg ihm ein Duft in die Nase, der mit nichts zu vergleichen war, was er je zuvor gerochen hatte«. Als Bo-bo eines der verbrannten Ferkel auf ein Lebenszeichen abtastete, versengte er sich dabei die Finger und schob sie instinktiv in den Mund. »An seinen Fingern waren Spuren der verbrannten Schwarte kleben geblieben, und zum ersten Mal in seinem Leben (ja, sogar im Leben der gesamten Menschheit, denn keiner vor ihm hatte so etwas je gekostet) aß er – Bratenkruste!«
Bo-bos Vater kehrte zurück und sah seine Hütte, die toten Ferkel und seinen Sohn, wie er sich mit ihnen den Bauch vollschlug. Bei diesem Anblick wurde Ho-ti übel. Der Sohn erklärte ihm aber, dass die verbrannten Ferkel ausgesprochen gut schmeckten, und angezogen von dem köstlichen Duft probierte auch Ho-ti von der Kruste. Sie war überaus wohlschmeckend. Vater und Sohn, die die Missbilligung der Nachbarn fürchteten, beschlossen, ihre Entdeckung zu verheimlichen. Denn das Verbrennen einer Kreatur Gottes bedeutete letztlich, dass dieses Geschöpf in rohem Zustand nicht vollkommen gewesen sei. Doch wenig später:
Merkwürdige Geschichten machten die Runde. Es wurde beobachtet, dass Ho-tis Hütte häufiger niederbrannte. Von nun an brannte es unaufhörlich … Jedes Mal wenn die Sau Ferkel warf, stand kurze Zeit später Ho-tis Hütte in Flammen.
Schließlich kam ihr Geheimnis doch ans Licht. Die Nachbarn erprobten diese Methode ebenfalls und waren vom Ergebnis begeistert. Das Beispiel machte Schule. Um Schweinebraten zu bekommen, wurden bald so viele Hütten niedergebrannt, dass die Errungenschaften der Baukunst der Welt verloren zu gehen drohten. »Die Leute bauten ihre Häuser immer einfacher«, berichtet uns Lamb, und »man sah nur noch Feuer, wohin man auch blickte«. Glücklicherweise erkannte schließlich ein kluger Kopf, dass man Schweinefleisch auch braten konnte, »ohne eine ganze Hütte für die Zubereitung zu opfern«. Der Bratrost wurde erfunden und kurz darauf auch der Bratspieß. So entdeckte der Mensch aus reinem Zufall die Kunst, Fleisch über offenem Feuer zu braten. Oder besser gesagt: Fleisch über einem kontrollierten offenen Feuer zu braten.
••••••••••
»Willkommen im Vorhof zur Hölle«, kicherte Samuel Jones als er mich um das Skylight Inn herumführte und mir die Grillhütte mit den Fleischgrills zeigte. Eigentlich gab es zwei dieser Hütten, kleine Gebäude aus Betonziegeln, die in einem seltsamen, eher willkürlichen Winkel zum Restaurant und auch zueinander standen. Samuel meinte dazu: »Mein Großvater hat vermutlich einen Betrunkenen angeheuert, das alles hier zu entwerfen.« Das größere Gebäude hatte man erst vor Kurzem neu errichtetet, nachdem eines Nachts eine der Backsteinfeuerstellen zusammengebrochen war und die Hütte bis auf die Grundmauern niederbrannte. »Diese Feuer brennen Tag und Nacht«, erklärt Samuel mit einem Schulterzucken, »und alle paar Jahre gehen sogar die Schamottsteine in den Kaminen eben kaputt. Diese Grillhütte ist schon ein Dutzend Mal abgebrannt. Aber so ist das eben, wenn man ganze Schweine anständig grillen will.«
Manchmal ist es auch das Schweinefett, das sich unten im Grill sammelt und dann Feuer fängt, oder ein glühender Span fliegt durch den Kamin nach oben und landet auf dem Dach. Erst neulich war Samuel, ein paar Stunden nachdem sie das Restaurant geschlossen hatten, hier vorbeigefahren und hatte Flammen unter der Tür der Grillhütte hervorzüngeln sehen. »Das war wirklich knapp«, meinte er grinsend. Eine Überwachungskamera in der Grillhütte hatte aufgezeichnet, wie das Feuer ausbrach, nur vier Minuten nachdem der Grillmeister gegangen war.
Charles Lamb wäre bestimmt begeistert, dass es in North Carolina noch immer Männer gibt, die eine ganze Hütte niederbrennen, um ein Schwein zu braten.
Samuel Jones ist 29 Jahre alt, ein fröhlicher Mann mit rundem Gesicht und Kinnbart. Seit seinem neunten Lebensjahr arbeitet er mit kleinen Unterbrechungen in diesem Familienunternehmen, auf das er unendlich stolz ist. Er hält es für seine Pflicht, die alten Traditionen nicht nur zu pflegen, sondern sie auch vor modernen Neuerungen (»Erleichterungen«) zu schützen. In den Südstaaten ist Barbecue seit jeher äußerst traditionsverbunden, was mit der Zeit aber auch hier immer schwieriger wird. »Unsere Familie kann dieses Restaurant nie verkaufen«, erklärt Samuel mit leichtem Bedauern in der Stimme. »Wir haben eine Ausnahmegenehmigung vom Gesundheitsamt und müssen uns nicht an Neuregelungen halten. Sollte jemand, der kein Jones ist, dieses Lokal einmal übernehmen, müsste er es den Vorschriften anpassen, und das wäre das Ende.«





























