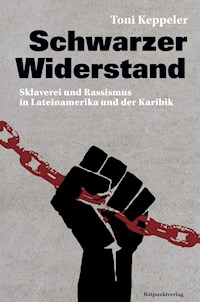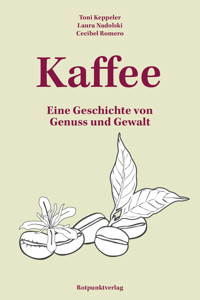
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Durchschnittliche Mitteleuropäer trinken zwei oder drei Tassen Kaffee am Tag, Nordeuropäer noch mehr. Kaum jemand denkt dabei an die Arbeit, die Armut und die Umweltzerstörung, die in dieser Alltagsdroge stecken. Kaffee war in Europa von Anfang an eine Kolonialware und ist es im Grund noch immer. Dieses Buch erklärt die verschiedenen Methoden, Kaffee anzubauen und aufzubereiten mit allen damit verbundenen Gefahren für die Umwelt. Es zeigt, wie die Produktion der Bohnen zum Klimawandel beigetragen hat und warum sie nun von ihm bedroht wird. Es erzählt die Geschichte der Ausbreitung des Kaffees von seinen Anfängen als wilder Waldkaffee in Äthiopien, seinem Weg über die arabische Welt nach Asien und übers Meer nach Lateinamerika, der heute bei weitem wichtigsten Anbauregion. Diese Geschichte war immer auch eine Geschichte des Kahlschlags von Regenwäldern, der Zwangsarbeit und der Sklaverei, des ungezügelten Kapitalismus und der Gewalt bis hin zum Völkermord. Auf vielen Plantagen gilt noch heute, was man in Lateinamerika sagt: Kaffee wird auf Armut angebaut. Das muss nicht so sein. Das Buch zeigt auch, dass es möglich ist, umwelt- und sozialverträglichen Kaffee zu produzieren. Der ist in aller Regel viel besser als die unter menschenverachtenden Bedingungen produzierte Massenware.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Toni KeppelerLaura NadolskiCecibel Romero
Kaffee
Eine Geschichte von Genuss und Gewalt
Farbfotografien von Toni Keppeler
Rotpunktverlag
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einemStrukturbeitrag für die Jahre 2021 bis 2024 unterstützt.
© 2023 Rotpunktverlag, Zürich
www.rotpunktverlag.ch
Grundlage aller Grafiken und Grafiken 2 und 5: Laura Nadolski
Gestaltung der Grafiken, Karten, Umschlag: Trix Krebs
Autorenfoto Toni Keppeler: Yvonne Berardi
Lektorat: Christiane Schmidt
Korrektorat: Jürg Fischer
eISBN 978-3-03973-010-0
1. Auflage 2023
Das gedruckte Buch enthält einen 32-seitigen Bildteil.
Inhalt
Grafik: Kaffeearten Anbaugebiete
Grafik: Die wichtigsten Arabica-Sorten
Einführung
1
Die Bohne und ihre Verarbeitung
Wie der Kaffee von der Plantage bis in die Tasse kommt und wie dabei die Umwelt verschandelt wird
Sorten und Arten – Klassiker, Exoten und Hybride
Von der Baumschule auf die Plantage
Plantagen und was sie der Umwelt antun
Die vielen Plagen des Kaffees
Von der Plantage in die Aufbereitungsanlage
Umweltfrevel bei der Aufbereitung
Geschmacksnoten und Aromen
Die Kunst der Zubereitung
Die Ökobilanz des Kaffees
2
Kolonialismus und Neokolonialismus
Die Geschichte des Kaffees
Der Kaffee verlässt seine afrikanische Heimat
Wie das Getränk vom Jemen aus den Orient eroberte und in dortigen Kaffeehäusern zum ersten Mal von Europäern probiert wurde
Europäer entdecken den Kaffee
Die Ausbreitung des Kaffees nach Osten
Die Unterwerfung Südostasiens durch Portugal, Spanien, Holland und Britannien im Namen des Profits, die Erfindung der monokulturellen Plantage und die Zeit der großen Plagen
Warum die Briten Tee trinken
Der Kaffee und die Sklaverei
Wie die Karibik und besonders Haiti mit Hunderttausenden von verschleppten Schwarzen zum weltweit wichtigsten Anbaugebiet wurde
Die Rache der geschlagenen Kolonialmacht
Kaffeeweltmacht Brasilien
Wie das Land zum mit Abstand größten Produzenten aufstieg, dafür einen riesigen Regenwald abholzte und trotzdem in die Krise kam
Der Atlantische Regenwald verschwindet
Die Folgen des Kahlschlags
Kaffee wird gehortet und vernichtet
Kuba und die Erfindung der Exportquoten
Die gewalttätige Kaffeeoligarchie
Wie in Zentralamerika die indigene Bevölkerung ihres Landes beraubt und massakriert wurde und warum in Guatemala und Nicaragua deutsche Einwanderer davon profitierten
Die Enteignung der Indígenas
Wie James Hill zum Kaffeekönig wurde
Deutsche erobern Guatemala
Eddy Kühl und die deutsche Kolonie in Nicaragua
El Salvadors Oligarchen und der Hunger
Der große Aufstand und sein Scheitern
Ein Völkermord für den Kaffee
Die Oligarchie überlebt, auch ohne Kaffee
Konzentrierter Kaffee
Warum Kriege löslichen Kaffee zum Massenprodukt machten und wenige Konzerne heute den Weltmarkt beherrschen
Wie Robusta den Kaffeemarkt verändert
Die große Krise
Wie Neoliberalismus und Klimawandel den Kaffeebauern zusetzen und wie diese versuchen, trotzdem zu überleben
Steigende Temperaturen bedeuten mehr Armut
Der Sonderweg Kolumbiens
Massenware, Bio, Fair Trade, Qualität – verschiedene Krisenstrategien
El Salvador – keine Strategie, aber viele Wege
SchlussWelchen Kaffee wir trinken sollten
Literatur
Autorinnen und Autor
Ach, wenn es doch Kaffee regnen würde!
Juan Luis Guerra
Einführung
Kaffee ist eine psychoaktive Droge. Das in seinen Bohnen enthaltene Koffein ist ein Alkaloid, so wie das Kokain im Kokablatt oder das Nikotin im Tabak. Es kann genauso süchtig machen. Regelmäßige Kaffeetrinker stehen ständig unter Drogen, denn Koffein wirkt länger, als man gemeinhin denkt. Seine Halbwertszeit liegt bei vier bis fünf, bei manchen Menschen sogar bei acht Stunden. Das bedeutet, dass von der Menge, die wir mit einem Kaffee am Abend zu uns genommen haben, mindestens die Hälfte um Mitternacht noch immer im Körper vorhanden ist und im Gehirn wirkt. Koffein muntert auf, macht wach und agil und verbessert die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit – die ideale Droge für eine moderne Industriegesellschaft. Das unterscheidet Koffein von den meisten anderen Drogen. Opium etwa entspannt und macht schläfrig, Mescalin – auch das ein Alkaloid – ist halluzinogen. Für rational durchorganisierte Leistungsgesellschaften taugen solche Drogen ganz und gar nicht. Kaffee aber hatte von Anfang an ein fast symbiotisches Verhältnis mit dem Kapitalismus.
Kaffee verbreitete sich zu der Zeit in Europa, zu der auch das elektrische Licht und die Fabrik erfunden wurden. Der Aufbau einer Fabrik samt ihren Maschinen war eine große Investition. Sollte sie möglichst schnell rentabel sein, musste möglichst lange darin gearbeitet werden. Künstliches Licht machte die Nachtschichten erst möglich. Kaffee verhinderte, dass die Arbeiter bei den meist monotonen Handgriffen, die sie zu verrichten hatten, einschliefen. Wie wichtig er für die Arbeit an diesen Orten war, zeigt der Vergleich mit der vor seiner Verbreitung üblichen Diät. Mittel- und Nordeuropäer deckten da ihren Flüssigkeitsbedarf am Morgen meist mit einer Biersuppe. Und weil das Wasser verschmutzt war und krank machte, tranken sie, wenn sie Durst hatten, lieber Bier oder je nach Region auch Wein. Nach heutigen Maßstäben waren die Menschen damals den ganzen Tag über angetrunken. Für Fabriken waren sie so nicht sehr funktional. Sie wurden es erst durch den Kaffee. Insofern ist das schwarze Getränk die Droge der Industrialisierung.
Die Mithilfe bei der Zurichtung des Menschen auf monotone Fabrikarbeit ist nur eine der vielen dunklen Seiten des Kaffees. Es gibt auch helle. So war das Getränk für die Aufklärung wichtig. Zuvor gingen die Männer in eher dunkle Spelunken, tranken Bier oder Wein, und wenn sie zu viel davon hatten, schlugen sie sich und schliefen danach ein. In der Zeit der Aufklärung aber verbreiteten sich die Kaffeehäuser als Treffpunkte. Dort war man – eben wegen des neuen Modegetränks – hellwach und konzentriert und diskutierte sich die Köpfe heiß. Man versuchte, alles zu begreifen. Das Obskure, das Mythische, das Vage wurden blass und blässer. Damit verloren die Kirchen an Einfluss und mit ihnen die Feudalherren ihre göttliche Legitimation. Maximilien de Robespierre, Jean-Paul Marat und Georges Danton trafen sich in Kaffeehäusern mit ihren Mitstreitern und debattierten über die Grundlagen der Französischen Revolution.
Kaffee hat also auch eine Rolle bei der Geburt der europäischen liberalen Demokratie gespielt. Aber eben genauso bei der Verbreitung des Wirtschaftsliberalismus, der rationalen Produktion und der Ausbeutung von Menschen, die auch Sklaverei einschließt. Dieselben Franzosen, die Ende des 18. Jahrhunderts für die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf die Straße gingen, hielten gleichzeitig in ihrer Kolonie Saint-Domingue, dem heutigen Haiti, am wahrscheinlich brutalsten Sklavereiregime fest, das es jemals gegeben hat. Saint-Domingue war damals der weltweit größte Kaffeeproduzent.
Kaffee brachte oft den Tod. Schon im US-amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 1865 verabreichten Generäle ihren Soldaten Kaffee, um sie genau dann in entscheidende Schlachten zu führen, wenn die Koffeinkonzentration in ihrem Blut am höchsten war. In Lateinamerika wurden Indígenas gewaltsam vertrieben, damit auf ihren Ländereien Plantagen angelegt werden konnten. In El Salvador kam es wegen des Kaffees 1932 sogar zu einem Völkermord. In Brasilien wurden für Plantagen große Teile eines Regenwaldgebiets abgeholzt, das fast so groß war wie der Amazonasurwald. Das hat Auswirkungen bis heute. Zum einen fehlt der Welt ein riesiger Speicher für Treibhausgase, zum anderen reagiert die aus dem Gleichgewicht gebrachte Natur mit Überschwemmungen und Erdrutschen. Mit dem Klimawandel werden die Naturkatastrophen dramatischer werden. Die Zukunft des Kaffees sieht mit steigenden Temperaturen und unberechenbareren Niederschlägen immer schwärzer aus. Pilze und Insekten, die die Pflanze bedrohen und schon heute nur mit Mühe unter Kontrolle gehalten werden, können in hochgezüchteten monokulturellen Plantagen ungehindert wüten. Kaffee könnte zu einem knappen Gut werden.
Dieses Buch will die Geschichten des Kaffees erzählen. Der erste Teil schafft dabei die Grundlagen: Was ist eigentlich Kaffee, wie kann er angebaut, wie aufbereitet, geröstet und schließlich getrunken werden. Dabei werden nicht nur verschiedene Methoden vorgestellt, sondern auch ihre Auswirkungen auf den Menschen, die Umwelt und das Klima diskutiert. Der zweite Teil erzählt dann die Geschichte des Kaffees. Sie beginnt in den Wäldern im Hochland von Äthiopien und führt von dort zu den Sufis Arabiens, die das schwarze Getränk als wachmachende Droge in ihren nächtlichen Zeremonien verwendeten. Im Jemen nahmen die Europäer zum ersten Mal die Bohnen wahr und machten sie zu einer Kolonialware, zunächst in Asien, dann in Lateinamerika und der Karibik, mit allen grausamen Begleiterscheinungen des Kolonialismus. Kaffee hat ganze Regionen für die Kolonialmächte sehr wertvoll gemacht. Er hat aber auch ganze Regionen wirtschaftlich und ökologisch zugrunde gerichtet und tut es noch heute. Er ist ein globalisiertes Agrarprodukt und für das Oligopol weniger Großhändler und Großröster ein extrem lukratives Geschäft. Die sozialen Bedingungen der rund 250 Millionen Menschen, die weltweit vom Kaffeeanbau leben, haben sich jedoch seit der Kolonialzeit kaum verändert. Und doch ist die Lage nicht nur düster. Es ist durchaus möglich, Kaffee so anzubauen, aufzubereiten und zu handeln, dass Umwelt und Klima geschont werden und die Menschen, die ihn produzieren, ein würdiges Auskommen haben. Solchem Kaffee wünschen wir einen wachsenden Markt.
Wir, das ist Latinomedia, ein kleines dreiköpfiges Journalismusteam, das seit seiner Gründung 2010 hauptsächlich über Lateinamerika berichtet und Büros in Tübingen und San Salvador unterhält. Cecibel Romero ist von uns dreien dem Kaffee am nächsten. Sie ist nicht nur Journalistin, sondern auch ausgebildete Kaffeeverkosterin, und sie hat zwölf Jahre lang in der Nähe von Juayúa in El Salvador auf einer kleinen Plantage umweltschonend und sozialverträglich Kaffee angebaut. Wegen zunehmender Ernteverluste durch den Klimawandel und wegen der hohen Kriminalität in der Gegend hat sie das Stück Land nach der Ernte 2021/2022 verkauft. Laura Nadolski ist Klima- und Umweltwissenschaftlerin. Als solche brachte sie einen Aspekt in dieses Buch, der für ihre beiden Mitautoren neu war und den wir so oder ähnlich in keinem der vielen Kaffeebücher, die in unseren Regalen stehen, gefunden haben. Toni Keppeler arbeitet seit vier Jahrzehnten über die politische und soziale Geschichte Lateinamerikas und der Karibik. Er hat sich schon mit anderen Pflanzen beschäftigt, die die Wirtschaft dieser Weltgegend prägen, mit Bananen etwa oder mit Koka, aber mit keiner so ausführlich wie mit Kaffee.
Wir haben bei den Recherchen unseren Schwerpunkt beispielhaft auf die lateinamerikanischen Anbaugebiete gelegt. Auf den dortigen Plantagen wachsen über sechzig Prozent des weltweit geernteten Kaffees, bei Arabicas sind es sogar über achtzig Prozent. Ökologische und soziale Sünden, die dort begangen wurden und noch immer werden, kamen und kommen so oder ähnlich auch in den Anbauregionen Afrikas und Asiens vor. Wir haben Dutzende Bücher und noch mehr wissenschaftliche Studien durchgearbeitet. Sie können dem Literaturverzeichnis entnommen werden. Wir haben viele Plantagen besucht, haben mit Kaffeebauern, professionellen Verkostern, Verbandsfunktionären und Historikern gesprochen. Und wir haben über hundert verschiedene Kaffees probiert. Wir hatten dabei Raritäten in der Tasse, die so teuer sind, dass man sie sich nur einmal im Leben leisten kann, aber auch lieblos aufbereitete Massenware, die so schlecht war, dass man sie nur einmal im Leben trinken will. Am Ende war unser Lieblingskaffee derjenige, der es schon am Anfang war: Café Cereza, der Kaffee, den Cecibel Romero angebaut, aufbereitet und geröstet hat. Das hat natürlich mit seiner Qualität zu tun – aber auch mit Gefühlen: Die letzte Ernte geht langsam zur Neige.
Beim Verfassen dieses Buchs haben sich Toni Keppeler, Laura Nadolski und Cecibel Romero aus Gründen der besseren Lesbarkeit für das generische Maskulinum entschieden. Wo immer es zur Verwendung kommt, sind damit weibliche, männliche, wie andere Geschlechtsidentitäten gemeint.
1
Die Bohne und ihre Verarbeitung
Wie der Kaffee von der Plantage bis in die Tasse kommt und wie dabei die Umwelt verschandelt wird
Mehr als eine Milliarde Menschen trinkt täglich Kaffee, aber nur eine kleine Minderheit davon hat jemals im Leben die Pflanze gesehen, von der er stammt. Kaum jemand weiß, dass Kaffee im Grund eine Steinfrucht ist wie die Kirsche. Man nennt sie auch so: die Kaffeekirsche. Sie ist, wenn sie reif ist, genauso rot wie eine Sauerkirsche, und es gibt auch wie bei den Kirschen gelbe und eher orange Varianten. Aber sie ist kleiner, der Stiel ist viel kürzer, und sie hat nicht nur einen Stein, sondern zwei. Die nennt man Bohnen, und sie sind der Grund, warum diese Pflanze weltweit von rund fünfzig Millionen Kaffeebauern angebaut wird. Nimmt man ihre Familien dazu, kommt man auf gut 250 Millionen Menschen, die direkt vom Anbau dieser Pflanze leben. Nach einer Schätzung der Weltbank kommen noch einmal 250 Millionen dazu, die indirekt, also in Aufbereitung, Handel und Vermarktung, ihr Geld mit Kaffee verdienen. Insgesamt also rund eine halbe Milliarde Menschen.
Der schwedische Naturforscher Carl von Linné hat diese Pflanze 1753 beschrieben und klassifiziert, aber er kannte nur eine Art, die er Coffea arabica nannte, weil er glaubte, sie stamme aus Arabien; tatsächlich liegt ihr Ursprung im heutigen Südsudan und im Hochland von Äthiopien. Inzwischen sind über fünfhundert Kaffeearten bekannt, die insgesamt in mehr als sechstausend Sorten vorkommen. Angebaut aber werden nur vier dieser Arten: vor allem Coffea arabica oder kurz »Arabica«, von der rund sechzig Prozent der weltweiten Produktion stammen, und Coffea canephora, die man wegen ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Temperaturen und dem Befall mit Insekten oder Pilzen gemeinhin »Robusta« nennt. Diese Art liefert rund vierzig Prozent der weltweiten Produktion. Die anderen beiden, Coffea liberica (kurz »Liberica«) und Coffea dewevrei, die auch »Excelsa« genannt wird, werden kaum angebaut und fast nur lokal vermarktet. Ihr Anteil liegt bei jeweils einem knappen Prozent.
Die Pflanze gehört, wie etwa auch die Gardenie, zur Familie der sogenannten Rötegewächse. Man nennt sie bisweilen Baum oder Bäumchen, meistens aber Strauch. Einzelne Arten können zwar, wenn sie nicht zurückgeschnitten werden, bis zu acht Meter hoch werden. Aber sie haben keinen dicken Stamm, an dem Kinder hinaufklettern könnten. Auch die Zweige sind dünn und flexibel. Der Stamm und auch die Äste bilden alle paar Zentimeter so etwas wie Knoten. Aus den unteren am Stamm sprießen nur Blätter, aus den weiter oben gelegenen dann die Äste, aus deren Knoten wiederum Blätter und Blüten wachsen. Die Blätter sind oval bis länglich, von einem satten glänzenden Grün und je nach Sorte und Art unterschiedlich groß: zwischen acht und fünfzehn Zentimeter lang. Sie bleiben zwischen sieben und zehn Monaten am Baum, werden aber ständig reproduziert. Der Kaffeestrauch ist eine immergrüne Pflanze. Erfahrene Kaffeebauern erkennen die Sorte an den Blättern. Die zentrale Wurzel reicht rund einen Meter in die Tiefe. Die seitlichen Wurzeln mit feinen Wurzelhärchen liegen direkt unter der Oberfläche und nehmen die Nährstoffe aus dem Boden auf. Sie reichen horizontal etwa so weit wie die Äste.
Der Kaffeestrauch ist eine anspruchsvolle Pflanze. Er liebt porösen Boden und braucht viel Wasser. Vulkanische Böden in den Tropen sind deshalb der beste Standort. Arabicas gedeihen am besten in Gegenden, in denen zwischen 1500 und zweitausend Millimeter Regen im Jahr fallen, Robustas brauchen sogar zwischen zwei- und dreitausend Millimeter. Sie haben jeweils einen eigenen Temperaturkorridor, in dem sie sich wohlfühlen. Arabicas wachsen am besten zwischen 18 und 22 Grad Celsius, etliche Sorten halten aber auch 17 oder 26 Grad aus. Außerhalb dieses Temperaturkorridors jedoch nehmen Qualität und Ertrag ab. Sinkt die nächtliche Temperatur unter 17 Grad, verkümmern die Knospen. Bei 27 Grad und mehr kommt die Pflanze in Hitzestress; sie dehydriert, Blätter fallen ab. Die Pflanze produziert weniger Blüten und Früchte. Robustas vertragen mehr Hitze. Die Idealtemperaturen für diese Art liegen zwischen 22 und 28 Grad. Für beide Pflanzenarten, Arabicas und Robustas, sind Fröste absolut tödlich. Robustasträucher können sogar schon bei sechs Grad eingehen und vertragen auch keine längeren Zeiträume mit Temperaturen um die fünfzehn Grad. Bei günstigen Bedingungen aber wird ein Kaffeestrauch rund achtzig Jahre alt; so lange jedoch steht kaum eine Pflanze auf einer Plantage, weil ihre Produktivität nach dreißig Jahren kontinuierlich nachlässt. Die erste richtige Ernte liefert die Pflanze – je nach Art und Sorte – nach drei bis fünf Jahren.
Es sind vor allem klimatische Faktoren, von denen abhängt, wo Kaffee angebaut werden kann und wo nicht. Die Pflanzen brauchen eine lange Trockenperiode, eine relativ hohe mittlere Jahrestemperatur und vertragen keine Kälte. Dazu müssen in der Regenperiode die nötigen Niederschläge kommen. Aus diesen Gründen eignet sich der tropische Gürtel (siehe Grafik in der vorderen Klappe) am besten. Die von den Arten bevorzugten Temperaturen bedingen dann auch die Höhenlagen: Arabicas gedeihen am besten zwischen tausend und zweitausend Metern Höhe. Darunter wird es zu warm, darüber zu kalt. Robustas dagegen sind Tieflandpflanzen. Sie werden meist auf Höhen zwischen dem Meeresspiegel und sechshundert Metern, in manchen Gegenden auch bis tausend Metern angebaut.
Kaffee kommt ursprünglich aus dem Wald. Er wuchs unter dem schützenden Blätterdach höherer Bäume. Er liebt den Schatten und das ausgeglichene Mikroklima im unteren Geschoss eines Urwaldes. Wenig Licht bedeutet aber auch weniger Fotosynthese, und das wirkt sich auf die Zahl der Blüten und Früchte aus. Solcher Kaffee ist zwar der ursprünglichste von allen, aber er hat sehr niedrige Erträge. Die wenigen Waldkaffees, die man bisweilen im Fachhandel findet – meist stammen sie aus Afrika – sind deshalb teurer als andere.
Die Blüten des Kaffeestrauchs sind weiß und klein; ein bis zwei Zentimeter große Kelche mit acht bis sechzehn Blütenblättern, wenn es sich um eine Kulturpflanze handelt. Die Blüten des wilden Kaffees haben nur zwei oder vier Blätter und sind auch viel weniger. Auf Ertrag gezüchtete Sorten sind, wenn sie blühen, von dichten Blütenbüscheln überzogen. Sie öffnen sich nach den ersten Schauern der tropischen Regenzeit, weshalb alle Sträucher gleichzeitig blühen. Eine Plantage duftet dann stark nach Jasmin. Doch der Zauber dauert nicht lange. Manche Blüten welken schon nach wenigen Stunden und spätestens nach drei oder vier Tagen ist auch die letzte abgefallen. Befruchtet wird der Kaffee durch Insekten oder durch den Wind. Nur Arabicasorten brauchen keine Helfer. Die Blüten sind zweigeschlechtlich; herabfallende Pollen können tiefer liegende Blüten befruchten.
Aus den befruchteten Blüten wachsen dann die Kaffeekirschen, kleine ovale Früchte von eineinhalb bis zwei Zentimetern Länge. Sie sind zunächst grün, werden dann gelb und schließlich rot, wobei es einzelne Sorten gibt, deren Früchte gelb oder orange bleiben. Weniger erfahrene Erntearbeiter haben mit solchen Kirschen Probleme. Es ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, welche schon reif sind und also gepflückt werden müssen und welche besser noch für ein paar Tage am Busch bleiben. Bei roten Früchten ist das einfacher. Man kann den Reifegrad auch mit kleinen Geräten bestimmen, die den Zuckergehalt des Fruchtfleisches messen. Arabicakirschen brauchen zwischen sechs und acht Monaten bis zur Reife. In tiefen Lagen mit höheren Temperaturen kann früher geerntet werden als in Hochlagen. Robustas brauchen neun bis elf Monate, Libericakaffee sogar elf bis vierzehn.
Eine Kaffeekirsche besteht aus mehreren Schichten. Sie ist in eine dünne, etwas ledrige Haut eingehüllt, darunter liegt das Fruchtfleisch. Das ist cremefarben und süßsäuerlich und schmeckt ein bisschen nach Honigmelone. Es hat eine Konsistenz wie glibberige Gelatine. Theoretisch könnte man es auspressen und einen Fruchtsaft daraus gewinnen. Aber die Schicht dieses Fruchtfleisches ist so schmal, dass der Ertrag nur gering wäre und sich der Aufwand nicht lohnte. Zwischen dem Fruchtfleisch und dem Samen ist zunächst die bräunliche sogenannte Pergamenthaut, darunter noch eine sehr viel dünnere Schicht, das sogenannte Silberhäutchen. Beide schützen die Samen des Kaffees, die beiden Bohnen ganz im Inneren. Sie liegen mit der flachen Seite, in deren Mitte eine kleine Furche ist, aneinander. Die gerundete Seite liegt nach außen. Frische Bohnen sind etwa einen Zentimeter lang und sechs Millimeter breit und wiegen, wenn sie getrocknet sind, ein halbes Gramm oder ein bisschen weniger. Bisweilen haben Kaffeekirschen auch nur einen Samen, der dann ganz rund ist. Solche sogenannten Perlbohnen – oft auch englisch peaberry oder spanisch caracol genannt – können bis zu fünf Prozent einer Ernte ausmachen. Sie werden später aussortiert. Sie können ein Zeichen für die mangelhafte Versorgung der Pflanze mit Nährstoffen sein, weshalb man sie früher für einen Defekt hielt. Heute gibt es Sorten, die auf die massenhafte Produktion solcher Perlbohnen gezüchtet sind. Sie ergeben, wenn sie hell geröstet werden, einen besonders milden Kaffee. Perlbohnen sind meist etwas teurer als ihre als Zwillinge herangereiften Geschwister.
Frische Kaffeebohnen sind fad und weitgehend geschmacklos. Aber sie enthalten einen Stoff, der süchtig machen kann: Koffein, ein Alkaloid ähnlich wie Kokain oder Nikotin, zusammengesetzt aus Kohlestoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff mit der chemischen Formel C8H10N4O2. Es kommt nicht nur in Kaffee vor, sondern auch in Tee, Mate, dem berauschenden afrikanisch-arabischen Kraut Khat und in winzigen Mengen auch in Kakao. Isoliert ist Koffein ein weißes flockenartiges Pulver, aber man sollte es nicht isoliert zu sich nehmen. Es ist sehr stark. Eine Arabicabohne enthält zwischen 0,8 und 1,2 Prozent Koffein, Robusta in etwa das Doppelte. Die Pflanzen produzieren diesen Stoff zum Selbstschutz. Er kann Bakterien und Pilze abtöten und Insekten unschädlich machen, indem er ihr Nervensystem durcheinanderbringt. Beim Menschen führt Koffein zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und des Konzentrationsvermögens. Es hebt die Stimmung, kann asthmatische Beschwerden lindern und hilft bei niedrigem Blutdruck. Es ist fettlöslich und in der Lage, Zellmembrane mir nichts dir nichts zu passieren. Es gelangt deshalb schnell vom Magen und Darm in die Blutgefäße und darüber ins zentrale Nervensystem. Seine maximale Wirkung im menschlichen Körper entfaltet der Stoff in der Regel eine Stunde nach der Einnahme. Danach wird er langsam abgebaut. Er wird in der Leber chemisch umgewandelt und dann mit dem Urin ausgeschieden. Nach neueren Forschungen beträgt die Halbwertszeit vier bis fünf, bei manchen sogar bis zu acht Stunden. Das bedeutet, ein Mensch hat dann noch immer die Hälfte des zu sich genommenen Koffeins im Körper. Eine Tasse Kaffee enthält, je nach Bohnensorte und Stärke, zwischen zwanzig und fast 150 Milligramm des Stoffs.
Sorten und Arten – Klassiker, Exoten und Hybride
Die wahrscheinlich ältesten noch angebauten Arabicasorten sind Typica und Bourbon. Beide stammen ursprünglich aus dem Jemen. Die Vorfahren von Typica wurden gegen Ende des 17. Jahrhunderts von dort auf die heute zu Indonesien gehörende Insel Java gebracht. Von dieser damaligen holländischen Kolonie kam eine Pflanze Anfang des 18. Jahrhunderts in den Botanischen Garten von Amsterdam. Setzlinge, die aus Kaffeebohnen dieses Strauchs gezogen wurden, nahm ein Kapitän wahrscheinlich kurz nach 1710 – die Quellenlage ist nicht ganz eindeutig – auf die von Frankreich kolonisierte Karibikinsel Martinique mit. Von dort wurde sie über die Anbaugebiete Lateinamerikas verbreitet. Bourbon gelangte Anfang des 18. Jahrhunderts auf eine kleine Insel im Indischen Ozean, ebenfalls eine französische Kolonie, die man damals nach dem französischen Adels- und Königsgeschlecht Bourbon nannte; sie heißt heute La Réunion und ist, wie Martinique, noch immer französische Kolonie, ein sogenanntes Überseedepartement. Von dort kamen die Bourbonbohnen schon nach wenigen Jahren zunächst in die Karibik und dann nach Lateinamerika. Typica ist eine hohe Pflanze mit relativ großen Bohnen, die bei guter Pflege und Aufbereitung einen sehr guten Kaffee ergeben. Allerdings ist ihr Ertrag eher gering. Bourbon ergibt einen Kaffee mit viel Süße und liefert deutlich höhere Erträge als Typica. Fast neunzig Prozent der weltweiten Arabicaproduktion kommen heute aus Lateinamerika und der Karibik.
Weil Arabicas als zwittrige Pflanzen sich selbst befruchten, hat jede Bohne, aus der neue Setzlinge gezogen werden können, den exakt selben Gensatz. Genau das ist die Schwäche aller Arabicas: Wenn eine Krankheit eine Pflanze befällt, kann sie alle befallen und schnell eine ganze Plantage dahinraffen.
Die verschiedenen Arabicasorten sind untereinander sehr eng verwandt und haben ein nahezu identisches Erbgut. Etliche der verschiedenen Varianten, die es heute gibt, sind natürlich entstanden, gewissermaßen bei Unfällen in der Vererbungskette. Schon Bourbon gilt als eine natürliche Mutation von Typica. Auch Maragogype, eine in Brasilien entdeckte Sorte, ist eine Typicamutation, die sehr große Bohnen mit relativ niedrigem Koffeingehalt hat und einen milden Kaffee ergibt. Von Bourbon wiederum stammt eine ganze Reihe natürlicher Mutationen ab. So wurde 1937 in Brasilien die Sorte Caturra entdeckt, eine eher niedrige Pflanze, die kaum mehr als 1,8 Meter Höhe erreicht und deren Kirschen deshalb leicht geerntet werden können. Caturra ist heute vor allem in Kolumbien und Mittelamerika verbreitet und wird wegen des sehr hohen Ertrags geschätzt. Allerdings neigt dieser Strauch dazu, zu viele Früchte zu produzieren und sich deshalb schnell zu erschöpfen. Bourbonmutationen mit ähnlichen Charakteristiken sind Villa Sarchi aus dem gleichnamigen Städtchen in Costa Rica und Pacas, eine Sorte, die 1949 in El Salvador entdeckt wurde.
Mondo Nuevo, eine Sorte, die seit den vierziger Jahren in Brasilien angebaut wird, ist dagegen eine natürliche Kreuzung aus Typica und Bourbon. Sie wird wegen ihrer hohen Erträge und ihrer relativ hohen Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten kultiviert. Allerdings ist sie wegen ihres hohen Wuchses sehr windanfällig. Andere Sorten wurden gezielt gekreuzt. So wurde 1958 in El Salvador Pacamara geschaffen, eine Kreuzung aus Pacas und Maragogype. Die Pflanze hat, wie ihr Elternteil Maragogype, große Blätter, Früchte und Bohnen. Ihr Kaffee wird wegen des Geschmacks mit Schokoladen- und Fruchtnuancen geschätzt, er kann bei schlechter Pflege der Plantage aber auch eher krautartige Noten entwickeln. Weitere Sorten wurden nicht auf dem Feld, sondern ganz gezielt im Labor geschaffen und tragen nur Buchstabenkombinationen und Zahlen als Namen. Der vor allem in Kenia und Tansania angebaute SL-28 etwa wurde für eher trockene Anbaugebiete entwickelt. Die überdurchschnittlich großen Bohnen ergeben einen Kaffee mit deutlich fruchtigen Noten. Es gibt Kaffeeliebhaber, die schwören auf eine oder zwei bestimmte Sorten. Aber wie es beim Wein nicht nur auf die Traube ankommt, sondern auch auf Anbau und die Arbeit im Keller, ist auch beim Kaffee viel mehr als nur die Sorte entscheidend: der Boden, die Höhenlage, die Pflege der Plantage, die Aufbereitung und die Röstung.
Drei Sorten werden zu besonders hohen Preisen gehandelt. Geisha, Jamaica Blue Mountain und Kopi Luwak. Der Name Geisha hat nichts mit den traditionellen japanischen Unterhaltungskünstlerinnen zu tun. Er wird bisweilen auch Gesha geschrieben, weil der Ursprung dieser Sorte in einem äthiopischen Städtchen dieses Namens vermutet wird. Das costaricanische Forschungs- und Ausbildungszentrum Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) hat die Bohnen in den frühen fünfziger Jahren nach Zentralamerika gebracht. Von Costa Rica gelangte die Edelsorte Anfang der sechziger Jahre nach Panamá, heute wird sie auch in Kolumbien und neuerdings fast überall in Zentralamerika angebaut. Sie hat nur geringe Erträge – was die Bohnen zusätzlich verteuert – und ergibt einen besonders weichen Kaffee, der fast ein bisschen an Tee erinnert. Jamaica Blue Mountain kommt, wie der Name sagt, aus den Blue Mountains im Osten der Karibikinsel Jamaika. Er ist eine natürliche Mutation von Typica und wird seit Mitte des 18. Jahrhunderts dort in großer Höhe angebaut. Die Berge sind meistens wolkenverhangen, und so reifen die Bohnen sehr langsam heran und entwickeln dabei besonders ausgeprägte Geschmacksnoten und Aromen. Jamaica Blue Mountain fehlt jegliche bittere Note. Das Anbaugebiet dieses speziellen Kaffees ist klein und das Angebot deshalb begrenzt. Das treibt den Preis in die Höhe. Wer ein Kilogramm gerösteter Bohnen für hundert Euro erhascht, hat ein Schnäppchen gemacht. Das ist fast noch günstig im Vergleich zu Kopi Luwak. Für diesen Kaffee werden bis zu vierhundert Euro pro Kilogramm verlangt. Es handelt sich dabei um halbverdaute Bohnen von wildem Waldkaffee, die von der freilebenden Schleichkatze Fleckenmusang gefressen und mit dem Kot wieder ausgeschieden wurden. Dieser Kaffee soll ganz besonders mild sein. Ursprünglich stammt er aus Indonesien, wo dieser Exkrementekaffee von Einheimischen gesammelt wurde, weil aller Plantagenkaffee für den Export bestimmt war. Zum ersten Mal wurde er 1883 von Alfred Brehm beschrieben. Kopi Luwak wird heute auch auf den Philippinen hergestellt. Nachdem diese Bohnen vor ein paar Jahren als exotisches Luxusprodukt durch die Medien gegeistert sind und in der Folge die Nachfrage stieg, wurden sie gezielt produziert. In Käfige gesperrte Fleckenmusangs werden nun mit einer Mischung aus Arabica-, Liberica- und Excelso-Bohnen gefüttert, um größere Mengen der teuren Ware zu erhalten. Die Bedingungen, unter denen die Tiere gefangen gehalten werden, und die Mengen an Bohnen, die sie fressen müssen, entsprechen ganz und gar nicht ihrem natürlichen Umfeld und Verhalten. Echter Kopi Luwak ist kein Kaffeegenuss, sondern Tierquälerei. Wer ihn unbedingt probieren will, greift besser zu einer deutlich billigeren Variante: Ein vietnamesisches Unternehmen hat die Darmenzyme der Schleichkatze isoliert und synthetisch nachgebaut und stellt damit einen gewissermaßen synthetischen Kopi Luwak her.
Robusta gehört da in eine ganz andere Kategorie. Er ist zweigeschlechtlich, weshalb seine Gensätze vielfältiger sind als die der Arabicas; es gibt eine Vielzahl von Varianten. Die Bohnen sind kleiner und runder als die von Arabicasorten. Aber die Erträge sind hoch und die Pflanze ist anspruchslos, sodass er sehr viel billiger produziert werden kann. Robusta wurde lange an der New Yorker Kaffeebörse nicht zum Handel zugelassen, weil man ihn für völlig wertlos hielt. Das daraus zubereitete Getränk hat zwar einen vollen Körper, aber nur wenig Säure. Robustakaffee schmeckt bitter und bisweilen auch nach verbranntem Gummi. Seine Stärke ist das viele Koffein, das er enthält. Robusta kann damit Insekten abwehren und ist resistent gegen Pilzbefall. In großen Mengen wird er erst angebaut, seit es löslichen Kaffee gibt. Bei diesem Produkt spielt der Preis eine viel größere Rolle als die Qualität. Auch Espressokaffee wird überwiegend aus Robustabohnen geröstet. Espressotrinker schätzen entweder seine Bitterkeit – oder sie überdecken sie mit viel Zucker. Seit man den Bohnen mit einem Dampfdruckverfahren etwas von ihrer Bitterkeit nehmen kann, wird Robusta auch mehr und mehr als billiges Auffüllmaterial in den Mischungen der Großröster verwendet. Üblicher Supermarktkaffee besteht heute zu etwa der Hälfte aus Robustabohnen. Der Geschmack und das Aroma dieser Mischungen jedoch kommt weiterhin von den Arabicas.
Auch Liberica hat sehr viel Koffein und kann deshalb Plagen viel besser abwehren als Arabicas. Seine Bohnen ähneln denen von Robusta, sind aber sehr viel härter und enthalten nur wenig Zucker, was wiederum einen bitteren Geschmack zur Folge hat. Dass er sich gegen Robusta nie durchsetzen konnte, liegt an der langen Zeit, die die Kirschen zur Reife brauchen. Von der Befruchtung bis zur Ernte vergehen bis zu vierzehn Monate. Liberica wird hauptsächlich in Westafrika, in kleinen Mengen auch in Indonesien, auf den Philippinen und in Vietnam angebaut. Excelsa ist wie Liberica eine afrikanische Pflanze und eher eine Rarität. Sie wurde 1904 am Tschadsee entdeckt. Die Bohnen gleichen in Aussehen und Geschmack dem Robusta, die Pflanze jedoch ist sehr viel kräftiger. Sie gedeiht selbst auf trockenen Böden und kann auch in regenarmen Jahren befriedigende Erträge liefern. Excelsa wird noch immer vor allem im Tschad angebaut.
Auf der Suche nach Sorten, die vom Geschmack her Arabicas entsprechen und gleichzeitig die Krankheitsresistenz von Robusta aufweisen, wurde 1917 auf der zu Indonesien gehörenden Insel Timor eine natürlich entstandene Kreuzung aus Arabica und Robusta entdeckt. Dieser sogenannte Timor Hybrid hat Eigenschaften von beiden Eltern. Aromen und Geschmacksnoten der Arabicas sind bei ihm genauso vorhanden wie die Bitterkeit des Robusta. Und vor allem: Er ist, wie Robusta, gegen die meisten Varianten des Pilzes Hemileia vastatrix resistent, der als sogenannter Kaffeerost für Arabicaplantagen verheerend sein kann. Seither versuchen sich Agronomen an immer neuen Kreuzungen zwischen dem Timor Hybrid und Arabicasorten. Das Ziel ist, einen Kaffee zu bekommen, der schmeckt wie die Arabicasorte; sein Erbgut soll aber auch die Gene von Robusta enthalten, die die Pflanze widerstandsfähig gegen Pilzbefall machen. Bei diesen Kreuzungen sind in den siebziger Jahren neue Sorten entstanden wie Catimor und Sarchimor, die es inzwischen in vielen Varianten gibt. Catimor ist eine Kreuzung aus Caturra und dem Timor Hybrid; bei Sarchimor ist die costaricanische Arabicasorte Villa Sarchi ein Elternteil. In Kolumbien sind die Plantagen heute mehrheitlich mit solchen neuen hybriden Sorten bestockt. Anderswo setzen sie sich nur langsam durch. Puristen schwören weiterhin auf reine Arabicas, trotz ihrer Anfälligkeit für Plagen. Sie sagen, man schmecke beim Kaffee aus den neuen Sorten eben doch noch die Bitterkeit von Robusta heraus.
Von der Baumschule auf die Plantage
Die meisten Kaffeebauern sorgen selbst für den Nachwuchs auf ihren Plantagen. Sie sortieren die besten Bohnen aus, um daraus neue Pflanzen heranzuziehen. Theoretisch könnte man sie direkt in die Erde stecken und sie würden bei der nötigen Bewässerung keimen und sprießen. Allerdings könnten Steinchen oder sonst ein Widerstand im Boden dazu führen, dass die Hauptwurzel nicht senkrecht nach unten wächst oder sich gar teilt, was dann Auswirkungen auf die Nährstoffversorgung der Pflanze und ihre Stabilität hätte. Man drückt die Bohnen deshalb vorsichtig in eine auf der Erde ausgebrachte Schicht aus Sand. Der wird zuvor mit heißem Wasser desinfiziert, um einem Befall mit Pilzen vorzubeugen. Die Bohnen müssen ganz mit Sand bedeckt sein, um sie vor der Sonne zu schützen, und regelmäßig bewässert werden. Nach drei Wochen sprießen dann die Keimlinge: ein dünner grüner Spross, der fünf bis sechs Zentimeter lang wird und oben die bräunliche Bohne trägt. Weil diese Jungpflanzen ein bisschen an Streichhölzer erinnern, nennt man sie in Lateinamerika oft auch so: fosforitos.
Wenn die Sprosse die ersten beiden Keimblätter entwickelt haben, werden sie mitsamt ihrer Wurzel vorsichtig aus dem Sand gehoben. Entspricht das Wachstum der Wurzel den Vorstellungen des Bauern, werden sie in einen kleinen schwarzen Plastiksack oder einen anderen Behälter mit gedüngter Erde umgesetzt. Diese Jungpflanzen brauchen viel Schatten und regelmäßig Wasser, weshalb größere Plantagen für ihre Baumschulen eine an Flugzeughangars erinnernde Halle aus Zweigen und Blätterwerk errichten und die Sprösslinge dort künstlich bewässern. Das ist sicherer als die Aufzucht im Freien, wo direkte Sonne und starke Regenschauer den zarten Pflänzchen schaden könnten. In dieser Halle bleiben sie bis zu vier Monate lang und werden mit Stickstoff, Phosphor, Kalium, Kalk, Magnesium und Schwefel gedüngt und regelmäßig auf einen möglichen Befall mit Krankheiten untersucht. Dann sind sie stark genug.
Bevor ein neues Feld mit Jungpflanzen bestockt wird, empfiehlt sich eine Untersuchung des Bodens. Kaffee mag einen neutralen Untergrund mit einem pH-Wert von um die sieben; ist die Erde zu sauer, führt das zu einem niedrigeren Ertrag. Man kann den pH-Wert mit Kunstdüngern, aber auch mit organischem Kompost korrigieren. In den ersten Wochen auf freiem Feld brauchen die Pflanzen sehr viel Wasser, weshalb sie in der Regel mitten in der tropischen Regenzeit aus der Baumschule in die Plantage umgesetzt werden. Früher war es üblich, auf einer Fläche von eineinhalb auf zwei Meter eine Jungpflanze zu setzen. Heute wird meist sehr viel enger bestockt. Auf dem Platz, auf dem früher ein Kaffeestrauch stand, stehen heute oft drei oder gar vier. Zum einen gibt es Sorten, die auch eng aufeinander gepflanzt gut gedeihen und hohe Erträge bringen. Zum anderen reißen viele Kaffeebauern nach ein paar Monaten die schwächeren Pflanzen aus, um den stärkeren mehr Luft und Licht zu geben.
Es gibt fünf Arten, eine Kaffeeplantage anzulegen. Im kommerziellen Anbau sind nur drei davon gängig; die beiden anderen liefern so geringe Erträge, dass sie fast nur für den eigenen Konsum genutzt werden. Die natürlichste Pflanzung von allen ist die als Waldkaffee. Man pflanzt die Sträucher in großen Abständen in einem natürlichen Wald. Sie werden, wenn sie größer sind, zu einem Teil des Unterholzes. So wuchs Arabicakaffee in den Wäldern im Hochland von Äthiopien. Die Ernte ist zeitaufwendig, der Ertrag pro Hektar verschwindend gering. Aber es ist mit Sicherheit der umweltfreundlichste Kaffee, den es gibt. Der sogenannte Gartenkaffee ist dann, historisch gesehen, der Übergang von der Wild- zur Nutzpflanze. Die Sträucher werden in einem Garten angebaut, zusammen mit Gemüse und Obst. Solche Gärten gibt es in ländlichen Gegenden in Ostafrika oder im Hochland von Guatemala und im Süden von Mexiko noch immer. Ihre Ernte ist für den Hausgebrauch und wird allenfalls auf lokalen Märkten angeboten; für den kommerziellen Export sind die Mengen zu gering.
Zwei weitere Anlagearten sind dem ursprünglichen Waldkaffee nachempfunden, aber deutlich intensiver. Die Kaffeesträucher stehen unter Bäumen, die als Schattenspender gepflanzt wurden. Man unterscheidet dabei in diversifizierte Schattenproduktion und Monokulturen mit Schatten. In beiden sind heute vierzig bis fünfzig Prozent Schatten üblich. Die Kaffeesträucher haben so genügend Licht für kräftiges Wachstum und die Fotosynthese, von der die Erträge abhängen – je mehr Fotosynthese, desto mehr Blüten und Früchte kann eine Pflanze bilden. Gleichzeitig bieten die Schattenbäume Schutz vor Hitzestress und vor der Gewalt tropischer Wolkenbrüche. Bei diversifizierter Schattenproduktion stehen unterschiedliche Schattenbäume auf einer Plantage. Beliebt sind verschiedene Arten des Inga, eines Baums aus der Familie der Mimosengewächse, dessen Hülsenfrüchte gleichzeitig als organischer Dünger verwendet werden können. Ingas wachsen sehr schnell und werden nicht mehr als zehn bis fünfzehn Meter hoch – ideal, um darunter Kaffeesträucher anzubauen. Auf diversifizierten Plantagen stehen daneben oft Zitrusfrüchte als Schattenbäume. Auch Bananenstauden sind beliebt. Solche Plantagen schaffen ihren Besitzern ein zusätzliches Einkommen zum Kaffee. Neben den Zitrusfrüchten und Bananen kann auch das Holz der Ingabäume, das zum Feuern und in der Bauwirtschaft verwendet wird, verkauft werden. Auf Monokulturen mit Schatten stehen meist ausschließlich Ingabäume. Im Vergleich zu diversifizierten Plantagen machen sie weniger Arbeit, liefern aber kaum zusätzliches Einkommen.
Die ertragreichsten Plantagen sind Monokulturen in der prallen Sonne ohne jeglichen Schattenbaum. Es gibt sie vor allem in Brasilien und Vietnam, zum Teil aber auch in anderen Anbauregionen. Da den Böden solcher Plantagen die natürliche Nährstoffzufuhr durch die herabfallenden Blätter und Früchte der Schattenbäume fehlt, brauchen sie viel mehr chemische Düngemittel und erschöpfen sich doch schneller. Solche Monokulturen ohne Schatten werden für die Massenproduktion angelegt und zielen auf schnelle Profite. Sie sind, was die Biodiversität angeht, nicht nur pflanzlich verarmt. Auch Tiere, größere wie kleine, finden dort keinen Lebensraum mehr. Nicht einmal Zugvögel machen in solchen Pflanzungen Rast; es fehlt ihnen dort an Schutz und Nahrung. Kaffeeplantagen ohne Schattenbäume sind Plantagen ohne Vögel. Dass dort trotzdem bisweilen Bäume stehen, hat nichts mit dem Schutz der Sträucher vor der Sonne zu tun und schon gar nichts mit einem möglichen Lebensraum für Tiere. In Gegenden, in denen starke Winde wehen, werden oft schnell wachsende schlanke zypressenartige Bäume in Reihen gepflanzt, die rechtwinklig zur Windrichtung stehen. Sie sollen den Kaffee vor starken Böen schützen.
Beim Anlegen einer Plantage werden zunächst die Löcher für die Jungpflanzen gegraben. Die werden mit Düngern gefüllt, beim organischen Anbau mit Kompost. Ein Plantagenarbeiter mit Erfahrung kann bis zu zweihundert neue Kaffeesträucher an einem Tag in die Löcher setzen und diese dann mit Erde auffüllen. Danach wird, je nach Regen und Bodenbeschaffenheit, dreimal im Jahr oder auch öfter das Kraut entfernt, das zwischen den jungen Sträuchern wächst. Es sollen ihnen weder Licht noch Nährstoffe weggenommen werden. In der Regel bringt man dreimal im Jahr Düngemittel aus. Einmal im Jahr werden die Pflanzen zurückgeschnitten, damit sie die gewünschte dichte Form annehmen. Auch sollen sie nicht zu hoch wachsen, weil das die Ernte erschweren würde. Beim Zurückschneiden schaffen gute Arbeiter zweihundert Pflanzen am Tag. Genauso werden Schattenbäume, so es sie gibt, regelmäßig beschnitten. Haben sie Ableger, werden die herausgerissen und eventuell an anderen Stellen eingepflanzt. All dies bedeutet, dass ein Kaffeebauer allein nicht mehr als zwei bis drei Hektar bewirtschaften kann. Für die Ernte brauchen kleine wie große Betriebe zusätzliche Arbeitskräfte.
Plantagen und was sie der Umwelt antun
Eines der größten Umweltprobleme, das Kaffeeplantagen verursachen, ist die Erosion. Sie ist im Grund ein natürlicher Prozess, der immer dann vorkommt, wenn Regen oder Wind auf Erde treffen. Lockere Krume wird weggeschwemmt oder weggeweht, und mit ihr verschwinden Nährstoffe. Solange Blätter und Zweige auf den Boden fallen und sich bei deren Zersetzung neuer Humus bildet, ist dieser Prozess nicht weiter tragisch. In natürlichen Wäldern werden wegen des schützenden Blätterdachs und der Bodenbewachsung kaum Sedimente abgetragen. Das gilt auch für den Anbau von Kaffee in Wäldern. Erosion ist bei dieser Produktionsmethode kein Problem. Sie nimmt aber zu, je mehr der Mensch in den natürlichen Pflanzenbestand eingreift und eine Plantage mehr und mehr auf hohe Erträge trimmt.
Schon allein die Bodenbedeckung spielt eine große Rolle. Kräuter, die auf Plantagen wachsen, werden oft entfernt, weil ihre Wurzeln den nur knapp unter der Oberfläche liegenden seitlichen Haarwurzeln der Kaffeesträucher Konkurrenz um die Nährstoffe machen können, was wiederum deren Wachstum beeinträchtigen kann. Ist der Boden aber nackt, kommt es zur sogenannten Spritzerosion. Man kennt das von Sommergewittern: Jeder schwere Regentropfen, der auf nackte trockene Krume fällt, schlägt eine Miniaturmulde in den Boden und lässt dabei ein paar Staubkörner aufspringen. Die werden umso schneller weggeschwemmt, je weniger Widerstand das abfließende Wasser antrifft. Weggeschwemmte Erde färbt in Kaffeeregionen die Flüsse in der Regenzeit schokoladenbraun. Schattenbäume bieten einen gewissen Schutz vor dieser Erosion. Zum einen fallen die Tropfen von ihren Blättern aus geringerer Höhe auf den Boden. Sie treffen also mit weniger Wucht auf die Krume und verursachen weniger Spritzerosion. Zum andern verlangsamen die von den Bäumen gefallenen Blätter den Abfluss des Regenwassers und schützen die Erde. So wurde in einer Anbauregion im Süden der indonesischen Insel Sumatra lange die gesamte Bodenbedeckung unter Kaffeesträuchern entfernt, was in der tropischen Regenzeit mit ihren heftigen Niederschlägen zu einer beschleunigten Erosion führte. Ein Forschungsteam um die Landwirtschaftsklimatologin Tumiar Afandi von der indonesischen Universität Lampung hat herausgefunden, dass zum Beispiel die Verwendung von Carabaogras und anderen in der Region natürlich vorkommenden Kräutern die Erosion erheblich vermindert, ohne das Wachstum der Sträucher und ihren Ertrag wesentlich zu beeinflussen.
Es ist schwierig, Durchschnittswerte für die Bodenerosion von verschiedenen Anbaumethoden zu bestimmen. In Zentralamerika nehmen Wissenschaftler für den dort traditionellen Anbau in biodiversen Schattenplantagen einen Verlust von 240 Kilogramm Erde pro Hektar im Jahr als Richtwert an. Er kann nicht einfach auf andere Anbauregionen übertragen werden. In Zentralamerika ist Bodenerosion unter anderem deshalb eines der größten Umweltprobleme, weil die Kaffeeplantagen, ähnlich wie die Mais- und Bohnenfelder, oft an steilen Hängen angelegt wurden. Vor allem nach Perioden der Dürre mit ausgetrockneten Böden fließen dann die Wassermassen von tropischen Sturzregen mit rasender Geschwindigkeit ins Tal und schwemmen dabei die nährstoffreiche Krume aus. Die Fruchtbarkeit solcherart erodierter Böden nimmt schnell ab. Zudem verringert sich ihre Fähigkeit, Wasser zu speichern. Bodenverlust bedeutet so gleichzeitig Wasserverlust. Die Pflanzen bekommen weniger Flüssigkeit und weniger Nährstoffe. Eine Zeitlang lassen sich die dadurch verringerten Erträge mit dem Einsatz großer Mengen von Düngemitteln verhindern. Das aber erhöht nicht nur die Produktionskosten, sondern schafft zusätzlich neue Belastungen für die Natur.
Auch wenn sich nur schwer Vergleiche anstellen lassen, so ist doch sicher, dass die Erosion umso mehr zunimmt, je weniger Schattenbäume vorhanden sind und je weniger der Boden mit Blattwerk und niedrigen Pflanzen bedeckt ist. Auf nackter Erde angebaute Plantagen in der prallen Sonne mögen zunächst die produktivsten sein, sie leiden aber auch am meisten unter dem Verlust der nährstoffhaltigen Krume; ihre Böden verlieren die Fruchtbarkeit am schnellsten. Und der Bodenverlust wird mit dem Klimawandel zunehmen. Wissenschaftler sind sich schon lange darüber einig, dass in vielen Kaffeeregionen mit steigenden Temperaturen die Zahl der extremen Regenfälle und von Dürreperioden zunehmen wird. Nichts schwemmt mehr fruchtbare Erde weg als ein Wolkenbruch nach einer Trockenperiode.
Plantagen mit Kaffeesträuchern in praller Sonne sind das Produktionssystem, das die wenigsten Treibhausgase zu binden vermag. Nach einer Studie der Salvadorianischen Stiftung für die Erforschung des Kaffees kann ein Hektar einer solchen Plantage gerade einmal 76 Tonnen CO2 speichern. Eine Plantage, die ausschließlich Ingaarten als Schattenbäume verwendet, speichert immerhin 176 Tonnen pro Hektar, eine mit unterschiedlichen Schattenbäumen sogar 196 Tonnen, fast so viel wie ein Hektar Regenwald. Dies ist zumindest ein kleiner Ausgleich für den CO2-Fußabdruck, den Kaffee bei seiner Produktion und Vermarktung ansonsten hinterlässt. Dazu später.
Diese Zahlen zeigen, dass monokulturelle Kaffeeplantagen in praller Sonne ein Umweltfrevel sind. Dort, wo sie heute stehen, stand früher in aller Regel natürlicher Wald. Der wurde gerodet, um das Gelände für Kaffee vorzubereiten, zum größten Teil mit Feuer. Das im Wald gespeicherte Kohlendioxid wurde dabei freigesetzt. Die folgende industrialisierte Plantage kann nur noch ein rundes Drittel davon wieder speichern. Die Umwandlung von Wald in landwirtschaftliche Fläche ist in den feuchten Tropen eine der Hauptquellen von Treibhausgasemissionen. Dort stehen über die Hälfte der weltweiten Biomasse. In Brasilien etwa wurde hauptsächlich für Kaffee, aber auch für andere landwirtschaftliche Produkte, für Minen und für die Besiedlung der Atlantische Regenwald so gut wie vernichtet. Er war ursprünglich gut viermal so groß wie Deutschland. Heute sind nur noch rund zwölf Prozent dieser Fläche im natürlichen Zustand. Auch in Kolumbien und Zentralamerika fielen große ursprüngliche Wälder dem Kaffeeanbau zum Opfer. Und egal, welche Art der Plantage danach dort angelegt wurde und wird, sie nimmt immer weniger CO2 auf, als es der Wald zuvor vermochte.
Kohlendioxid ist nur ein Treibhausgas, das bei der Produktion von Kaffee freigesetzt wird. Darüber hinaus produziert die Plantagenwirtschaft auch Methan (CH4) und Lachgas (N2O). Sie alle haben die Eigenschaft, Wärme auf der Erde zu halten. Die Strahlung der Sonne nämlich ist kurzwellig, die genannten Gase lassen sie passieren, sodass ihre Energie die Erde erwärmt. Die von der Erde zurückgestrahlte langwellige Wärmestrahlung lassen sie aber nicht vollständig zurück ins Weltall. Sie wird von den Molekülen der Treibhausgase absorbiert, die dadurch ihre Umgebung erwärmen. Es kommt also zu einem doppelten Erwärmungseffekt, dem durch die Sonnenstrahlung und dem durch die von den genannten Gasen festgehaltene Rückstrahlung der Erde. Dieser Treibhauseffekt ist lebensnotwendig. Ohne ihn wäre die Erde für Menschen nicht bewohnbar, sondern durchschnittlich minus achtzehn Grad Celsius kalt. Aufgrund dieses natürlichen Treibhauseffektes herrschte in vorindustriellen Zeiten eine angenehme weltweite Durchschnittstemperatur von rund vierzehn Grad. Seit immer mehr Treibhausgase in die Luft entlassen werden, wird immer mehr Strahlungsenergie auf der Erde festgehalten, und entsprechend steigen die durchschnittlichen Temperaturen.
Kohlendioxid, das nicht nur beim Verbrennen fossiler Energieträger entsteht, sondern auch bei der Brandrodung von Wäldern, ist das wichtigste dieser Gase. Dahinter kommt gleich Methan, das rund vierzehn Prozent der Treibhausgasemissionen ausmacht. Methan gilt dabei als sogenannter kurzzeitiger Klimatreiber, weil es mit etwa zwölf Jahren eine relativ kurze Lebensdauer in der Atmosphäre hat. Von Kohlendioxid dagegen sind nach tausend Jahren noch immer zwischen fünfzehn und vierzig Prozent vorhanden. Dafür ist die Fähigkeit von Methan, Wärme in der Atmosphäre einzufangen und teilweise zurückzustrahlen (das sogenannte Erderwärmungspotenzial) etwa zwanzigmal höher als das von Kohlenmonoxid. Lachgas bleibt für über hundert Jahre in der Atmosphäre; sein Erderwärmungspotenzial ist sogar dreihundertmal so groß wie das von Kohlendioxid. Zudem zerstört dieses Gas die Ozonschicht. Sein Anteil in der Atmosphäre hat sich von 1750 bis 2018 um 22,5 Prozent erhöht, vor allem in den vergangenen fünfzig Jahren. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf die in der Landwirtschaft benutzten chemischen Düngemittel zurückzuführen, wobei Kaffeemonokulturen einen beträchtlichen Teil zu dieser Emission beitragen.
Düngemittel tragen nicht nur mit den von ihnen freigesetzten