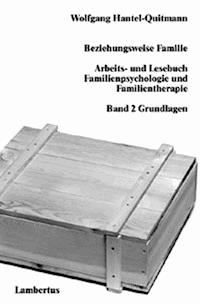24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Sind wir nicht alle ein bisschen Kafka? - Existenzielle Themen und Konflikte im Werk Kafkas – heute noch so aktuell wie vor 100 Jahren - Die eigenen Beziehungen besser verstehen und verändern - Faszinierender Einblick in die psychische Welt Franz Kafkas »Du kannst dich zurückhalten von den Leiden der Welt, das ist dir freigestellt und entspricht deiner Natur, aber vielleicht ist gerade dieses Zurückhalten das einzige Leid, das du vermeiden könntest.« Franz Kafka Das Leben und die Romane Franz Kafkas sind geprägt von Themen wie Einsamkeit, Entfremdung, Angst, Schuld, Scham, Ausweglosigkeit, Willkür, Ohnmacht, Verzweiflung und Familienverstrickungen. »Viele Menschen, die in meine Praxis kommen, leiden an denselben Problemen, die Kafka so eindringlich beschrieben hat. Insofern sind wir heute noch Kafkas Kinder«, stellt der Paar- und Familientherapeut Hantel-Quitmann in seinem Vorwort fest. Schreibend hat Kafka versucht, Antworten zu finden und so seine eigenen Beziehungskonflikte zu lösen. Hantel-Quitmann zeigt anhand von Fallbeispielen aus seiner eigenen therapeutischen Praxis, wie Kafkas Kindern geholfen werden kann, zwischenmenschliche Zusammenhänge besser zu verstehen und die eigenen Beziehungen positiv zu verändern. Dieses Buch richtet sich an:- Alle, die an existentiell menschlichen Fragen interessiert sind- PsychotherapeutInnen aller Schulen, PsychiaterInnen, Paar- und FamilientherapeutInnen- SozialarbeiterInnen und -pädagogInnen, BeraterInnen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wolfgang Hantel-Quitmann
Kafkas Kinder
Das Existenzielle in menschlichen Beziehungen verstehen
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Bettina Herrmann, Stuttgart
unter Verwendung einer Abbildung von © photocase/axelbueckert
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio GmbH, Altusried-Krugzell
Gedruckt und gebunden von CPI – Claussen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98410-1
E-Book ISBN 978-3-608-11666-3
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20518-3
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Prolog: Kafkas Kinder
Kapitel 1
Familie als Schicksal
Die Krise der Familie A.
Familie K.
Begegnung auf Augenhöhe
Kapitel 2
Euch geht’s zu gut
Gewollte Kinderlosigkeit
Euch geht’s zu gut
Kapitel 3
Beschreibung eines Kampfes
Kulturelle Identitäten
Integration als Entwicklungsaufgabe
Der Schriftsteller
Beschreibung eines Kampfes
Kapitel 4
Kein guter Wille
Herr D.
Gefängnis oder Freiheit
Kein guter Wille
Kapitel 5
Stachelschweine
Herr F. und Frau G.
Partnerschaft zwischen Sehnsucht und Angst
Kapitel 6
Was für und gegen eine Heirat spricht
Hochzeit abgesagt
Kafkas Bilanz
Kapitel 7
Trauer, Schuld, Suizid
Einschlafen
Ein unerwünschtes Kind
Das Urteil
Kapitel 8
Verteidigung zwecklos
Eine Paarbeziehung im Koma
Felices Tribunal
Kapitel 9
Schuld und Sühne
Das böse Kind
Kriege
Die Strafkolonie
Kapitel 10
Du bist mein Menschengericht
Das Ende einer Paarbeziehung
Verlobung ohne Verständigung
Kapitel 11
Der menschliche Makel
Das Geheimnis
Julie
Kapitel 12
Das Ungeziefer
Das Ungeziefer
Die Asbestfabrik
Die Verwandlung
Erklärungsnot
Kapitel 13
Es war, als sollte die Scham ihn überleben
Eine Frau trennt sich
Der Prozess
Kapitel 14
Ein Käfig ging einen Vogel suchen
Und täglich grüßt das Murmeltier
Die Legende vom Türhüter
Die Freiheit der Verantwortung
Kapitel 15
Das große Glück und der große Irrtum
Der große Irrtum
Schreibend verlieben
Milena
Seelenverwandte
Paarbeziehungen von außen und von innen betrachtet
Kapitel 16
Demütigung und Verachtung
Was ist ein guter Vater?
Grenzenloses Schuldbewusstsein
Ausgesperrt
Demütigung und Verachtung
Die gute Mutter
Ottla, die Rebellin
Schreiben als Freiheit
Kapitel 17
Existenziell und menschlich
Trost des Schreibens
Ich reiche nicht
Das Schloss
Die Suche nach Identität
Rückmeldung
Kapitel 18
Der stille Riss durch die Familie
Der Riss durch die Familie und das große Schweigen
Die Familie des Barnabas
Kapitel 19
Ein Hungerkünstler
Frau H. und der Tod
Ein Hungerkünstler
Traumliteratur
Epilog: Kafka und die Menschenrechte
Am Bett der Bürokratie
Das Menschenrecht auf Heim, Arbeit, Familie, Mitbürgerschaft
Das menschliche Denken
Die Externalisierung des Verstandes und das Paradies
Verzeichnis der Siglen
Literatur
Über den Autor
Du kannst dich zurückhalten von den Leiden der Welt,das ist dir freigestellt und entspricht deiner Natur,aber vielleicht ist gerade dieses Zurückhalten das einzige Leid,das du vermeiden könntest.
Franz Kafka (Zürauer Aphorismen)
Für Malou, Jonathan, Susanne, Angelika, Klaus, Paule und all die anderen
Prolog: Kafkas Kinder
Jeder Mensch wird in seinem Leben mit existenziellen Fragen konfrontiert: Wie bewältige ich Lebenskrisen? Welche Lebensziele habe ich? Wer ist der richtige Liebespartner für mich? Wie verarbeite ich schwere Verlusterlebnisse? Wie gehe ich mit Nähe und Distanz in einer Partnerschaft um und wie halte ich Intimität aus? Will ich eine Familie gründen und Kinder haben? Wie kann ich meine unangenehmen Gefühle verstehen, wie Angst, Zweifel, Schuld und Scham? Wie gehe ich mit Macht und Ohnmacht um? Wie kann ich schwere Krankheiten bewältigen? Was bedeuten Sterben und Tod für mich?
Solche Lebensfragen können niemals endgültig beantwortet werden und betreffen immer auch die wichtigen menschlichen Beziehungen, in denen man lebt und liebt. Franz Kafka hat in seinen Schriften derlei existenzielle Fragen auf vielfache und besondere Weise thematisiert, insofern sind wir auch alle Kafkas Kinder. Während er allerdings versuchte, durch das Schreiben die eigenen Lebensfragen zu beantworten, gibt es heute im Rahmen von Psychotherapien, Paar- und Familientherapien andere Möglichkeiten, sich selbst und andere zu verstehen, aus Sackgassen herauszukommen, Perspektiven zu wechseln und neue Wege zu gehen.
Das Buch widmet sich in 19 Kapiteln einzelnen existenziellen Themen mit einem aktuellen Konflikt eines Paares oder einer Familie und stellt anschließend Bezüge zu Kafkas Leben und Werk her, das von Angst, Schuld, Scham und Selbstzweifel geprägt war. Dabei wird verständlich, warum Franz Kafka heute noch einer der meistgelesenen Autoren deutscher Sprache ist. Seine Schriften sind universell und zeitlos und machen deutlich, wie sehr Kafka die Sicht der Opfer einnahm. Sie sind ein Plädoyer für die menschliche Behandlung der ohnmächtigen und gedemütigten Menschen, die Aufnahme der Ausgegrenzten, die Angeklagten ohne Schuld, die Opfer von Gewalt, Macht und Willkür, letztlich für die Menschenrechte. Das Jahrhundert Kafkas ist insofern nicht beendet.
Hamburg, im April 2021
Wolfgang Hantel-Quitmann
Kapitel 1
Familie als Schicksal
Identifikation und Abgrenzung
Man wird mit der Geburt nicht nur in die Welt hineingeboren, in eine soziale Lage, eine Kultur und eine Zeit, sondern auch in eine Familie, die zu einem lebenslangen Schicksal werden kann. Leider können sich manche Menschen, die sich dies schon als Kinder wiederholt wünschten, keine andere Familie aussuchen. Sie können nur versuchen ihr eigenes Seelenheil und ihre Identität zu retten, indem sie sich von ihrer Familie abgrenzen.
Kinder haben verschiedene Möglichkeiten, sich von unliebsamen oder einfach nicht zu ihnen passenden Familienkulturen abzugrenzen und damit ihren individuellen Weg zu gehen: in den jugendlichen Reifungskrisen, wie Pubertät und Adoleszenz, in der Berufswahl, in der Wahl eines Partners bzw. einer Partnerin, der Erziehung der eigenen Kinder oder in der Ablehnung des Familienerbes. Individualität entsteht nicht nur aus einer einzigartigen Mischung eigener Fähigkeiten, Erfahrungen, Vorlieben, Werthaltungen, Kompetenzen oder Passionen, sondern auch aus den Unterschieden zu den engsten Vorfahren, Eltern und Geschwistern. Mit solchen individuellen Wegen sind nicht selten Folgekonflikte verbunden, denn damit werden Loyalitäten aufgekündigt oder infrage gestellt, Delegationen abgelehnt oder mehrgenerationelle Bindungen aufgelöst. Solche Abgrenzungen sind einerseits entwicklungsbedingt notwendig, andererseits werden sie von den Eltern als reale oder symbolische Ablehnungen verstanden und lösen entsprechend aggressive Reaktionen aus. Je persönlicher solche Abgrenzungen gemeint sind oder verstanden werden, desto schärfer werden die daraus resultierenden Konflikte. Manchmal eskalieren sie bis zu Erbschaftsfragen. Im Erbe sind nicht nur materielle, sondern vor allem ideelle, emotionale und symbolische Aspekte enthalten. Alle diese Aspekte kommen zusammen, wenn das Erbe ein Familienunternehmen ist.
Die Krise der Familie A.
Die Krise der Familie A. bricht aus, als der einzige Sohn im Alter von 18 Jahren erklärt, nicht den väterlichen Betrieb übernehmen zu wollen und eigene Pläne für seine Zukunft zu haben. Er möchte gern vergleichende Kulturwissenschaften studieren, zusammen mit seiner Freundin, mit der er seit zwei Jahren zusammen sei, und dabei möglichst viel von der Welt sehen und nicht wie sein Vater 70–80 Stunden in der Woche in seinem Restaurant stehen. Der Vater versteht die Pläne seines Sohnes als persönliche Zurückweisung, ja, als Aggression gegen sich. Die Stimmung ist geladen und sie haben nicht mehr miteinander gesprochen, seit sich der Sohn erklärt hat.
Herr A., der Vater, hat Koch gelernt in der norddeutschen Provinz und sich in jahrelangen Mühen in überhitzten Küchen mit endlosen Arbeitszeiten bei despotischen Küchenchefs hochgearbeitet bis zum stellvertretenden Küchenchef, hat immer sparsam gelebt, viel auf die hohe Kante gelegt und sich selbst nichts gegönnt, keine freien Wochenenden und keine überflüssigen Urlaube. Als eine entfernte Tante starb, erbte er einen Teil eines alten Hauses und versuchte sich seinen Lebenstraum, ein eigenes Restaurant, zu verwirklichen. Lange zahlte er an den Schulden ab, um die anderen beiden Miterben auszuzahlen, bis er endlich am Ziel war: ein eigenes Restaurant mit gutbürgerlicher deutscher Küche in der Nähe der Innenstadt in einem eigenen Haus. Mehr als zwanzig Jahre seines Lebens hat er darauf hingearbeitet und seine Ehefrau hat mitgearbeitet, soweit ihr dies als Grundschullehrerin möglich war.
Der Vater hatte als Koch viel Arbeit für wenig Geld, aber auch wenig Zeit, sein Geld auszugeben. Er hat bis Anfang zwanzig bei seiner alleinerziehenden Mutter gelebt. Auch er hatte seinen Vater früh verloren und musste für seine Mutter mitsorgen, die an Rheuma litt. Diese konnte ihrem Beruf nicht mehr nachgehen, blieb zu Hause, litt unter chronischen Schmerzen und der Sohn sorgte für beide. Sein Vater habe die Familie nach der Krankheitsdiagnose seiner Frau verlassen. Um ihn habe er sich nicht mehr gekümmert, und deshalb sei es für Herrn A. besonders schwer zu ertragen, dass er als sorgender Vater sich immer so sehr um seinen Sohn gekümmert habe und dieser es ihm heute so danke. Der Sohn merkt an, dass sein Vater schon immer versucht habe, ihn mit seiner schweren Kindheit und Jugend zu erpressen und ihm Schuldgefühle zu machen. Er könne nachvollziehen, dass der Vater es schwer gehabt habe, aber das gebe ihm nicht das Recht, ihn zur Übernahme des Restaurants verpflichten zu wollen. Dass er als Vater gut für ihn gesorgt habe und er damit vielleicht ein besserer Vater war als sein eigener, sei lobenswert, aber daraus könne doch keine Verpflichtung abgeleitet werden, die er als Sohn zu erfüllen habe, indem er das Restaurant weiterführe.
Bei einem Streit hat der Sohn dem Vater gesagt, er wolle etwas Besseres als nur Koch werden. Anschließend hat er sich aus der Beziehung zu dem aus seiner Sicht dominanten Vater immer mehr zurückgezogen, von seiner Freundin und seinen Studienplänen habe der Vater erst vor einigen Wochen erfahren.
Auch Franz Kafka hatte ein distanziertes Verhältnis zu seinem dominanten Vater, es gab keine vertraulichen Gespräche über persönliche Themen, obwohl sie viel zu lange gemeinsam in einer Wohnung lebten.
Familie K.
Franz Kafkas Familie war – im Laufe der Zeit zunehmend – relativ gut situiert, aber es herrschte ein Familienklima der Angst und Unterordnung, unter dem Franz Kafka zeitlebens gelitten hat. Franz war ein einsames und ängstlich zurückgezogenes Kind, und das lag nicht nur an seinem autoritären Vater, sondern auch an den ständig wechselnden Bezugspersonen, die ihn betreuten, während beide Eltern im Laden arbeiteten. Kinder brauchen sichere und verlässliche frühe Bindungen, um mit Selbstvertrauen die Welt zu explorieren. Dann bauen Bindungssicherheit von außen und innere Selbstwirksamkeitserfahrungen eine stabile Persönlichkeit aus, die von Selbstvertrauen durch die Konflikte des Lebens getragen wird. Franz Kafka hat dies so nicht erlebt, denn sein Vater beherrschte seine Familie wie die Angestellten seines Galanteriewarenladens. Viel später, als 29-jähriger Mann, hielt er in seinem Tagebuch fest: »Meine Mutter ist die liebende Sklavin meines Vaters und der Vater ist ihr liebender Tyrann« (T2, 29. 12. 1912). Der Tyrann Hermann Kafka machte keine Unterschiede zwischen privat und beruflich, Priorität hatten das Überleben und Wachstum des Ladens und die Familie hatte sich dessen zeitlichem Rhythmus und wirtschaftlichen Erfordernissen anzupassen. Und Widerspruch wurde nicht geduldet. Das Patriarchat war allerdings nur die interne Sicht auf die Familie, in der Franz groß wurde, die sie umgebende Kultur war vielschichtig und sorgte für weiteren Druck.
Die Prager Kultur am Ende des 19. Jahrhunderts war auf mehrfache Weise widersprüchlich und dies hatte erhebliche Auswirkungen auf das Leben der Familie Kafka. Obwohl der Anteil der Deutschen an der Bevölkerung Prags nur 7 % ausmachte, besetzten die Deutschen die wirtschaftlichen und politischen Machtzentren, während die Tschechen das Proletariat stellten. Die jüdische Bevölkerung versuchte in diesem fragilen Gefüge erfolgreich zu sein und zugleich die eigenen Traditionen zu wahren. Auch die Familie Kafka bewegte sich entlang der Grenze zwischen erforderter Anpassung und versuchter Autonomie. Herrmann Kafka sah diese Gratwanderung als seine Lebensaufgabe an und setzte all seine Kraft dazu ein, erfolgreich zu sein. Den Kindern muss diese Strategie nicht als Sorge, sondern als willkürliche Despotie erschienen sein. Die Juden nahmen in diesem fragilen Gefüge eine besondere Stellung ein: Sie grenzten sich ab und trafen ihre eigenen Entscheidungen. Auch die Familie Kafka ist auf dieser Grenze zwischen erforderter Anpassung und versuchter Autonomie gewandelt, so dass ein doppelter Druck auf die jüdischen Familien entstand, politisch von außen und wirtschaftlich von innen. Hermann Kafka sah diese Gratwanderung als seine Lebensaufgabe an und setzte all seine Macht dazu ein, erfolgreich zu sein. Den Kindern muss diese Herrschaft immer wieder nicht als Sorge, sondern als willkürliche Despotie erschienen sein. Heute würde man vielleicht versuchen, den Kindern ab einem bestimmten Entwicklungsalter diese fragile Lebenssituation der Familie zu erklären, aber die Grenzen des Verstehens sind nicht nur intellektuelle. Man kann Kindern nur das erklären, was man selbst halbwegs verstanden hat. Soweit wir wissen, hat Hermann Kafka nicht einmal den Versuch gemacht, seinem ersten und einzigen überlebenden Sohn Franz dieses Vorgehen als notwendig oder sinnvoll in turbulenten Zeiten zu erklären. Man erklärte den Kindern nichts, Eltern-Kind-Beziehungen waren Machtverhältnisse. Und Franz sollte noch zeitlebens mit dieser väterlichen Autorität kämpfen, für ihn war es mehr als ein Kampf um die Anerkennung seiner Individualität.
Heute sprechen wir in der Familienpsychologie von einer Mehrgenerationen-Perspektive, die die Entwicklung des Einzelnen aus der Geschichte und Kultur seiner Familienbeziehungen zu verstehen versucht. Für Franz Kafka war auch dies ein unentrinnbares Dilemma: »Die Kette der Generationen ist nicht die Kette deines Wesens und doch sind Beziehungen vorhanden« (Alt 2018, S. 21), schrieb er als 35-jähriger Mann im Winter 1918. Was haben die Beziehungen der vorherigen (jüdischen) Generationen mit seinem Wesen gemacht? Wie sehr hat er in der Auseinandersetzung mit seinem Vater um seine eigene Identität gekämpft, die er glaubte, nur gegen ihn verteidigen zu können.
Hermann Kafka war der Sohn des jüdischen Fleischers Jakob Kafka, der als anerkannter Schächter an die Juden nur koscheres Fleisch verkaufte und zugleich an die Christen Schweinefleisch. Religion ist eben das eine, das Geschäft das andere. Franz Kafka wurde zu einem überzeugten Vegetarier und man fragt sich, ob darin neben den gesundheitlichen Motiven auch persönliche Abgrenzungsbedürfnisse zu sehen sind. Hermann Kafka hatte eine schwere Kindheit, wenig passende Kleidung, musste Kälte und Hunger, Kinderarbeit und Mangel ertragen, und all das war Franz nur allzu bekannt. Dennoch könne der Vater Hermann nicht den Schluss daraus ziehen, dass sein Sohn Franz eine glücklichere Kindheit gehabt habe als er. Der Verweis auf die eigene unglückliche und harte Kindheit enthält Glücksvorstellungen, die nicht einfach auf einen anderen Menschen übertragbar sind. Und sie rechtfertigen nicht die Erwartungen an den Sohn, ihm auf ewig dankbar zu sein.
Hermann Kafka ging sechs Jahre zur Grundschule, erhielt eine leidliche Ausbildung in einem Textilgeschäft, ging drei Jahre zum Militär – wo er anscheinend recht zufrieden war – und arbeitete anschließend sieben Jahre als Großhandelsvertreter für Galanteriewaren. Er reiste durch die böhmischen Lande, nahm Bestellungen auf für Artikel, die in kleinen Werkstätten oder in Heimarbeit hergestellt wurden, und verkaufte sie: Stoffe und Zwirn, aber auch Bleistifte, Hosenträger, Seife oder Knöpfe. Durch die Hilfe eines Heiratsvermittlers lernte er seine spätere Frau kennen, Julie Löwy. Sie wohnte keine fünf Minuten entfernt und kannte das Textilfach seit ihrer Kindheit. Sie war in vielfacher Hinsicht ein Glücksfall für ihn. Diese Frau hatte durch Hauslehrer eine solide Bildung genossen, besaß durch ihren gläubigen Vater eine feste Verankerung im jüdischen Glauben, hatte ein ausgleichendes Gemüt, kam aus gut situiertem Hause und erhielt daher eine Aussteuer, mit der der geschäftstüchtige Hermann Kafka sich wirtschaftlich erheblich verbessern konnte. Mit dem Geld aus der Heirat eröffnete er ein Geschäft für Stoff- und Galanteriewaren am Altstädter Ring in Prag. Sie heirateten am 3. September 1882 und genau 10 Monate später wurde am 3. Juli 1883 ihr Sohn geboren und bekam den Vornamen des Kaisers Franz. Hermann war bei der Heirat genau 30 Jahre alt, seine Frau 26. Sie bekamen noch zwei Söhne, die beide früh starben: Georg starb mit einem Jahr an den Masern und Heinrich mit 7 Monaten an Meningitis. Die Schwester Gabriele, genannt Elli, wurde im September 1889 geboren, Valerie, genannt Valli, im September 1890 und Ottilie, genannt Ottla, im Oktober 1892. Franz wird der große Bruder von drei Schwestern, von denen besonders Ottla ihm lebenslang sehr nah sein sollte.
Julies Vater war Tuchmacher, das Tuchgeschäft hatte er als Mitgift bei der Heirat erworben. Ihre Mutter Esther starb an den Folgen einer Typhuserkrankung, als Julie drei Jahre alt war. Ihre Großmutter Sarah wurde nach dem Tod ihrer einzigen Tochter depressiv und nahm sich das Leben. Kafka schrieb 1911 in sein Tagebuch: »Die Mutter meiner Mutter starb frühzeitig an Typhus. Von diesem Tode angefangen wurde die Groß-Mutter trübsinnig, weigerte sich zu essen, sprach mit niemandem, einmal, ein Jahr nach dem Tode ihrer Tochter gieng sie spazieren und kehrte nicht mehr zurück, ihre Leiche zog man aus der Elbe« (T1, 25. 12. 1911). Damit verlor Kafkas Mutter Julie ihre Mutter und ihre Großmutter in frühen Jahren. Ihr Vater heiratete erneut. Ihre Stiefmutter hieß ebenfalls Julie, war 33 Jahre alt bei der Heirat und bekam noch zwei Kinder, Rudolf und Siegfried. Siegfried Löwy studierte später Medizin und ließ sich als Landarzt nieder. Franz Kafka hatte zeitweise zu seinem Onkel Siegfried eine innige Beziehung und verarbeitete seine Erfahrungen mit ihm u. a. in seiner Erzählung »Der Landarzt«. Auch Siegfried beging Suizid, kurz bevor er nach Theresienstadt deportiert werden sollte. Man spricht von Schwermut, Weltflucht, geringen Lebensenergien, und auch Franz Kafka hat an sich diese depressiven Neigungen festgestellt, allerdings nicht – wie manche seiner Leser meinen – in seinen Werken, sondern in seinem Wunsch, ganze Nachmittage auf dem Sofa zu verfaulenzen (Alt 2018, S. 30). Vielleicht war es Hermann Kafkas tatkräftige, energiereiche und lebendige Ausstrahlung, die Julie an ihm so attraktiv fand. Er war groß und kräftig, sah gut aus, war sich dessen durchaus bewusst und war stets in gutes Tuch gekleidet und sehr auf seine Außenwirkung bedacht. Auf seinen Briefbögen prangte eine von Ehrenzweigen umrankte Dohle als Familienwappen: Dohle heißt auf Tschechisch kavka.
Hermann Kafka betrieb seinen Galanteriewarenladen mit großem Eifer und Fleiß. Er vergrößerte ihn sukzessive und zog in den Jahren zwischen 1882 bis 1918 vier Mal mit ihm um, allerdings liegen alle Orte nicht mehr als einhundert Meter voneinander entfernt. Er stellte mehrere Verkäufer und Lehrmädchen ein, ebenso einen Geschäftsführer. Einerseits sorgte er für seine Angestellten wie ein Vater, wenn dies den Interessen des Ladens entsprach, andererseits konnten seine Handlungen nur noch als despotisch bezeichnet werden. Er war launisch, hatte impulsive Wutausbrüche, schikanierte seine Angestellten und beschimpfte sie als »Vieh«, »Hunde« oder »bezahlte Feinde«, denen er wiederholt Betrug unterstellte. Seine eigenen Verfehlungen waren dagegen nur dem Eifer eines guten Geschäftsmannes geschuldet. Im September 1887 gibt es eine erste anonyme Anzeige gegen ihn, weil er am Sonntagvormittag seine Waren auf der Straße zum Verkauf angeboten haben soll; im Dezember 1889 wird er wieder wegen Störung der Sonntagsruhe angezeigt, weil er Kunden am Sonntagnachmittag in seinem Geschäft bedient haben soll; Anfang 1893 wird er von einem Kunden bei der Polizei beschuldigt, gefälschte Banknoten weitergegeben zu haben, und im Februar 1894 wird er angezeigt, weil er mit Falschgeld bezahlt haben soll; im März 1895 wird er zum dritten Mal angezeigt, wieder handelt es sich um Bezahlung mit Falschgeld.
Franz Kafka hat die schlechte Behandlung der Angestellten immer wieder versucht auszugleichen, er schämte sich für das Verhalten seines Vaters. So ging Hermann Kafka durch die Reihen seines großen Ladens und zog stapelweise Wäsche herunter, wenn sie nach seinen Maßstäben nicht ordentlich ausgelegt war. Der Geschäftsführer musste die Wäsche vom Boden aufheben und wieder ordentlich hinlegen. Es waren erniedrigende Schikanen, die den Sohn zur tiefen Fremdscham für den eigenen Vater veranlassten. Franz Kafka schrieb 1919 mit drastischen Worten: »Und hätte ich, die unbedeutende Person, ihnen unten die Füße geleckt, es wäre noch immer kein Ausgleich dafür gewesen, wie Du, der Herr, oben auf sie loshacktest« (Alt 2018, S. 32). In diesem Kommentar sind mehrere Themen enthalten, die ihn literarisch beschäftigten: Aggression, Schuld und Strafe, Sadismus, Macht, Demütigung, Scham. Und warum schätzte er sich selbst als so unbedeutend ein, meinte er damit nicht eher die eigene Machtlosigkeit? Wann immer er im Laden war, dort arbeitete oder seinen Vater vertrat, war er – ganz wie seine Mutter – auf Ausgleich und sogar Wiedergutmachung bedacht. Aber Franz musste gar nicht in den Laden gehen, denn er kannte seinen despotischen Vater von zu Hause genügend. Auch hier gab es Bedienstete, die von ihm schikaniert wurden. Hermann Kafka explodierte bei geringsten Kleinigkeiten, wurde jähzornig und beleidigend – und machte auch vor Frau und Kindern nicht halt.
Was bedeutet es für einen kleinen Jungen, einen solchen narzisstischen Vater zu haben, der bei Andeutung von Widerspruch und Kritik verletzt und gekränkt reagiert? Der so sensibel für die eigenen Belange wie unsensibel für andere ist? Der stets bewundert werden will und bei kleinsten Ereignissen ausrastet? Ein kleiner Junge will stolz sein auf seinen Vater und sich nicht für ihn schämen müssen. Wäre der Junge selbstbewusst und sich seiner väterlichen Liebe sicher, dann könnte er sich mit ihm streiten, ihn auf sein Fehlverhalten hinweisen, Auseinandersetzungen und Konflikte mit ihm eingehen. Aber ein schwaches, zurückhaltendes und ängstliches Kind, das den Vater bestenfalls in Augenblicken oder für besondere Eigenschaften bewundert und sich von diesem nicht wirklich geliebt fühlt, das kann diese Stärke nicht aufbringen und sich dem Vater entgegenstellen. Franz war zu unsicher und ängstlich, um es mit diesem starken und despotischen Vater aufzunehmen. Später hat er es auf seine – literarische – Weise getan in seinem »Brief an den Vater«, den dieser übrigens nie gelesen hat. Die offene Opposition gegen diesen Mann wurde von einer stärkeren, selbstsicheren Person gelebt, leider nicht der Mutter, sondern von der kleinen Schwester Ottla, und Franz hat sie dafür zeitlebens bewundert.
Julie und Hermann Kafka hatten aus heutiger psychologischer Sicht vielleicht eine eheliche Beziehung, die aus einem Zusammenspiel von Bewundern und Bewundertwerden bestand; er genoss die Bewunderung und sie genoss es, einen solchen bewundernswerten Mann zu haben. Er war der gute und starke, erfolgreiche und potente Mann und Vater, sie war die Frau an seiner Seite. Sie war primär seine Frau und nicht die Mutter der Kinder, sie ging an sechs Tagen in der Woche mit ihm zur Arbeit und in den täglichen Mittagspausen nach Hause, die Kinder wurden den Bediensteten und den Kindermädchen überlassen. Auf allen Fotos der Kinder sind die Eltern nicht zu sehen, sind die Kinder allein. Hermann und Julie waren ein arbeitsreiches und erfolgreiches Paar, aber für ihre Elternschaft hatten sie keine Zeit. Eine solche Paarbeziehung entsprach sicher dem pädagogischen und kulturellen Zeitgeist des aufstrebenden Mittelstands, bei dem sich die Kinder dem Weg nach oben zu Sicherheit und Wohlstand unterzuordnen hatten.
Das Bad der Wohnung war ein Rückzugsort für die Kinder und dort hat Franz den kleinen Schwestern Geschichten vorgelesen oder kleine private Theateraufführungen für sie gemacht. Franz war für die Schwestern da und die hatten ihren Schwestern-Kokon, aber er war mit sich allein. Der Altersabstand zu den Schwestern war zu groß und ein Bruder fehlte, der Vater und die Mutter waren bei der Arbeit – und die Bediensteten wechselten. Als er in die Schule kam, sollte sich das einsame Lebenskonzept etwas ändern, dort lernte er Freunde kennen, mit denen er ein Leben lang verbunden bleiben sollte. Die Gruppe der Gleichaltrigen hilft bei der Ablösung aus dem Elternhaus, die ersten Liebespartner bei der Ablösung aus den engen Freundschaften. Diese Stufen der Reifung in sozialen Beziehungen hat Franz Kafka zumindest nicht linear durchlaufen. Ihm gelang die Ablösung aus seinem Elternhaus nur schwer, manche meinen gar nicht (siehe Alt 2018), trotz guter Freundschaften, und das hatte viele Gründe, nicht zuletzt wieder familiäre.
Begegnung auf Augenhöhe
Im Verlauf der Familienberatung der Familie A. stellte sich zwischen Vater und Sohn langsam das Gefühl ein, erstmals auf Augenhöhe miteinander zu sprechen. Der Vater Herr A. hat fast erstaunt gemerkt, dass er einen großen Sohn hat, der reif in seinen Einschätzungen wirkt und der sich um eine bessere Beziehung zu ihm bemüht, und der Sohn vernahm erfreut, dass sein Vater ihn erstmals fragte, wie es ihm geht, wie seine Freundin denkt, warum er Kulturwissenschaften studieren möchte, was ihn daran fasziniert und dass der beste Studienort einige Hundert Kilometer entfernt ist, nicht wegen der Distanz zum Elternhaus, sondern weil es dort das beste Studienangebot gebe. Die Mutter Frau A. hat beide in der gegenseitigen langsamen Annäherung unterstützt und sich still gefreut. Der Sohn spürte irgendwann den väterlichen Stolz und der Vater respektierte die Entscheidung seines Sohnes, fühlte sich auch nicht mehr persönlich abgelehnt. Der Sohn bekam seinen Studienplatz, seine Freundin ebenso, und beide beschlossen nach dem Abi erst einmal eine Reise nach Italien und Griechenland zu machen, den Ursprungsländern europäischer Kultur. Am Ende entstand die Frage, was aus dem Restaurant werde, wenn der Sohn einen anderen Weg einschlagen werde, aber dies war ein Thema zwischen Herrn A. und Frau A. Sie haben sich entschieden, das Restaurant zu verpachten und zu reisen, denn es gab viel nachzuholen. In dem Zusammenhang haben sie zum ersten Mal darüber gesprochen, wie sie als Paar leben wollen, wenn der Sohn aus dem Haus ist. Frau A. hatte ein wenig Angst davor, und er meinte nur, er wolle sich mit solchen Zukunftsfragen erst beschäftigen, wenn es soweit sei.
Der Sohn der Familie A. hat sich gegen seinen Vater durchgesetzt, ist seinen eigenen Weg gegangen, aber dazu brauchte er Selbstbewusstsein und persönliche Stärke, die Franz Kafka – zumindest gegenüber seinem Vater – nie hatte. Dem Sohn Franz blieben – wie allen in seiner Umgebung – die Abwertungen und Demütigungen des Hermann Kafka nicht erspart. Und Franz’ Wunsch, die Anerkennung und den Stolz seines Vaters zu spüren, blieb weitgehend unerfüllt. Zeitlebens hat er sich nach dieser Anerkennung gesehnt, blieb damit abhängig und hat vielleicht auch deshalb die Ablösung nie richtig geschafft. Wenn er später als Erwachsener wieder ein von ihm geschriebenes Buch den Eltern zeigte und sein Vater sagte: »Leg’s auf den Nachttisch«, dann war dies bereits eine besondere Anerkennung für ihn. Seine Selbstzweifel waren so überlagernd, dass er seine Eltern nicht kritisierte, sondern für beinahe alles sich selbst die Schuld gab. So schreibt er am 29. 12. 1912 in sein Tagebuch: »Die Eintracht der Familie wird eigentlich nur durch mich gestört.« Wie hat er gestört? Bestenfalls durch Passivität und Rückzug. Er hat sich dem väterlichen Gebot angepasst und untergeordnet, rebelliert hat er nur literarisch.
Kapitel 2
Euch geht’s zu gut
Das emotionale Familienklima
Es gibt zwei Faktoren, die für das Wohlergehen der Kinder in ihren Familien besonders bedeutsam sind: die soziale Lage der Familie und das emotionale Familienklima. Während sich die soziale Lage auf das finanzielle Einkommen der Familie bezieht, die Wohnlage und das kulturelle Umfeld, setzt sich das emotionale Familienklima aus Gefühlen zusammen, die eine Atmosphäre schaffen, in der Kinder sich wohlfühlen oder in ihrer Entwicklung eingeschränkt werden. Aus den Stimmungen und Gefühlen der einzelnen Familienmitglieder – wie Liebe, Angst, Sorge, Trauer, Ärger, Wut etc. – entsteht ein ganz einmaliges emotionales Klima, das sich fördernd oder hemmend auf die kindlichen Entwicklungen auswirkt. Es kann zudem echt sein, also mit den wirklichen Gefühlen übereinstimmen, oder es kann ein Scheingefühl entstehen, das dazu da ist, die wirklichen Gefühle zu verdecken oder zu verbergen. Dann können bei den Kindern emotionale Verwirrungen, Störungen der Wahrnehmung oder auch aggressive bis depressive Reaktionen entstehen. Wie muss ein emotionales Familienklima beschaffen sein, in dem ein Kind sich ängstlich, unsicher, schuldhaft, einsam, schamhaft und ohne jegliches Selbstvertrauen fühlt? Kafka wusste es!
Gewollte Kinderlosigkeit
Das kinderlose Paar Frau und Herr B. sind in die Paarberatung gekommen, weil Frau B. es mit ihrem Mann nicht mehr aushalte. Er sei ein großes Kind, unfähig über Gefühle zu sprechen, einfach nicht erwachsen und wolle keine Kinder mit ihr. Mittlerweile hat sie sich damit abgefunden und will mit ihm auch keine Kinder mehr haben. Sie denke eher an Trennung. Sie ist Ende 30 und hat nicht mehr viel Zeit, wenn sie noch Kinder von einem anderen Mann haben möchte.
Herr B. sitzt in sich zusammengesunken im Sessel mir gegenüber und spricht mit leiser Stimme über seine einsame Kindheit. Einsamkeit ist für ihn etwas sehr Vertrautes, einerseits hasst er dieses Gefühl, andererseits kennt er sich damit sehr gut aus. Das führt heute dazu, dass er sich immer wieder in sich zurückzieht, nicht mit seiner Frau spricht, keine Gefühle zeigt und in den Keller geht, um mit seiner Eisenbahn zu spielen. Ja, die Eisenbahn ist für ihn ein Stück glücklicher Kindheit, die er so nie wirklich hatte. Ihren Kinderwunsch könne er ihr leider nicht erfüllen, er wolle keine Kinder. Immer wenn er an Kinder und Kindheit denke, werde er wütend auf seine Eltern. Und warum solle man Kinder haben, wenn man damit überhaupt keine schönen Gefühle verbinde.
Seine Familie bestand aus ihm, seinen Eltern und seinem großen Bruder, der aber nicht wirklich einer war. Er war acht Jahre älter, hat nie etwas mit ihm unternommen, für ihn war er immer der Kleine, der ihm lästig war. Früher hat er den Kontakt zu diesem älteren Bruder immer wieder gesucht, aber der hat ihn zurückgewiesen und gesagt, er sei nicht sein Babysitter. Heute wolle er keinen Kontakt mehr zu seinem Bruder, obwohl dieser sich das wünsche.
Seine Eltern waren beide berufstätig, ein Gehalt reichte eben nicht für alle. Der Vater arbeitete als Handwerker bei einer großen Firma und machte viele Überstunden. Er hatte immer wieder neue Baustellen, so dass er teilweise morgens früh losfahren musste und abends erst spät wiederkam, manchmal auch gar nicht, dann war er auf Montage. Die Mutter hatte verschiedene Aushilfsjobs mit ständig wechselnden Arbeitszeiten, so dass man nie wusste, wann sie ging, wann sie kam, wann sie ansprechbar war und wann nicht. Sie war ständig im Stress. Der Bruder hat diese Freiheit genutzt und ist immer raus zu seinen Freunden, während er allein zu Hause blieb.
Als kleines Kind hat er meist allein gespielt, manchmal kam ein Junge aus der Nachbarschaft vorbei. Viele Kinder haben sich im Kindergarten nachmittags zum gemeinsamen Spielen verabredet, aber er wollte das nicht. Die Kinder waren laut und anstrengend. Zu ihm nach Hause konnte keiner kommen, weil seine Eltern so gut wie nie da waren, und daher musste er immer fragen, ob er zu einem anderen Kind gehen konnte, wenn er gemeinsam spielen wollte. Manchmal ging das für ein paar Mal, aber dann wollten das die anderen Mütter nicht mehr, weil sie sich als Babysitter für ihn fühlten. Also hörte das Nachmittagsverabreden immer wieder nach kurzer Zeit auf und irgendwann verabredete er sich gar nicht mehr. Er hat sich in seiner Einsamkeit eingerichtet und seine Eltern haben ihn dafür gelobt. Als er klein war, hat seine Mutter immer wieder zu ihm gesagt, am liebsten habe sie ihn, wenn er schlafe, also habe er viel geschlafen. Morgens stand er früh auf, nachmittags machte er ein kleines Nickerchen und abends ging er sehr früh ins Bett. Er war immer allein mit sich und er hatte das Gefühl, dass dies auch für die Eltern die beste Lösung war. Sie haben ihm nie gesagt, dass sie ihn nicht wollen, aber er hatte so ein Gefühl. Nein, ein Wunschkind war er wahrscheinlich nicht, vielleicht ein Versöhnungskind, mit dem die Eltern hofften, ihre Beziehung wieder zu verbessern.
Später, als er schon in der Schule war, hat er viel gelesen. Es gab die Stadtbücherei in der Nähe, wo er Bücher ausleihen konnte, da hat er sich jede Woche ein neues Buch geholt, anfangs recht wahllos oder auf Empfehlung der Bibliothekarin, später wusste er selbst, wen und was er lesen wollte. Seine Lieblingsautoren waren Charles Dickens, Mark Twain und John Irving. Bücher waren für ihn die Welt. Wenn er Bücher las, entstanden in seinem Kopf innere Bilder, aber wenn er einen Film im Fernsehen sah, wurden diese Bilder fertig mitgeliefert, das empfand er als langweilig, also waren Bücher besser als Filme.
An den Wochenenden haben beide Eltern sich von ihrer Arbeit erholt, als Familie hat man selten etwas gemeinsam unternommen. Sie sagten immer, dass sie am liebsten das Wochenende auf der Couch verbringen mit Fernsehen, dabei haben sie getrunken und sich regelmäßig darüber gestritten, wer mehr für die Familie tue. Dann habe er regelrechte Schuldgefühle bekommen, weil es ja um ihn ging und die Arbeit, die er seinen Eltern mache. Alleine wären sie ohne ihn vielleicht glücklich gewesen, also hatte er immer diffuse Schuldgefühle.
Ja, Streit gab es fast immer, wenn beide Eltern da waren, deshalb war es auch ganz gut, dass sie so viel gearbeitet haben. Er hat sich dann immer unsichtbar gemacht, ist in sein Zimmer gegangen, hat gelesen oder ist einfach auf die Straße gegangen, wenn es ganz schlimm wurde zwischen den Eltern. Sein Vater hat ihn auch sehr hart bestraft, wenn er seiner Meinung nach etwas falsch gemacht hatte, meistens mit Taschengeldentzug und Stubenarrest. Aber das hat ihn nicht wirklich getroffen, denn er war ja sowieso meist allein zu Hause. Die Eltern haben gesagt, wenn er das noch einmal macht, dann wird in diesem Jahr sein Geburtstag nicht gefeiert. Er weiß heute nicht mehr, was er angestellt hatte, aber zweimal wurde sein Geburtstag nicht gefeiert. Zum Geburtstag wurde in seiner Familie immer das Lied gesungen »Wie schön, dass du geboren bist«. Aber wenn der Geburtstag ausfiel, dann dachte er immer, dass es nicht schön sei, dass er geboren wurde.
Als Kind war er nicht nur einsam und zurückzogen, sondern auch ängstlich: dass sich die Eltern trennen und er in ein Heim muss, dass sie kein Geld mehr haben oder dass er bald sterben muss. Er hat sich später viel mit dem Regenwald im Amazonasgebiet beschäftigt und Bücher darüber gelesen. Das hat ihn etwas beruhigt, weil er das Gefühl hatte, etwas viel Größeres müsste sterben, und dann wäre sein Tod nicht so wichtig.
Auf meine Frage, was er aus heutiger Sicht am liebsten an seiner Kindheit ändern würde, kann er zunächst nicht antworten. Dann sagt er, dass er das Gefühl, erwünscht zu sein und geliebt zu werden, gut hätte gebrauchen können. Er hatte immer das Gefühl überflüssig zu sein oder zu stören. Manchmal dachte er auch, dass er ein Kind aus einer anderen Familie sei, dass er adoptiert wurde, dass seine Familie woanders lebe und ihn vermisse. Dieses Gefühl war schön und schmerzlich zugleich.
Einsamkeit, Angst, Schuld und Selbstzweifel haben ihn zu dem gemacht, der er heute ist. Seinen Job erledige er gewissenhaft, die Gartenarbeit und die Eisenbahn erfreuten ihn, andere Hobbys habe er nicht, er habe schon immer genügsam gelebt, mehr brauche er nicht zum Leben. Und wenn seine Frau sich von ihm trennen wolle, dann könne er das irgendwie auch verstehen und wünsche ihr viel Glück, er könne ihr halt kein besseres Leben bieten und einen Kinderwunsch habe er nicht. Und als er den letzten Satz sagt, hebt er zum ersten Mal den Kopf und sieht mich an, so als wolle er sagen: Hier bin ich, ich kann nicht anders. Ich frage ihn abschließend nach einem prägnanten Satz aus seiner Kindheit, der ihm als Erstes in den Kopf komme, und er sagt: »Was willst du denn schon wieder?« Diesen Satz hätten seine Eltern immer zu ihm gesagt, wenn er ihre Nähe suchte und eigentlich nur kuscheln wollte. Dann habe er sich mitten in der Bewegung wieder umgedreht und sei in sein Zimmer gegangen. Ja, Nähe sei für ihn auch schwierig.
Euch geht’s zu gut
Für die Familie von Franz Kafka gab es auch einen solchen Satz, den nicht Franz selbst erinnert, der aber von seinem Biographen stammt. Reiner Stach empfiehlt den Satz von Hermann Kafka an seine gesamte Familie, insbesondere an seine Kinder: »Euch geht’s zu gut!« Was wollte er mit diesem Satz seiner Familie sagen? Er hat ihn anscheinend so oft wiederholt, dass er zu einer stehenden Redewendung wurde. Darin enthalten war einerseits die verspätete Klage über die eigenen Entbehrungen in der Kindheit; zweitens der Hinweis, dass es allen, insbesondere seinen Kindern heute vergleichsweise viel besser gehe als ihm damals; drittens sollten damit die Klagen der anderen als vergleichsweise geringfügig eingestuft werden (Jammern auf hohem Niveau); viertens war darin der Hinweis enthalten, jegliche Kritik an der Familiensituation, insbesondere an seiner Person, zu unterlassen, denn er hat so viel mehr gelitten als alle anderen in der Familie; und fünftens sollte dieser Satz bei allen Schuldgefühle hervorrufen, weil in jeder Kritik eine unrechtmäßige Anmaßung und eine Geringschätzung seines Lebenswerkes, insbesondere seiner Leiden, enthalten sei. Mit diesem Satz sollte jegliche Unzufriedenheit oder Kritik als unverschämt im Keim erstickt werden. Auch alltägliche Sorgen waren keine mehr, weil sie im Vergleich zu den Sorgen des Vaters in seiner Kindheit lächerlich waren. Alle waren damit qua Definition glücklich, denn ein kurzer Blick in seine Kindheit zeigte, was Entbehrungen, Leiden und wahres Unglück bedeuten konnten. So sollte Scham schon allein bei dem Gedanken entstehen, eigene Sorgen oder Wünsche vorzubringen. Und die wütenden Reaktionen des Vaters erschienen gerecht und verständlich angesichts der Unverschämtheiten aller anderen.
Der Sohn Franz erlebte diese mit Prahlereien und Zank einhergehenden Arien und Wutausbrüche seines Vaters als quälend. 1911 schrieb er in sein Tagebuch:
»Unangenehm ist es, zuzuhören, wenn der Vater mit unaufhörlichen Seitenhieben auf die glückliche Lage der Zeitgenossen und vor allem seiner Kinder von den Leiden erzählt, die er in seiner Jugend auszustehen hatte. Niemand leugnet es, dass er jahrelang infolge ungenügender Winterkleidung offene Wunden an den Beinen hatte, dass er häufig gehungert hat, dass er schon mit 10 Jahren ein Wägelchen auch im Winter und sehr früh am Morgen durch die Dörfer schieben musste – nur erlauben, was er nicht verstehen will, diese richtigen Tatsachen im Vergleich mit der weiteren richtigen Tatsache, dass ich das alles nicht erlitten habe, nicht den geringsten Schluss darauf, dass ich glücklicher gewesen bin als er, dass er sich wegen dieser Wunden an den Beinen überheben darf, dass er von allem Anfang an annimmt und behauptet, dass ich seine damaligen Leiden nicht würdigen kann und dass ich ihm schließlich gerade deshalb, weil ich nicht die gleichen Leiden hatte, grenzenlos dankbar sein muss. Wie gern würde ich zuhören, wenn er ununterbrochen von seiner Jugend und seinen Eltern erzählen würde, aber alles dies im Tone der Prahlerei und des Zankens anzuhören, ist quälend« (T1, 26. 12. 1911).
Eine beinahe freundliche, zurückhaltende und nüchterne Analyse. Wo bleibt die Wut auf diesen selbstherrlichen Vater? Bei depressiven Neigungen ist zu befürchten, dass Aggressionen eher gegen sich selbst gewandt werden. Dies hat er dann literarisch radikal getan mit seinem grandiosen Erstlingswerk: »Das Urteil«. Aber dazu später mehr.
Angst, Schuld und Scham führen in dieser Kombination zu Unterordnung und einer devoten Dankbarkeit, nicht selten zu einem inneren Rückzug aus den Familienbeziehungen hinein in eine selbstgewählte Isolation und Einsamkeit. Die Kinder der Familie Kafka wurden nicht geschlagen, aber auf vielfache Weise gedemütigt und hart bestraft. Franz Kafka beschreibt eine traumatische Erfahrung, wie er vom Vater als Kind auf dem Balkon (»Pawlatsche«) ausgesperrt wurde, weil er die nächtliche Ruhe gestört hatte. Kein Wunder, dass Franz Kafka sich in seiner Literatur mit Gerechtigkeit und Macht, Schuld und Strafe, Scham und Angst auseinander setzte. Und mit Verurteilungen und Anklagen, ohne wirklich Schuld auf sich geladen zu haben. So führt Franz Kafka sein introvertiertes Wesen, seine persönliche Unsicherheit und schweigsame Einsamkeit in der Familie zurück auf »die dumpfe, giftreiche, kinderauszehrende Luft des schön eingerichteten Familienzimmers«, wie er in einem Brief an seine älteste Schwester Elli Hermann im Herbst 1921 schreibt (Kafka 1975, S. 347). Franz Kafka beschreibt mit diesen eindringlichen Begriffen – dumpf, giftreich, kinderauszehrend – ein emotionales Familienklima, das für die Kinder geradezu toxisch gewesen sein muss. Ein Kind, das in einem Klima der Angst, der Demütigung und der Schuldzuweisungen groß wird, entwickelt wenig Selbstvertrauen, wird wiederholt von Selbstzweifeln und Schuldgefühlen geplagt und braucht gute Selbstwirksamkeitserfahrungen und kompensatorische Beziehungen, um sich selbst aus diesem Klima zu befreien. Aber auch außerhalb der Familie macht ein ängstliches Kind nicht selten die gleichen Erfahrungen, insbesondere wenn die Familienkultur zur allgemeinen passt.
Als er in die Schule kam, begegnete er nur Autoritäten, vor denen er Angst hatte und auf die er scheu, selbstunsicher und zurückhaltend reagierte. Keine guten Voraussetzungen, es viele Jahre in Schulen auszuhalten, die noch nach dem Nürnberger Trichter und einer schwarzen Pädagogik funktionierten. Die schulischen Anforderungen konnte er nur schaffen, weil seine Intelligenz ihn rettete, aber die Erfolge führten nicht zu einem gestiegenen Selbstvertrauen, sondern nur zu weiteren Angstszenarien: »Oft sah ich im Geist die schreckliche Versammlung der Professoren … um diesen einzigartigen himmelschreienden Fall zu untersuchen, wie es mir, dem Unfähigsten … gelungen war, mich bis hinauf in diese Klasse zu schleichen« (Handbuch, S. 4). Das war keine Koketterie eines Jugendlichen, dazu bräuchte man Selbstbewusstsein. Solche Sätze waren ernsthafter Ausdruck von geringem Selbstwert und quälenden Selbstzweifeln.
Zu seinen Mitschülern hatte er gute Beziehungen, aber es blieb eine Distanz, eine persönliche Schutzzone, die kaum überwunden werden konnte. So berichtet später ein Klassenkamerad, dass in der Beziehung zu Franz kein richtiges Vertrauen entstehen konnte, weil ihn »eine dünne Glaswand umgab« (Handbuch, S. 4). Das ist die Beschreibung einer Selbstisolation, die sein zerbrechliches Inneres schützen sollte und mit jedem weiteren Rückzug aus sozialen Beziehungen seine persönlichen und sozialen Probleme verstärkte. Der innere Druck wurde durch die Schule größer, nicht kleiner. Irgendwann und irgendwie musste er sich entladen, und so begann er mit 14 Jahren seine ersten literarischen Versuche, die er allerdings später vernichtete, wie die »Geschichte vom schamhaften Langen und vom Unredlichen in seinem Herzen«.
Vom 6. bis 10. Mai 1901 legt er seine schriftlichen Maturitätsprüfungen ab in Deutsch (Aufsatzthema: Welche Vorteile erwachsen Österreich aus seiner Weltlage und seinen Bodenverhältnissen?), in Latein, Griechisch und Mathematik, die mündlichen Prüfungen sind vom 8. bis 11. Juli. Im Fach Deutsch bekommt der heute wegen seiner reinen Sprache vielgelobte Literat und meistgelesene Autor deutscher Sprache nicht mehr als ein »befriedigend«. Im Abschlusszeugnis werden ihm lobenswerte bis befriedigende Leistungen bescheinigt. Den an die Matura anschließenden einjährigen Militärdienst muss er nicht absolvieren, ihm wird »Schwäche« attestiert. Anschließend fährt er mit seinem Onkel Siegfried Löwy nach Helgoland und Norderney in der Hoffnung, dass die Seeluft dem schwächlichen Jungen die Lungen stärke. Am 1. Oktober beginnt er mit seinen Freunden Oskar Pollak und Hugo Bergmann wie verabredet das Studium der Chemie, ist aber derart enttäuscht vom Studium, dass er bereits drei Wochen später in die juristische Fakultät wechselt. Das Jura-Studium ist – damals wie heute – ein Fleißstudium, trocken und intellektuell wenig fordernd. So stellt er fest, »dass ich mich in den paar Monaten vor den Prüfungen unter reichlicher Mitnahme der Nerven geistig förmlich von Holzmehl nährte, das mir überdies schon von tausenden Mäulern vorgekaut war« (Handbuch, S. 6). Er hat seine acht Semester Jurastudium teilweise mit Germanistik und Kunstgeschichte aufgelockert, ansonsten aber nur die Pflichtkurse besucht, um den Abschluss zu erreichen. Sein Staatsexamen und die drei Rigorosa absolviert er von November 1905 bis Juni 1906 mit der schlechtesten Note, die für ein Bestehen notwendig war. Am 1. Oktober beginnt er beim Prager Land- und Strafgericht sein obligatorisches Gerichtsjahr. Am 18. Juni 1906 legte er seine Promotionsprüfung zum Doktor der Rechte bei Alfred Weber ab, dem Bruder von Max Weber. Aber Kafkas Interessen hatten sich bereits verlagert, er schrieb Erzählungen, diskutierte mit Max Brod über Ästhetik und las mit ihm Flaubert im Original. Im Juni 1907 gibt er Max Brod ein Manuskript zu lesen über »Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande«. War das seine innere Vorbereitung auf eine Familie?
Franz Kafka sollte niemals Kinder bekommen, obwohl er sich immer wieder nach ihnen sehnte, aber er konnte nicht einmal eine stabile Paarbeziehung erleben und Hochzeiten waren trotz mehrfacher Versuche auch unmöglich. Herr B. wollte keine Kinder, weil seine Kindheitsgefühle mit Einsamkeit und Wut auf seine Eltern verbunden waren. Ihre Kinderlosigkeit haben beide als Folge ihrer eigenen Kindheit verstanden. Herr B. hat einen Teil seiner verlorenen Kindheit mit einer großen Eisenbahn nachgeholt, Franz Kafka hat diese Erfahrungen literarisch zu verarbeiten versucht. Als er am 8. 11. 1912 zum zweiten Mal Onkel wurde, bekannte er »nichts als wütenden Neid, … denn ich werde niemals ein Kind haben« (RS2, S. 161). Keine biologischen Kinder, aber viele im Geiste.
Kapitel 3
Beschreibung eines Kampfes
Reifung und Identität
Identität ist ein Lebensgefühl und ein Wissen darum, stets derselbe Mensch zu sein, auch wenn sich Lebensumstände, Körperzustände, Beziehungen oder Kontexte verändern. Es ist das sichere Gefühl, abends noch derselbe zu sein wie morgens, heute derselbe wie der auf den Kinderfotos, als Mutter dieselbe Person wie als Tochter, als Sohn derselbe wie als Partner, in diesem Land derselbe wie in jedem anderen. Dieses Gefühl der Kohärenz und Kontinuität der eigenen Person schafft Identität. Wer über dieses existenzielle Gefühl niemals ernsthaft zweifeln musste, kann sich glücklich schätzen.