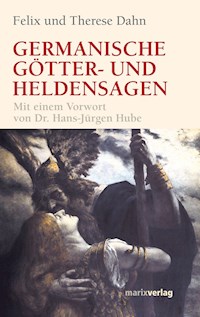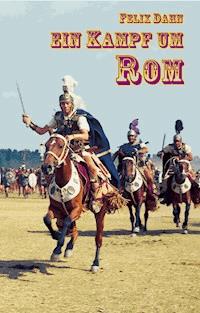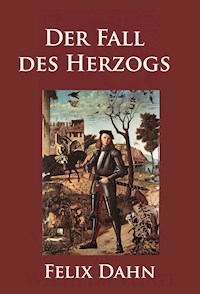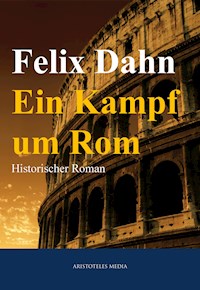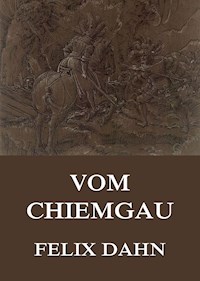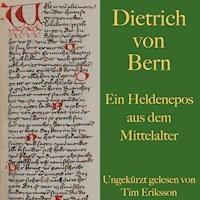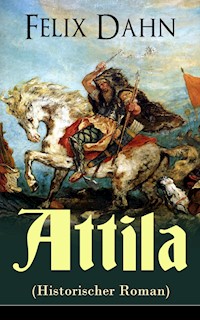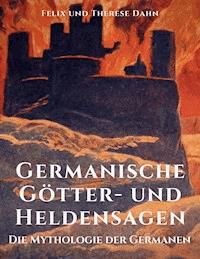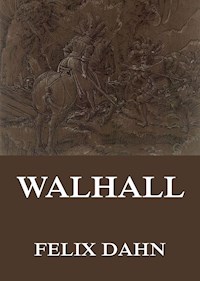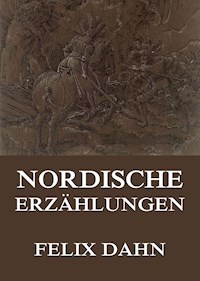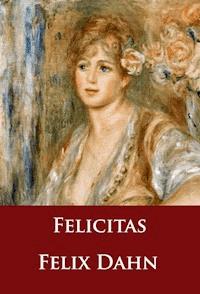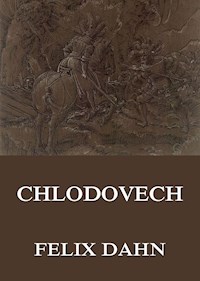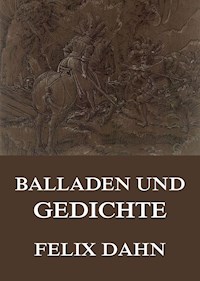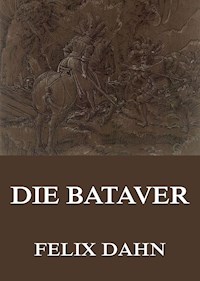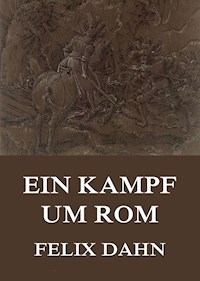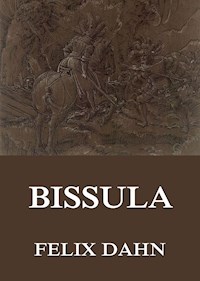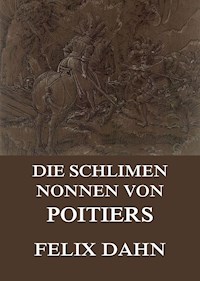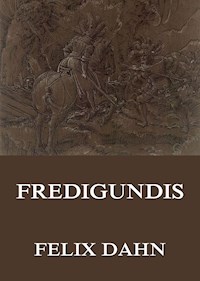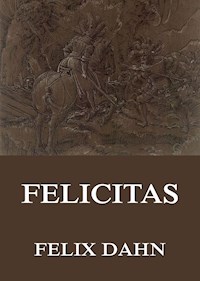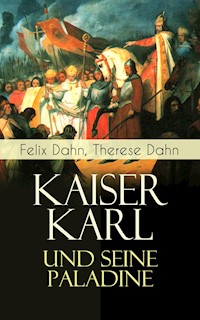
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Kaiser Karl und seine Paladine" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "König Pippin herrschte mit starker Hand über das Reich der Franken. Klein war seine Gestalt, groß sein Mut. In seines Vaters Palast war einst ein Löwe ausgebrochen: brüllend lief er durch Hallen und Höfe, erwürgte zwei Kinder, die spielend im Grase saßen, und von Schrecken gejagt flohen alle Bewohner des Schlosses, ihr Leben zu retten. Pippin aber faßte sein Schwert, schritt dem Löwen entgegen und stach ihm das Eisen ins Herz. Damals war er zwanzig Jahre alt. Nun trug er die Krone. Es war um Pfingsten. König Pippin hielt einen Hoftag auf seinem Schloß in Bayern. Dahin war auch eine Botschaft des Königs von Kärlingen gekommen, der Pippin die Hand seiner Tochter Bertha anbot. Seine Vasallen drängten ihn, die weitberühmte Jungfrau zu ehelichen. "Hold ist ihr Angesicht, golden ihr Haar, alle Tugenden zieren sie" – rühmte laut ein fahrender Spielmann: – "nur ein Fehler haftet an ihr: der rechte Fuß ist größer als der linke. Das aber kommt von ihrem 160 Fleiße: denn kunstvoll weiß sie zu spinnen und zu wirken."" Felix Dahn (1834-1912) war ein deutscher Professor für Rechtswissenschaften, Schriftsteller und Historiker. Dahns Popularität gründete vor allem auf einem historischen Roman. Mit einem insgesamt ca. 30.000 Druckseiten umfassenden Œuvre zählt Felix Dahn zu den produktivsten Autoren seiner Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kaiser Karl und seine Paladine
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch: Karl der Große in der Geschichte
Vorbemerkung
(Von Felix Dahn)
Die germanische Heldensage hat schon acht und mehr Jahrhunderte vor Karl dem Großen begonnen. Nicht nur halbgöttliche, der Göttersage angehörige, auch geschichtliche Helden und Könige hat sie gefeiert seit grauester Vorzeit. Als Tacitus um das Jahr 100 nach Christi Geburt sein Büchlein über Land und Volk der Germanen schrieb, da sang und sagte man noch in den Wäldern der Cherusker von Armin, den der Römer selbst: »zweifellos Germaniens Befreier« nennt: wohl waren es damals schon achtzig Jahre, seit diesen Befreier von dem Römerjoch der Neid der eignen Gesippen ermordet hatte: doch unvergessen lebte sein Bild, sein Name in dem Herzen seines Volkes. Gewiß war aber Armin nicht der erste, den das Heldenlied besang. – Und ebenso gewiß ward auch in den folgenden Jahrhunderten gar mancher tapfre Führer, gar mancher weise König gepriesen in den Hallen der Fürsten, bei dem Opferfeuer im heiligen Hain. Der Freiheitskampf der Batăver um das Jahr 70, der große Markomannenkrieg um 170, die Züge der Goten zu Land und zu Meer von der Donau bis in das Herz von Asien seit Anfang des dritten Jahrhunderts, die von der gleichen Zeit an viele Menschenalter hindurch wiederholten Versuche der Alamannen am Oberrhein, der Burgunden am Mittelrhein, der Franken am Niederrhein, die römische Grenzwehr, den limes , zu durchbrechen, die Fahrten und Ritte der Friesen und der Sachsen zu Wasser und zu Land in das römische Gallien hinein, aber auch die Kämpfe germanischer Völker untereinander: der Langobarden und der Gepiden, der Langobarden und der Héruler, der Vandalen und der Ostgoten, endlich die Kriege dieser Germanen mit Slaven, Finnen, Avaren, Hunnen vom 3.–6. Jahrhundert sind nicht verlaufen, ohne die tödliche Bedrängnis, die Freuden des Sieges, in Heldenlied und Heldensage auszudrücken. Das sind nicht bloße Vermutungen: es steht solche Heldensage zweifellos fest. Zwar die Dichtungen selbst sind fast spurlos verloren, aber die Angaben geschichtlicher Quellen bezeugen eine Wandersage, Königssage, Heldensage beinah all der genannten Völker wie auch der Nordgermanen in Skandinavien, der Angelsachsen in England. Der machtvolle Ostgotenkönig Ermanrich c. 350, die Vorfahren Theoderichs des Großen, die Amalungen, und er selbst, Herr Dieterich von Bern, der Burgundenkönig Gunthachar, der 438 mit seinem Heer von hunnischen Scharen bei Worms vernichtet ward, die Gottesgeißel Etzel, der Langobardenkönig Alboin, aber auch die Ahnen der fränkischen Merowinge, – all diese sind in Sagen gefeiert worden, welche sich zum Teil, wie die gotische (Dietrich), burgundische (Gunther), fränkische (Siegfried), hunnische (Etzel), bayerische (Rüdiger) mannigfaltig durchdringen und verwirren.
Neben diesen allbekannten Gestalten hat aber die Sage, wie wir vielen Andeutungen mit Bestimmtheit entnehmen können, noch eine gar reiche Zahl von andern geschichtlichen Männern und Frauen, dann die Bilder von Wanderungen, von großen Völkergeschicken jeder Art, mit ihrem dunkelgrünen Efeugerank, schmückend zugleich und verhüllend, umwoben. Fast alles ist verloren: – ließ doch Ludwig der Fromme die von seinem großen Vater – der, selbst ein Held, an Heldentum sich freute, – gesammelten Sagen von den alten Königen und Helden wegen des heidnischen Ruches ins Feuer werfen! Das Wenige, was gerettet, läßt uns in seiner stolzen Herrlichkeit das Viele, was verloren, auf das Schmerzlichste beklagen.
Es war also nichts Neues, nur Fortsetzung uralten Waltens und Webens, ja die Befriedigung eines nicht zu erstickenden Triebes in der Seele des Volkes, in seiner Einbildungskraft, seinem Gemüt, seiner Dankbarkeit, seiner Bewunderung und Liebe, oder auch seines Hasses und Entsetzens, seiner Furcht, endlich auch seines köstlichen Humors und seiner dichterischen Lust am Fabulieren, wenn auch Karl der Große und zwar sehr bald nach seinem Tode schon zum Gegenstand der Heldensage ward.
Wahrlich, dieser Mann von überwältigender Größe, von Größe auf so verschiedenen Gebieten, von alles überstrahlenden Erfolgen und – nicht am leichtesten wiegend! – auch rein menschlich so reich an herzgewinnenden Zügen, dieser als Siegesheld und Friedenskönig, als Vater seiner Völker, als Rechtsbeschirmer und Retter zumal der von den Vornehmen verunrechteten geringen Leute, der freien, aber vielgedrückten Bauern: – dieser Mann mußte der Mittelpunkt eines weiten, farbenbunten Sagenkreises werden, wie kaum ein andrer, wie auch Dietrich von Bern und der keltische König Artus mit seiner Tafelrunde nicht.
Ein kleiner Ausschnitt aus jenem großen Sagenkreise wird in diesem Buche dargestellt.
Meine Einleitung will dem Reiz der Sage durch Erzählung des Inhalts nicht vorgreifen, will auch nicht eine wissenschaftliche Auflösung der Karlssagen in ihre verschiedenen Bestandteile versuchen: nur das geschichtliche Bild des Mannes will ich hier voranstellen, ohne jede gelehrte Zurüstung. Ich meine, es muß die jungen Leser – und vielleicht auch ein paar alte – anziehen, zuerst in aller Kürze zu erfahren, was und wie und wer dieser Karl wirklich war und dann zu sehen, wie diese Gestalt sich in der Sage gespiegelt hat. Dabei würde eine lehrhafte und zopfige Hinweisung in jedem Einzelnen auf die entsprechende Gestaltung in der Sage, ein steter Vergleich von Geschichte und Sage, nur stören: der sinnige Leser wird in der Sage mit Wohlgefallen selbst herausfühlen, wie diese sich nach ihren Bedürfnissen die Geschichte zurechtgeschnitten und übermalt hat. Im ganzen und großen aber ist die Sage wahrhaftig: sie drückt, wenn auch in ihrer phantastischen Sprache, treffend die Eigenart des Mannes und seiner Taten aus.
Sie hat das unerschütterliche Gottvertrauen, die tiefe, tatbereite, unermüdlich im Dienste Gottes und der Kirche eifernde Frömmigkeit, die unablässige Bekämpfung der Heiden in Ost und West, in Nord und Süd, das Feldherrngenie, die Heldentapferkeit, die geistige Überlegenheit des Königs über alle Großen seines Palastes, »die Paladine« (richtiger: Palatine), trefflich zur Anschauung gebracht; aber auch seine Weisheit und Herzensgüte im Frieden, zumal die stete Sorge für strengste Rechtspflege, ohne Ansehen der Person, zum Schutz der armen kleinen Unterdrückten, welche gegen den Druck der Großen nur Gott und Herrn Karl zum Helfer haben. Gewisse Schwächen seines Wesens: Jähzorn und andres, – dann das lockere Leben an seinem Hof und die Kleinheit seines Sohnes und Nachfolgers Ludwig, – Karl und Pippin, die beiden sehr tüchtigen Söhne, starben vor dem Vater, – im Vergleich mit dem großen Vater sind auch nicht vergessen, vielmehr mit Humor, aber doch stets mit liebevoller Schonung des gefeierten Helden angedeutet.
Viel willkürlicher als die echte Volkssage springt freilich die Kunstpoesie mit ihren Gegenständen um: und diese hat ja auch Karl, sein Haus und seine Helden in außerordentlich zahlreichen Dichtungen von Deutschen, Franzosen, Italienern, Spaniern, Engländern, Nordgermanen behandelt. Die Ausscheidung der beiden Bestandteile ist Aufgabe mühereichster Untersuchungen, die nicht hierher gehören, ebensowenig die Sonderung der deutschen von den romanischen Gestaltungen der Sage wie der Kunstdichtung über Karl. Es genügt die Bemerkung, daß im ganzen die Volkssage von Karl bei den Deutschen, die Kunstdichtung über Karl bei den Romanen überwiegt: deutsche Dichter haben oft das von romanischen Gestaltete übertragen, umgearbeitet, aber eben doch im wesentlichen entlehnt. Mit jenem Unterschied hängt es auf das innigste zusammen, daß die romanische Kunstdichtung vor allem das Phantastische, Buntglänzende, auch räumlich in das Ungemessene Trachtende – Jerusalem, Byzanz, Rom, Spanien –, das Romantische, Ritterliche an diesen Stoffen behandelt, während die deutsche Überlieferung das Gemütvolle, Herzergreifende, dann den strengen Schutz des Rechts, die Schirmung der Unterdrückten hervorhebt: der Grundgedanke von »Karls Recht« lebt noch heute in dem Haberfeldtreiben der Bauern meiner lieben oberbayerischen Heimat. Und lebte noch vor kurzem in der Heimat meiner lieben Frau, in Westfalen, wo bis vor wenigen Jahrzehnten noch die Freischöffen der Feme auf der roten Erde zum Ding zusammentraten nach Kaiser Karls Recht und Bann. Die herrliche Schilderung dieser uralten Volkssitte, in welcher auch des Kaisers Schwert noch erglänzt, in Immermanns Münchhausen ist ja bekannt. So lebte und lebt Kaiser Karl noch ein Jahrtausend nach seinem Tod im Dank des deutschen Volkes fort.
Erstes Kapitel
Karls Abstammung. Die Vorgeschichte seines Hauses. Die bei seiner Thronbesteigung vorgefundenen Verhältnisse.
Karl ist geboren (höchst wahrscheinlich) am 2. April 742. Der Ort seiner Geburt ist nicht zu bestimmen: vielmehr hat die Sage gleich seinen Eintritt in das Leben mit mannigfaltigem Schlinggewächs umrankt (s. unten: »Bertha mit dem Gänsefuß«). Sein Vater war Pippin, bis November 751 Hausmeier (major domus), seit November 751 (bis 768) König der Franken, seine Mutter Bertha (oder Bertrada) war eine Tochter des Grafen Charibert von Laon.
Die Ahnen Karls lassen sich zurückverfolgen bis auf den ältesten, ersten Pippin, den man aber ohne jeden Grund Pippin »von Landen«, wie ebenso willkürlich einen andern, den mittleren Pippin »von Heristall« genannt hat: erst spät entstandene Fabeln bringen das Haus mit diesen Namen in Verbindung.
Das Geschlecht der alten merowingischen Könige der Franken war im Laufe des siebenten Jahrhunderts ganz verrottet, vermorscht und verfault: nicht mehr die Könige vermochten das Schwert zu führen und das Scepter zu schwingen: das taten an ihrer Statt schon lange die einflußreichsten Beamten am königlichen Hof, die Hausmeier, majores domus. Um das Jahr 622 nun war der Hausmeier des östlichen (daher Austrasien, d. i. Ostland) Teilreichs der Franken der älteste Pippin (gest. 639), ein in Krieg und Frieden hervorragender Mann. Er vermählte (ungefähr 630) seine Tochter mit Ansigisel oder Adalgisel, dem Sohne seines Freundes, des durch Weisheit und Frömmigkeit ausgezeichneten Bischofs Arnulf von Metz (gest. 641. Bischöfe durften damals noch heiraten oder doch verheiratete Männer Bischöfe werden). Man müßte also dieses Geschlecht das der »Arnulfinge« nennen: denn schon die Vorfahren Karl Martells und Karls des Großen nach diesen beiden Karlen als »Karolinger« bezeichnen, ist gerade so verkehrt, wie wenn man die Vorfahren unsers Kaisers Wilhelm die »Wilhelminger« nennen wollte. Einige Zeit trat das Haus der Arnulfinge wieder völlig in den Hintergrund: Grimoald, Pippins Sohn, hatte den Versuch gemacht, den merowingischen Königsknaben auf dem Thron durch seinen eignen Sohn zu ersetzen, aber der Anschlag scheiterte und endete mit Grimoalds Hinrichtung (656). Erst etwa zwanzig Jahre später, ungefähr 678, erhebt sich das Geschlecht aufs neue: Pippin der Mittlere, der Sohn von Ansigisel und von Pippins des Ältern Tochter, gewann in den alten Stammlanden seines Hauses, zwischen Rhein, Mosel und Maas, eine mächtige Stellung. In den wilden innern Kämpfen, in welchen manchmal die Hausmeier der drei fränkischen Teilreiche: Austrasien, Neustrien (Neu-Westland) und Burgund gegeneinander um die Herrschaft rangen, suchte Pippin, obwohl noch nicht Hausmeier in Austrasien, den Übergriffen der neustrischen Hausmeier zu wehren. Seine erste Schlacht (bei Laon 678) verlor er zwar – ganz ähnlich wie später sein Sohn Karl der Hammer – aber die zweite bei Tertri, nahe St. Quentin (687), gewann er und im Jahre 688 ward er als alleiniger Hausmeier der drei fränkischen Teilreiche, also des ganzen Frankenstaates, anerkannt. Sogleich trachtete er die Friesen (689) und die Alamannen (709–712) in Elsaß, Schweiz, Schwaben, welche sich während der Zerrüttungen im Frankenreich von dessen Verband gelöst hatten, wieder zum Gehorsam heranzuzwingen. Aber bei seinem Tod (714) drohten die alten Gefahren von allen Seiten über dem Frankenreich wieder zusammenzuschlagen und erst nach schweren Kämpfen gelang es seinem Sohne Karl, der vielen Feinde Herr zu werden. Seine Stiefmutter Plektrud hatte, um einem Enkel die Folge in die Machtstellung Pippins zu sichern, gleich bei dessen Tode Karl in den Kerker werfen lassen. Nun erhoben die Neustro-Burgunder wieder einen eignen Hausmeier, verbündeten sich mit den heidnischen Friesen, schlugen der Regentin Plektrudis Heer im Walde von Cuise und zogen gegen Köln, wo sie mit den Friesen zusammentreffen und Plektrudis belagern wollten. Karl war inzwischen aus dem Kerker entsprungen; er raffte ein Häuflein von treuen Anhängern zusammen und wollte die Friesen aus dem Lande treiben, bevor die Neustrier zu ihnen gestoßen, ward aber von dem Friesenherzog Ratbod bei Köln geschlagen (716). Jedoch der Unverzagte war ebenso zäh als kühn: ein echtes Kennmal seines Geschlechts. Sofort sammelte er neue Scharen um sich, überfiel die Neustrier auf ihrem Rückweg von Köln, wo sie Plektrudis zur Anerkennung eines neustrischen Merowingerkönigs gezwungen hatten, bei Amblève und schlug sie aufs Haupt (716). Aber erst nach zwei weiteren Siegen über die Neustro-Burgunder bei Vincy (717) und bei Soissons (719) und nachdem er seine Stiefmutter zur Übergabe von Köln genötigt (717), gelang es ihm, wie sein Vater als alleiniger Hausmeier das ganze Frankenreich zu beherrschen Er wehrte nun den Übergriffen der Sachsen (718), brachte Westfriesland zum Reich (719) und die abgefallenen Herzöge der Alamannen (730) und der Bayern (725–728) zum Gehorsam zurück. Einstweilen aber, während der unermüdliche Karl auf dem rechten Rheinufer im Nordosten des Reichs beschäftigt war, drohte vom Südwesten her eine furchtbare Gefahr nicht nur der christlichen Kirche und dem Staate der Franken, nein, aller germanischen Eigenart und aller Bildung, welche von Griechen und Römern auf die Romanen in Frankreich und Italien überkommen war. Im Jahre 711 hatte der Islam, hatten die Araber das Reich der Westgoten in Spanien zerstört: gar bald fluteten ihre ungezählten Scharen über die Pyrenäen nach Südfrankreich: im Jahre 721 von dem Herzog Eudo von Aquitanien bei Toulouse abgewehrt, kamen sie doch gar bald wieder und drangen 725 bis tief in das Herz Frankreichs und Burgunds. Im Jahre 732 stieg der arabische Statthalter in Spanien, Abderrachmán, ein gewaltiger Kriegsheld, mit ungeheuren Heeresmassen über die Pyrenäen, schlug Herzog Eudo an der Dronne auf das Haupt und zog nach Nordosten weiter auf der alten Römerstraße, die von Bordeaux über Poitiers und Tours nach Orleans, Paris und Metz führte: er bedrohte so alle Hauptstädte des Reichs und die Kirchen des heiligen Hilarius zu Poitiers und des heiligen Martinus zu Tours, die gefeiertsten und zugleich schätzereichsten Weihtümer des Frankenreichs, deren Zerstörung und Plünderung Glaubenshaß und Beutegier der Saracenen gleich stark reizen mußte. Der flüchtige Herzog von Aquitanien rief die Hilfe des Einzigen an, der helfen konnte: Karls. Und Karl gewährte sie sofort, obwohl er noch im Vorjahr Eudo wegen Vertragsverletzung hatte bekämpfen müssen. Allein nun stand nicht weniger auf dem Spiel als alles: es fragte sich, ob Europa künftig dem Christentum oder dem Islam, den Germanen und Romanen oder den Semiten Afrikas gehören solle. Karl muß schon vorher Rüstungen betrieben haben: sonst hätte er nicht auch die »Nordvölker«, d. h. die späteren Deutschen, den Saracenen so rasch entgegenwerfen können, daß diese auf ihrem Vordringen Tours noch nicht erreicht hatten; Karl verlegte ihnen die Römerstraße und den Übergang über die Flüsse Vienne und Clain bei Cenon, nordöstlich von Alt-Poitiers, dessen Hilariuskirche von ihnen bereits verbrannt war. Hier nahm der kluge Feldherr eine feste Verteidigungsstellung, in welcher er nicht umgangen werden konnte und den Angriff der furchtbaren arabischen Übermacht abzuwehren beschloß. Die Schlacht bei Cenon (oder Poitiers) (an einem Oktobersonnabend, 4., 11., 18. oder 25. 732), an weltgeschichtlicher Bedeutung den Tagen von Marathon und von Salamis, von Zama und Châlons an der Marne, von Leipzig, Waterloo und Sedan gleichstehend, ward nach dem Zeugnis eines Zeitgenossen, aber nicht etwa eines Deutschen, nein, eines spanischen Bischofs, Isidor von Beja, entschieden durch das Heldentum der Deutschen in Karls Heer: »Diese Nordvölker«, sagt er, »hochgewachsen, von überwältigender Wucht der Glieder, standen eng aneinandergeschlossen, Schild an Schild, wie eine Mauer von Eis, unbeweglich, uuerschütterlich, weder umzurennen noch zu zersprengen durch den wütenden, immer wiederholten Anprall der ungeheuren Reitermassen: mit eiserner Faust, hoch von oben herab und so recht von ganzem Herzen führten sie ihre Streiche.« Da standen und stritten sie nebeneinander: der kühne Franke, der schnelle Thüring, der zähe Sachse, der trotzige Friese, der feurige Alamanne, der kampfgrimme Bayer: gar mancher, der noch im Herzen Wotan und Donar trug, schwang hier den Eschenschaft, der an der Weser oder Isar gewachsen war, wider Mohammed. Von einem solchen deutschen Streich fiel auch der tapfere Abderrachmán, da er, selbst mitkämpfend, hier den stärksten Widerstand bezwingen wollte. Entmutigt durch den Fall ihres gefeierten Führers, durch die blutigen Verluste und den Eindruck germanischen Heldentums räumten die Saracenen in der folgenden Nacht heimlich ihr Lager und flohen in zerstreuten Haufen gen Südwesten nach Hause. Wahrscheinlich sind Heldenlieder, von den Germanen im Heer zuerst auf Karl und diese Schlacht gedichtet, in vulgärlateinischer (romanischer) Übersetzung zu der Kenntnis jenes Bischofs im fernen Spanien gedrungen: einzelne Wendungen in seinem Bericht klingen ganz liedhaft. Und ohne Zweifel hat die spätere Heldensage, welche auch sonst die beiden Karle, den »Hammer« und den »Großen«, häufig miteinander verwechselt, Züge aus des Großvaters Saracenen-Kämpfen und Siegen auf den Enkel übertragen, welcher in Person nur einmal (778) mit denselben gestritten hat. Ebenso hat vermutlich die Sage jene Verfolgungen durch seine Stiefmutter und die harten, mannigfaltigen Kämpfe mit einem Stiefneffen, sowie mit andern Feinden, welche Karl Martell in seinen Anfängen zu bestehen hatte – auch später mußte er noch zwei Stiefneffen und einen entfernteren Verwandten wegen Hochverrats verhaften – übertragen auf den großen Karl, von welchem die Geschichte nichts Derartiges zu erzählen hat, abgesehen von der Feindschaft mit seinem Bruder Karlmann, welcher allerdings nur dessen Tod den Ausbruch in offenen Krieg ersparte. Auch der Umstand, daß Karl Martells Mutter Albheid mit Pippin in einer von der Kirche nicht anerkannten Ehe gelebt hat, ist vielleicht in Verwechslung mit Karl dem Großen Anlaß zu den Sagen über dessen Mutter Bertha geworden, zumal es nicht gerade ganz unmöglich wäre – doch ist es sehr zweifelig –, daß erst nachdem Karl (742 oder nach andern 747) geboren war, die Verbindung seines Vaters mit Bertha (749) kirchlich eingesegnet worden, wie ja die Sage berichtet.
In den nächsten Jahren unterwarf Karl Friesland (733, 734) und (736) die Söhne des (735) verstorbenen Eudo, vertrieb die Araber aus dem verräterisch ihnen übergebenen Avignon, schlug sie nochmal in einer großen Schlacht am Flusse Berre südlich von Narbonne und warf die Fliehenden auf der Verfolgung in die Salzsümpfe und die See, daß ihrer viele Tausende ertranken. Als er 739, durch einen Feldzug gegen die Sachsen fern im Nordosten festgehalten, erfuhr, daß abermals die Saracenen in Südfrankreich eingebrochen waren, forderte er seinen Freund Liutprand, den tapfern und weisen König der Langobarden zu Pavia, auf, die gemeinsamen Feinde zu vertreiben: plünderten die Araber doch auch bereits auf langobardischem Gebiet. Sofort zog Liutprand mit seinem Heerbann zu Hilfe: seine Annäherung genügte, die Räuber zu verscheuchen. Die Freundschaft der beiden Könige war dadurch besiegelt worden, daß Liutprand Karls jungem Sohne Pippin in feierlicher symbolischer Handlung in der langobardischen Königsburg zu Pavia den ersten Bartflaum abgeschnitten hatte, wodurch ein der Wahlkindschaft ähnliches Treuepflichtverhältnis begründet ward. Daher wäre es Undank und Treuebruch gewesen, hätte Karl dem unmittelbar nach jener Waffenhilfe von 739 an ihn von Papst Gregor III. gerichteten Ansinnen Willfährde geleistet, für ihn das Schwert zu ziehen gegen Liutprand, der Rom belagerte, weil der Papst sich mit dem eidbrüchigen und rebellischen Herzog von Spoleto verbündet und demselben Zuflucht gewährt hatte. Karl lehnte ab, obwohl ihm der Papst die Schlüssel der Peterskirche übersandte und sich bereit erklärte, von seinem Staatsoberhaupte, dem Kaiser zu Byzanz abzufallen und Karl zum »Konsul« oder »Patrizius« von Rom zu machen, wozu der Papst freilich keinerlei Recht besaß: denn er war zweifellos Untertan des Kaisers, Rom eine byzantinische Stadt, der »Patrizius der Römer« ein von dem Kaiser zu ernennender Beamter, der die Rechte des Kaisers als dessen Vertreter dem Senat, Volk und gerade auch dem Bischof von Rom gegenüber wahrzunehmen hatte. Auch mußte das der Papst selbst anerkennen: Gregor III. selbst und seine Nachfolger bis gegen Ende des Jahrhunderts rechneten in ihren Urkunden nach Regierungsjahren der Kaiser; im Jahre 754 noch weigerte sich ein Papst durchaus nicht, einen Befehl des Kaisers zu erfüllen und von dem Langobardenkönig die Rückgabe eroberter Gebiete an den Kaiser zu verlangen.
Um diese italischen Dinge, an welche König Pippin und Karl der Große so vielfach rühren mußten, richtig zu würdigen, müssen wir auf die damals auf der Apenninischen Halbinsel miteinander ringenden Mächte und ihre Parteistellungen einen raschen Blick werfen.
Seitdem das germanische Volk der Langobarden (568) aus Ungarn in den Nordosten Italiens eingewandert war, hatte es allmählich den Byzantinern, die, nach Vernichtung der Ostgoten (555), hier herrschten, den größten Teil des Landes entrissen. Nur die durch Gewaltangriff nicht zu brechende See-Feste Ravenna, der Sitz des kaiserlichen Statthalters oder Exarchen, und der dazu gehörige Exarchat, ferner die Südspitze der Halbinsel: Apulien, Kalabrien, das Gebiet von Neapel, endlich Rom und der »ducatus Romanus« waren den Kaiserlichen geblieben. Ravenna und auch Rom, letzteres geschützt durch seine starken, von Kaiser Aurelian angelegten, von Belisar verstärkten Mauern, waren nur durch Aushungerung zu bezwingen. Allein die Langobarden begingen den schwer begreiflichen Unterlassungsfehler, in den zwei Jahrhunderten des Bestandes ihres Reiches keine Kriegsflotte zu schaffen, welche den Hafen von Ravenna und die Tibermündung hätte sperren mögen. Gleichwohl würden ihre Könige, welche selbstverständlich trachten mußten, Rom in ihre Gewalt zu bringen, die Unterbrechung der langobardischen Besitzungen durch den »ducatus Romanus« zu beseitigen, jene Stadt doch wohl erobert haben, hätte nicht eine Reihe von hervorragenden Männern auf dem römischen Stuhl – vor allen Gregor der Große – den Widerstand der Römer durch geistliche und geistige Mittel meisterhaft geleitet. Von dem Exarchen in Ravenna war nur seltene, unzureichende Waffenhilfe zu hoffen. Erleichtert ward dem Papst die Leitung des Widerstandes freilich durch die fromme Ehrfurcht, mit welcher auch die ihn mit Krieg bedrängenden Könige zu ihm emporsahen, seitdem die Langobarden aus dem ketzerischen Arianismus zum katholischen Bekenntnis übergetreten waren.
Durch diese erfolgreiche Verteidigung hatten die römischen Bischöfe in der Stadt ihre schon früher höchst angesehene, machtvolle Stellung dermaßen erhöht, daß ihnen vielmehr die Regierung zukam als dem kaiserlichen dux oder patricius Romanus, der nie über ausreichende byzantinische Krieger verfügte. So hatte der Papst wenigstens die leisen Anfänge einer weltlichen Herrschaft in der Stadt Rom gewonnen, selbstverständlich in Unterordnung unter den Kaiser. Aber der Kaiser war fern und unfähig, zu helfen: kein Wunder, daß die Römer mehr und mehr den Papst als ihren Schützer und Leiter ansahen. Dazu kam, daß in den zahlreichen über ganz Italien verstreuten Landgütern (pastrimonia) der römischen Kirche, oder »Sankt Peters«, wie man sagte, der Papst über Unfreie, Halbfreie, Freigelassene, Hintersassen mannigfaltiger Rechtsformen ohnehin eine Gewalt hatte, welche zwar privatrechtlichen Ursprungs war, aber ihn doch Gerichtsverwaltungs- und Finanzrechte üben ließ. Diese Anfänge des »Kirchenstaats« zu einer wirklichen weltlichen Herrschaft auszubilden war fortab das eifrige Streben der Päpste: und man muß anerkennen, daß in jenen Zeiten eine gewisse weltliche Unabhängigkeit auch für die geistlichen Zwecke der Päpste höchst wünschenswert war.
Die langobardischen Könige zu Pavia nun aber verfügten keineswegs über die ganze Kraft ihres Volks: die mächtigen Grenzherzöge von Trient im Norden, Friaul im Nordosten, Spoleto in der Mitte und zumal Benevent im Süden waren tatsächlich fast unabhängig von Pavia – hat doch das Herzogtum Benevent, wie wir sehen werden, die Übertragung der langobardischen Königskrone auf Karl noch um viele Jahre als selbständiges Fürstentum überdauert – und gar oft in offenem Kriege mit ihrem König, wobei sie von dem Exarchen zu Ravenna und dem Papst oder dem Dux zu Rom meist unterstützt wurden.
Während aber bisher die Parteigruppierung in der Regel den Langobardenkönig auf der einen, den Exarchen, den Papst und die Herzöge auf der andern Seite gezeigt hatte, war seit etwa zwanzig Jahren eine Verschiebung eingetreten. In dem Streit über das Maß der den Bildern der Heiligen zuzuwendenden Verehrung hatten die Päpste mit Recht dem »bilderstürmenden Kaiser« Leo dem Isaurier (717–741) Widerstand geleistet und dabei die begeisterte Zustimmung der Bevölkerung Italiens gefunden. Es kam über diese Frage zum offenen Bruch zwischen Rom und Byzanz, ja gelegentlich zu blutigen Gefechten zwischen den Truppen des Kaisers und der italienischen Bevölkerung auf Seite des Papstes, wobei dann auch wohl der Langobardenkönig, etwa im Bunde mit dem Exarchen gegen den Papst und die Herzöge, das Schwert zog.
Dies war die verworrene, schwankende Lage der Dinge in Italien, in welche einzugreifen Karl der Hammer sich klug enthielt: hatte er doch viel dringendere Aufgaben im eignen Reiche noch zu erfüllen. Er erwiderte also reichlich die Geschenke des Papstes, lehnte aber die geforderte Waffenhilfe ab, zumal ihm Liutprand die Augen darüber öffnete, wie der Papst sich die Kriegsbedrängnisse lediglich selbst zugezogen habe.
Karl hat übrigens seinen Beinamen der »Hammer« (lateinisch »tundites«, »tudites«, »Martellus«) nicht von seinen Siegen über die Saracenen erhalten, sondern weil er überall die zahlreichen kleinen Gewaltherren (»tyranni«) zerschmetterte, welche sich im Frankenreich während der Wirren von 711–719 erhoben hatten, geistliche und weltliche Große, die der Staatsgewalt trotzten und die kleinen Gemeinfreien unterdrückten, zur Knechtschaft oder Schutzhörigkeit herabzwangen.
Bevor er zu sterben kam, teilte er unter Zustimmung des Reichstags unter seine beiden Söhne Karlmann und Pippin, ganz wie weiland die Merowingischen Könige das Königtum, den Majordomat: die letzten vier Jahre (nach dem Tode Theuderich IV., 737) hatte er gar ohne König geherrscht, ohne doch schon den Schritt auf den Thron zu wagen. Vielleicht fand er damals keinen geeigneten Merowingen, oder vielleicht wollte er dadurch den Franken recht augenfällig zeigen, wie so ganz nichtig und schattenhaft das Königtum geworden war. Karlmann erhielt als Erbe den Majordomat über Ostfranken, Alamannien, Thüringen, Pippin über Neustrien, Burgund, Provence: Aquitanien und Bayern blieben ungeteilt, weil sie, von eignen Herzögen beherrscht, nicht unmittelbar, nur mittelbar unter dem Reiche standen. Nach des Vaters Tod (21. Okt. 741) hatten die beiden Brüder, welche rühmlichste Eintracht hielten, Aquitanier, Alamannen, Bayern, mit den Waffen zur Anerkennung ihrer Herrschaft zu zwingen, Sachsen abzuwehren (741–746). Zugleich unterstützten sie das großartige Wirken des heiligen Bonifatius (des Angelsachsen Wynfrith), der als Legat des Papstes die tief gesunkene Kirchenzucht im Frankenreiche hob, den heidnischen Friesen, Hessen, Thüringen das Kreuz predigte und die Anfänge einer germanischen Kirche, unter strenger Unterordnung unter Rom gründete. (Die Bistümer Wirzburg, Eichstädt, Buraburg bei Fritzlar 741, Stiftung des Klosters Fulda 744.)
Im Jahre 747 legte Karlmann die Herrschaft nieder und trat als Mönch in das Kloster Monte Casino in Italien: solche Weltentsagung mächtiger Fürsten war damals nicht selten. Vielleicht belastete Karlmanns Gewissen eine tückische, blutige Tat, bei Bestrafung empörter Alamannen im Vorjahr (746) verübt. Pippin, nun Alleinherrscher, dämpfte neue Unruhen in Bayern, indem er Tassilo, den sechsjährigen Sohn (er war im gleichen Jahre mit Karl dem Großen [742] geboren) des eben verstorbenen Herzogs, aus dem Geschlecht der Agilolfingen, zum Herzog einsetzte, aber als Vasallen des Frankenreichs (748). Bald darauf (November 751) ward Pippin durch Beschluß des fränkischen Reichstags zu Soissons und unter Gutheißung des Papstes Zacharias zum König des Frankenreichs erhoben: der letzte Morowing, Childerich III., den die Brüder, wohl um den Vorwurf zu entkräften, sie übten als Königsbeamte ohne König eine widerrechtliche und widersinnige Gewalt, 743 auf den Thron erhoben hatten, ward als Mönch in ein Kloster gesteckt. Ohne Zweifel war die Tat eine Verletzung des formalen Rechts, allein sie war eine vollbegründete geschichtliche Notwendigkeit. Man hatte dem Papst Zacharias die Frage vorgelegt, was Gott wohlgefälliger sei, daß der eine die Last, der andre die Ehre der Herrschaft trage und er hatte geantwortet, es sei besser, daß, wer die Bürde, auch die Würde des Königtums besitze. Bonifatius, seit 748 Erzbischof von Mainz, salbte den neuen König, nachdem derselbe von den Großen war gekrönt worden. Ein juristisches Recht hatte der Papst freilich nicht hierzu, aber seine Gutheißung war sittlich und religiös von höchstem Wert: den Zeitgenossen bedeutete sie die Zustimmung des Himmels. Sehr bald darauf ward der neue König aufgefordert, dem römischen Stuhl einen wichtigen Gegendienst zu leisten. Stephan II., der Nachfolger des Zacharias, ward von dem Langobardenkönig Aistulf schwer bedrängt. Er unternahm, Pippins Hilfe mündlich anzurufen, in winterlicher Zeit die gefährliche und beschwerliche Reise über die Alpen: über den großen Bernhard gelangte er nach St. Maurice. Von dort geleiteten ihn königliche Gesandte nach Ponthion (bei Bar-le-duc) zu Pippin, der ihm seinen elfjährigen Sohn entgegenschickte und ihn selbst in der ehrenvollsten Weise einholte: dreitausend Schritt ritt er mit seiner Gemahlin, mit dem jüngern Knäblein Karlmann und vielen Großen den Gästen entgegen, sprang vom Roß, wie er seiner ansichtig ward, kniete nieder und führte das Maultier des Papstes eine lange Strecke wie »ein Stallmeister« am Zügel. Pippin versprach dann zu Ponthion und nochmal feierlich zu Kiersy urkundlich, »Sankt Peter« (dem römischen Bischofsstuhl) zu allen seinen Rechten zu verhelfen und ihm die von Aistulf eroberten römischen und byzantinischen Städte und Gebiete, nachdem sie den Langobarden entrissen, zu schenken. Dieses Schenkungsversprechen ward die Grundlage der weltlichen Herrschaft des Papstes, des sogenannten »Kirchenstaates«. Als Gegenleistung salbte nun der Papst, zu Saint Denis, die Handlung des Bonifatius wiederholend, Pippin und Bertha als König und Königin, dann den König und seine beiden Söhne zu »Patriziern der Römer«. Darauf ward Aistulf (754) angegriffen, zum Nachgeben genötigt und, da er die in dem Frieden von 754 übernommenen Verpflichtungen gegen den Papst nicht erfüllte, durch einen zweiten Feldzug (756) gezwungen, Sankt Peter all' sein Recht zukommen zu lassen.
Es ist fast befremdend, daß Pippin zweimal die kurze Reise von Pavia nach Rom nicht unternahm, während fromme Pilger aus dem fernsten England oder Spanien damals gar oft an das Grab der Apostelfürsten wallfahrteten: allein Pippin, eine maßvolle, nüchterne Natur, wollte nicht tiefer in die italischen Dinge sich verwickeln lassen als seine Versprechungen erheischten. Solche Verwicklungen hätten zum Kampfe mit Byzanz, zur Vernichtung des Langobardenreichs führen müssen. Pippin ging dem aus dem Weg: er beschäftigte sich die letzten Jahre seines Lebens fast ausschließend mit einer dem Frankenkönig viel näher anliegenden Aufgabe: der Wiederunterwerfung von Aquitanien und Vaskonien, d. h. der schönen, reichen Lande von dem Westufer der Loire bis an die Pyrenäen, Gebiete, welche großenteils schon Chlodovech c. 507 erworben, aber die Schwäche der Merowingen im 7. Jahrhundert wieder eingebüßt hatte. Der langjährige Kampf ward deshalb ein so schwieriger, weil die durchaus romanische Bevölkerung hier gegen die germanisch-fränkische Herrschaft sich sträubte. So war es ein echter Volkskrieg, den Herzog Waifar gegen die Franken führte. Erst mit dem Untergang dieses Volksführers in dem achten dieser Feldzüge (768) erlosch der Widerstand. Wie einen Hirsch hatten die Franken den Herzog, den zuletzt nur wenige Getreue noch begleiteten, gehetzt »im Wald von Edobol«. Gar mancher Zug aus diesen Kämpfen Pippins in Aquitanien ist von der Sage auf Karl übertragen worden. Die Wiederheranziehung dieser Lande war aber die wesentliche Voraussetzung, daß aus Kelten, Römern, Basken, Goten, Burgunden und Franken das so glänzend begabte Mischvolk der »Franzosen« entstehen konnte, welches zwar uns Deutschen ein sehr schlimmer Nachbar ward, dessen hohe Verdienste um die Geistesbildung in ganz Europa wir aber doch nie vergessen wollen.
Auf einem dieser Feldzüge gegen Waifar (763) verließ plötzlich der junge Bayernherzog Tassilo, welcher vor und nach seiner (wiederholten) Huldigung als Vasall (757) die Heerzüge des Königs bisher willig mitgemacht hatte, das Lager und eilte nach Bayern zurück, weiteren Gehorsam weigernd. Wir kennen die Gründe nicht: vielleicht, weil er sich vergeblich bemüht hatte, für Waifar günstigere Bedingungen zu erwirken. Er mochte erkennen, die völlige Einverleibung Aquitaniens als bloße Provinz in das Frankenreich sei beschlossene Sache und er mochte erraten, daß dann alsbald Bayern ein ähnliches Schicksal bevorstehe: Bayern und Aquitanien hatten ja bisher dem Frankenkönig gegenüber eine gleiche staatsrechtliche Stellung eingenommen. Pippin, bis kurz vor seinem Tod mit Aquitanien beschäftigt, kam nicht mehr dazu, Bayern wieder zu unterwerfen. Es war die einzige Aufgabe, welche der wackere, tüchtige König seinen Erben ungelöst überließ, – denn auch Narbonne, das Hauptbollwerk des Islams in Südfrankreich, hatte er 759 den Arabern entrissen, – als er am 24. September 768 zu St. Denis starb, erst 54 Jahre alt. Sein Verdienst darf nicht dadurch geschmälert werden, daß sein Sohn Karl, eine viel großartigere, aber nicht so maßvolle Natur, ihn mit seinem weltgeschichtlichen Ruhm, mit seinem blendenden, fast phantastischen Glanz überstrahlt hat.
Zweites Kapitel
Karls Anfänge bis zur Erwerbung der Langobarden-Krone (768–777).
Wie Karl der Hammer den Majordomat zwischen Pippin und Karlmann, so hatte Pippin vor seinem Tod unter Zustimmung des Reichstags das Königtum über das gesamte Frankenreich zwischen seinen Söhnen Karl (geb. 742) und Karlmann (geb. 751 oder 752) geteilt. Und zwar erhielt Karl der Ältere Austrasien (im engeren Sinn), Ostfranken (aber ohne Elsaß und Alamannien), Neustrien und Westaquitanien, Karlmann Elsaß, Alamannien, Burgund, Provence, Gotien und Ostaquitanien. Bayern, das erst wieder unterworfen werden mußte, blieb unerwähnt.
Während aber Pippin und sein Bruder einträchtig gewaltet hatten, bestand zwischen Karl und Karlmann von Jugend auf bittere Feindschaft: wir kennen die Gründe nicht: böse Ratgeber Karlmanns sollen an diesem geschürt haben. So verweigerte dieser gleich im ersten Jahre (769) die Mitwirkung, als in Aquitanien eine Bewegung wider Karl entstand: eine Zusammenkunft der Brüder besserte daran nichts. Karl warf, allein handelnd, den Aufstand ohne Mühe nieder. Im folgenden Jahr (770) vermittelte zwar die Königin Bertha (Bertrada) ein besseres Einvernehmen unter ihren Söhnen. Aber nicht lange sollte es währen. Auf Andringen der Mutter, welche er in hohen Ehren hielt solange sie lebte, vermählte sich Karl (770) mit der Tochter des Langobardenkönigs Desiderius (ihr Name ist ungewiß: vielleicht Bertrada, schwerlich Desiderata). Aber schon 771 verstieß er sie und sandte sie dem Vater zurück, aus unbekannten Ursachen, doch jedenfalls ohne ihr Verschulden, wahrscheinlich aus politischen Gründen. Gleichzeitig war das Verhältnis zu Karlmann in so bittere Verfeindung zurückgeschlagen, daß man den Ausbruch offenen Kriegs unter den beiden befürchtete, als Karlmann erkrankte und starb (4. Dezember 771). Sofort erschien Karl in dem erledigten Reich und nahm davon Besitz unter Zustimmung von vielen geistlichen und weltlichen Großen dieses Teilreichs: zumal Abt Fulrad von St. Denis, der schon Pippins vertrauter Rat gewesen, wirkte dabei mit. Karlmanns Witwe Gerberga floh mit ihren beiden unmündigen Knaben aus dem Frankenreich nach Pavia zu dem Langobardenkönig Desiderius, jetzt selbstverständlich Karls erbittertstem Feind. Gefahr hatte ihr und den Knaben nicht gedroht: aber Gerberga wollte die Ausschließung ihrer Söhne von dem Throne des Vaters nicht ruhig hinnehmen. Es ist schwer zu sagen, ob diese Ausschließung nach dem damaligen Recht begründet war oder nicht: Karl selbst hat später in einer von ihm verfügten Reichsteilung die Frage so entschieden, daß die Söhne vorverstorbener Brüder keineswegs ohne weiteres ein Folgerecht haben und den Oheim ausschließen sollten, sondern nur dann, wenn das Volk, d. h. die geistlichen und weltlichen Großen, des fraglichen Teilreiches sich für die Erbfolge eines solchen Sohnes aussprechen würden. Dies war nun 771 nicht geschehen, vielmehr hatten einflußreiche Vornehme Karlmanns sich für den Ausschluß der Knaben, für die Thronbesteigung Karls ausgesprochen. Darauf gründete wohl Karl sein Recht: allerdings hatte aber ein förmlicher Reichstag aller Großen von Karlmanns Reich keineswegs jenen Beschluß gefaßt. Und keineswegs alle Vornehmen in dessen Staaten teilten Fulrads Willen: vielmehr begleitete ein sehr angesehener Herzog, Auchar, die flüchtende Witwe und die Waisen – zwei kleine Knaben – seines Herrn in das Langobardenreich, wo er auch stets als Vorkämpfer und Vertreter der Sache der Knaben bei Desiderius und bei dem Papst erscheint: wahrscheinlich hat dieser Auchar, Autchar, den Namen und einzelne andre Züge zu der Gestalt des sagenhaften Ogier hergegeben, der dann freilich ein Däne sein soll. Auch die Verstoßung der langobardischen Königstochter war nicht ohne Widerspruch der nächsten Angehörigen Karls geschehen: es war der einzige Anlaß, aus welchem vorübergehend das Verhältnis zur Mutter getrübt ward: doch auch ein Vetter Karls, Adalhard, zog sich damals grollend vom Hof in ein Kloster zurück: er klagte, daß nun »Karl so viele edle Franken eidbrüchig gemacht habe«: d. h. es hatten wohl, nach germanischer Sitte, vor der Verlobung zahlreiche Vornehme Karls eidlich die Bürgschaft übernehmen müssen, der Tochter des Langobardenkönigs werde im Frankenreich Leid, Unrecht, Verunehrung nicht widerfahren. Er weigerte sich daher auch, der neuen Königin zu dienen, welche Karl sehr bald nach Verstoßung der Langobardin sich vermählte: das war Hildigard, aus edelstem alamannischem Herzogsgeschlecht, ein erst zwölf- oder dreizehnjähriges Mädchen. Diese ist offenbar die Lieblingsgemahlin Karls gewesen; die Sage hat seine Liebe zu ihr, die ihren Tod überdauerte, ihr in die Gruft nachfolgte und nicht von der schönen Toten lassen wollte, in anmutigen und rührenden Bildern verherrlicht: sie gebar ihm in zwölf Jahren zehn Kinder und sank, kaum vierundzwanzig Jahre alt, in das Grab in der Blüte ihrer Jugend und strahlenden Schönheit: ihr Goldhaar, ihre schneeweiße Stirn werden gepriesen (s. unten: »Karl und sein Haus«).
Einstweilen hatte in Italien König Desiderius, nicht ohne Grund gegen Karl auf das äußerste erbittert, von Papst HadrianI. verlangt, er solle Karlmanns beide Knaben zu Königen der Franken salben; die Macht Karls sollte durch das Auftreten der Neffen als Gegenkönige in Karlmanns ehemaligem Reich, durch innere Kämpfe der Franken geschwächt werden. Da sich der Papst beharrlich weigerte, bedrängte ihn der Langobarde mit Krieg. Nun rief Hadrian Karl zu Hilfe. Dieser – er hatte soeben den ersten Zug gegen die heidnischen Sachsen unternommen – schlug doch nicht gleich los. Er unterhandelte mit Desiderius, bot diesem sogar eine große Summe Goldes – 14 000 Goldsolidi (168 000 Mark), – falls er Sankt Peter das Entrissene zurückerstatte. Erst nach Abweisung aller Vorschläge ließ Karl auf dem Reichstag zu Genf den Krieg gegen die Langobarden beschließen und brach gleich von dort nach Italien auf. Hier zum erstenmal entfaltete der Held jene großartige Feldherrnschaft, durch welche er so viele germanische Könige überstrahlt. Denn Karl ist der erste Germane, den die Quellen als einen großen Feldherrn – nicht nur Taktiker, sondern Strategen – klar zu erkennen uns verstatten. Wohl dürfen wir vermuten, daß der Meister des Waldgefechts, Armin, daß gar manche germanische Führer in der Zeit des Vormittelalters, daß auch germanische Männer auf römischer Seite [wie Arbogast und Stilicho], Totila, Leovigild, Chlodovech, Alboin, daß Karls Ahnen: die Pippine und Karl der Hammer, nicht ohne hohe Begabung für Feldherrnschaft ihre Erfolge hatten erringen mögen.
Aber der erste germanische Heerführer, dessen Feldherrn-Begabung, ja dessen Eigenart als Feldherr uns die Quellen genau zu beweisen verstatten, ist Karl. Diese Eigenart besteht in folgendem: 1) den Feind umfassen, nötigenfalls durch Umgehung, und von allen verfügbaren Seiten zugleich angreifen; 2) was damit zusammenhängt: getrennt marschieren, vereint schlagen; 3) hierfür möglichste Verwertung aller Straßen, zumal aber der Wasserstraßen: der Flüsse.
In einer großen Zahl von Feldzügen, welche Karl selbst geleitet hat, lassen sich diese Merkmale nachweisen: so ständig, daß wir sogar bei Feldzügen, welche seine Söhne oder seine Königsboten ausführen, falls wir auf die gleichen Feldherrn-Gedanken stoßen, vermuten dürfen, der große Held in seinem Palast zu Aachen, den man wahrlich auch schon einen »Denker von Schlachten« nennen darf, habe sie geplant. Derselbe Mann, der Muße fand, während seine Gedanken zwischen Aachen und Rom, zwischen Byzanz, Jerusalem und Bagdad, zwischen Cordoba und Ostungarn, zwischen dem Danewirke und Capua hin- und herflogen, den Gärtnern auf seinen Gehöften vorzuschreiben, welche Blumen, Gemüse und Obstarten sie pflegen sollten, – dieser Herrscher, mit Leidenschaft ein Kriegsmann, nahm sich gewiß Zeit, auch für solche Feldzüge, die er nicht in Person führte, die Pläne zu entwerfen.
Der Angriff von möglichst vielen Seiten legt, der Natur der Sache nach, oft die Notwendigkeit auf, den Feind zu umgehen, bevor der Angriff von wenigstens zwei Seiten erfolgen kann. Gleich dieser Feldzug (von 773) gegen die Langobarden wird mit einer Umgehung –, mit darauffolgender Bedrohung des Feindes in Stirn und Flanke eröffnet und, da die Bewegung gelingt, dadurch auch entschieden. Die Langobarden hatten wie in den Kriegen gegen Karls Vater die sogenannten »Clusen«, d. h. die Engpässe, welche zwischen dem Mont Cenis und dem offenen Tal von Susa liegen, besetzt und stark befestigt. Karls Vater hatte (754) dieselbe Stellung der Langobarden durch einfachen Angriff auf die Stirnseite durchbrochen. Karl aber legt schon seinen Aufmarsch auf eine Umgehung an: – nicht ein Heer, wie bisher die Franken immer getan – er richtet wider den Feind zwei Heersäulen, welche getrennt marschieren, aber in Feindesland zusammenstoßen und vereint schlagen sollen. Karl wählt zwei Angriffslinien gegen Italien: von West nach Ost und von Nord nach Süd. Er selbst führt das eine Heer über den Mont Cenis von West nach Ost, während er das zweite unter seinem Oheim Bernhard über den großen St. Bernhard schickt von Nord nach Süd. Während Karl den Feind in der Stirnseite festhielt, sollte offenbar Bernhard ihn umgehen, ihn in seiner rechten Flanke, vielleicht auch im Rücken fassen, ihm den Rückzug nach Pavia, seinem Hauptstützpunkt, abschneiden. Allein es ward dieser Doppelangriff gar nicht mehr erforderlich: die Langobarden räumten ihre Stellung vor Susa lange bevor das Umgehungsheer auf ihre Flanke stieß. Und weshalb? Weil Karl vor den Clusen abermals eine Umgehung ausführte: war jene eine strategische, im großen geplante, so befahl er jetzt eine taktische im kleinen. Während er mit seiner Hauptmacht den Feind in seinen Befestigungen beschäftigte, sandte er wahrscheinlich zwei kleine erlesene Scharen links und rechts, jedenfalls aber eine, – und diese dann vermutlich auf der linken, südlichen Stellung der Langobarden – auf schmalen Jägersteigen dem Feind in die Flanke, dessen Rücken bedrohend. Die wohl im Schutze der Nacht ausgeführte Umgehung wirkte so überwältigend auf die Überraschten, daß sie ohne Schwertstreich ihre Stellung in den Clusen räumten und in wilder Flucht nach Pavia zurückströmten, offenbar stets besorgt, im Rücken gefaßt und von dieser Hauptfestung abgeschnitten zu werden. Jenseit der Pässe vereinte sich nun Karl mit Bernhard, und beide zogen vor Pavia, das ausgehungert ward: das war das Ende des Langobarden-Reiches: eine geschickte Umgehung hat es fast ohne Blutvergießen bezwungen. Der ans Wunderhafte streifende Erfolg dieser Umfassung machte bereits den Zeitgenossen solchen Eindruck, daß gar bald die Sage einen Engel Gottes die frommen Franken über das Felsjoch führen ließ oder einen geheimnisvollen Spielmann (s. unten V. 8); von jenem kühnen Kletterwagnis an hieß der schmale Steig fortab »der Pfad der Franken«.
Adelchis, des Desiderius tapferer und feuereifriger Sohn, hatte sich nicht auch nach Pavia geworfen – eingedenk, daß in dieser Stadt schon zweimal (754 und 756) die ganze langobardische Streitmacht wie in einer Mausefalle gefangen worden war. Denn es war eine herzlich schlechte, gedankenarme Kriegführung, welche die Langobarden dreimal befolgten. Jedesmal sperren sie jene »Clusen«, jedesmal wird diese Stellung durchbrochen oder umgangen und jedesmal läuft nun das ganze Heer, ohne den Übergang über den Po, dann über den Tessin in offener Feldschlacht zu bestreiten, in die eine Hauptstadt zurück. Waren sie zu schwach, gegen die fränkische Übermacht das Feld zu halten, so empfahl sich dringend dieselbe Verteidigungsweise, in welcher nicht nur weiland die Ostgoten zwanzig Jahre (535–555) den Byzantinern Belisars ruhmvollen Widerstand geleistet, welche die Ahnen der Langobarden selbst im 6. Jahrhundert gegen die nämlichen fränkischen Feinde mit Erfolg verwertet hatten. Freilich hatten die Langobarden törichterweise unterlassen, sich eine Kriegsflotte zu bauen, durch welche sie das Meer beherrschen und in ihre zahlreichen Seefestungen Nahrungsmittel schaffen konnten, sich, auch wenn auf der Landseite belagert, vor Aushungerung zu schützen: aber auch die Franken hatten damals noch keine Kriegsflotte, erst Karl hat in späteren Jahren gegen arabische Seeräuber und normannische Wikinge eine solche gebaut. Immerhin hätten die Langobarden, falls sie das Feld nicht halten konnten, ihre Streitmacht in die sehr zahlreichen und zum Teil sehr festen, durch Sturm nicht zu erobernden Festungen auf der ganzen Halbinsel von Susa bis Benevent, ja bis Consentia verteilen und dadurch die Feinde zu einer großen Zahl von Belagerungen zwingen können, welche im Süden Italiens, im Sommer, bei ungesundem, ungewohntem Klima, den Franken, fern von dem Nachschub aus der Heimat, sehr beschwerlich, ja verderblich werden konnten und im 6. Jahrhundert wiederholt geworden waren. Statt dessen drängte sich alles in die eine Hauptstadt zusammen, welche, mitten im Binnenlande gelegen, trotz ihrer starken Deckung durch die Wasser des Tessin, unfehlbar ausgehungert werden mußte. Adelchis nun warf sich in das feste Verona, welches schon so mancher Belagerung getrotzt hatte, auch Gerberga mit ihren beiden Knaben (und Auchar) suchte Schutz hinter jenen ragenden Mauern. Allein Karl selbst führte aus dem Lager, welches Pavia umschlossen hielt, eine kleine erlesene Schar vor jene Etsch-Burg und sehr bald ergab sie sich, die Flüchtlinge ausliefernd. Nur Adelchis war entkommen, er segelte aus dem Hafen von Pisa nach Byzanz, wo er jahrelang unermüdlich strebte, den Kaiser zu bewegen, ihn mit Schiffen und Scharen nach Italien zu schicken, Karl und den Papst zu bekämpfen. Gerberga und die Knaben verschwinden aus der Geschichte, wahrscheinlich wurden sie in fränkische Klöster gebracht.
Während die Einschließung von Pavia fortgesetzt ward, begab sich Karl aus dem dortigen Lager nach Rom, daselbst an heiliger Stätte das Osterfest (3. April 774) zu feiern. Neben der tiefen Frömmigkeit, welche unzweifelhaft, ledig jeder Spur von Heuchelei, der eine Grundzug, vielleicht der Hauptzug in Karls ganzem Wesen war, bewog ihn aber auch gar manche Sorge um den Staat, den Papst aufzusuchen und sich eng mit ihm zu verbünden. Auf das ehrenvollste ward er empfangen: Hadrian schickte ihm die Behörden Roms mit dem Banner der Stadt (bandora) dreißig römische Meilen (1 = 1000 Schritt) weit bis Novae entgegen. An dem ersten Meilensteine vor der Stadt aber traf Karl alle Scharen der römischen Bürgerwehr, ferner die Schuljugend mit Palmen- und Olivenzweigen: sie sangen lateinische Loblieder zu seinem Preise und begrüßten ihn mit schallendem Zuruf: auch Kreuze ließ der Papst ihm entgegentragen, was nur geschah bei der Einholung des Exarchen von Ravenna oder eines Patrizius – welche Würde ja Karl besaß. – Als Karl dieser Kreuze ansichtig ward, sprang er vom Roß, begrüßte dieselben und legte die letzte Meile zu Fuß zurück. Auf der obersten der vielen Stufen der Sankt Peterskirche stand der Papst, von allen seinen Geistlichen, in weiterem Ring vom Volk von Rom umgeben. Karl warf sich auf jeder Stufe nieder und küßte die Steinplatte! – bei seinem spätern Besuch hat er diese überschwängliche Demut doch nicht wiederholt. – Endlich erreichte er den Papst, beide Männer umarmten und küßten sich, schritten Hand in Hand in das Innere der Kirche und stiegen hinab an das Grab Sankt Peters: es war das erste Mal, daß ein Frankenkönig den Ort betrat. Nach Beendigung des Gottesdienstes bat Karl den Papst um Erlaubnis, in die Stadt selbst gehen zu dürfen: die Peterskirche lag und liegt ja außerhalb der Umwallung auf dem rechten Tiberufer. Selbstverständlich war das nur eine höfliche, den Papst ehrende Form: der römische Patrizius wollte die weltliche Gewalt des römischen Bischofs über die Stadt dadurch anerkennen: der ehemalige byzantinische Patrizius hatte umgekehrt die Oberhoheit des Kaisers über den Papst geübt. Bald sollten übrigens die Päpste erkennen, daß Karl, bei aller Frömmigkeit und aller Ehrfurcht vor dem Nachfolger Sankt Peters, seine Schutzherrschaft über Rom nicht nur als eine Pflicht auffaßte [wie die Päpste bei Übertragung des Patriziats es wohl gemeint hatten], welche er nur auf Anrufen des Papstes zu erfüllen hatte, sondern ebenso als ein Recht, welches er als Oberherr des Papstes – auch als Richter desselben! – auszuüben befugt war. Damals aber kam es zur Geltendmachung solcher Rechte nicht: König und Papst errichteten urkundlich einen Bündnis- und Freundschaftsvertrag und Karl erneuerte feierlich das Schenkungsversprechen Pippins von Ponthion und Kiersy (oben S. 28): das sollte ihm noch viel Verdruß bereiten! Denn wie sein Vater hatte auch er nicht hinreichend klare Kenntnis von dem Umfang und der Bedeutung all' dessen, was der Papst sich hatte versprechen lassen. Es stellte sich bald heraus, – die Beamten Karls erkannten es und überzeugten ihn davon – daß jene Schenkungen sich nicht durchführen ließen ohne schwerste Schädigung der Macht, zumal der Einnahmen, doch auch der Verwaltung des langobardischen Reiches. Die Krone dieses Reiches aber trug nun sehr bald Karl selbst. Ende April traf er wieder in dem Lager vor Pavia ein und im Juni ergab sich die Stadt, durch Hunger und Seuchen bezwungen: gar schön hat die Sage (unten V. 8) berichtet, welch furchtbaren Eindruck der Anblick des »eisernen Karl« auf König Desiderius macht, wie dieser vom Wall herniederschaut und sich von Ogier (Auchar) den Frankenkönig zeigen läßt. Sage ist auch, daß ein Geistlicher Petrus die Stadt verraten und zur Belohnung ein Bistum erhalten habe, Sage, daß eine Tochter des Desiderius, als sie Karl von der Zinne herab erblickt, von Liebe entzündet wird und ihm heimlich ein Tor der Stadt erschließt. Sage endlich, daß der gefangene Langobardenkönig geblendet und in Fesseln nach Paris geschleppt worden sei. Vielmehr hat der Sieger den Besiegten mit großer Milde behandelt, wie ein wackrer Langobarde, der Geschichtschreiber Paulus Diakonus, des Warnefrid Sohn (s. unten: »Karls Akademie«) rühmt. Desiderius, seine Gattin, Königin Ansa, und eine Tochter (ungewiß, ob Karls ehemalige Gattin) wurden in fränkische Klöster gebracht, zuerst nach Lüttich, dann nach Corbie, wo Desiderius in frommem Frieden bis an seinen Tod lebte.
Karl aber ward nun König der Langobarden: dies Reich ward nicht etwa wie Aquitanien von Pippin oder später Bayern von Karl dem Frankenstaat als Provinz einverleibt, sondern blieb als selbständiges Reich neben dem fränkischen bestehen, nur daß der König dieses Reiches fortab Karl (oder dessen Sohn) ward: im übrigen blieb die langobardische Verfassung mit wenigen Ausnahmen zunächst unverändert: auch die langobardischen Herzöge blieben meist in ihren Ämtern, nur ward fränkische Besatzung in die Hauptstadt Pavia gelegt. Freilich galten Beschlüsse des fränkischen Reichstags, an dem Langobarden nur sehr ausnahmsweise teilnahmen, auch für das langobardische oder, wie man auch sagte, das italische Königreich: doch gab es auch besondere Reichstage für dieses Reich, welche, nur von Langobarden besucht, Gesetze für Italien erließen. An all' dem ward auch nichts geändert als Karl einige Jahre später seinen dreijährigen Knaben Pippin zum König dieses Reiches bestellte: die Räte desselben zu Pavia handelten nur nach Karls Befehlen, der nach wie vor sich nannte »König der Franken und der Langobarden«. Unberührt blieb noch volle zwölf Jahre durch den Untergang des Hauptreiches das zu demselben gehörige Herzogtum Benevent, dessen Herzog Arichis, ein begabter Mann, des Desiderius Eidam war: er und seine Gemahlin Adelperga hatten regen Sinn für Kunst und Wissenschaft, sie standen in geistigem Verkehr mit dem oben erwähnten gelehrten Diakon Paulus, der Mönch zu Monte Casino war.
Die Schenkungsversprechung an den Papst sollte umfassen alles Land von Luna mit der Insel Korsika, dann von Sarzana bis zum Apenninenpaß Bardone (La Cisa zwischen Pontremoli und Parma), dann bis Bercetum, Parma, Regio, Mantua, Monselice, ferner den ganzen Exarchat von Ravenna, die Provinzen Venetien und Istrien sowie die beiden Herzogtümer Spoleto und Benevent! Aber trotz der unablässigen Mahnungen der Päpste hat Karl sich nicht entschließen können, diese weiten, dem Langobardenstaat unentbehrlichen Gebiete wirklich dem Papst zu überlassen: Spoleto, das (773) eigenmächtig mit dem Kirchenstaat war vereint worden, ward (776) wieder davon gelöst, Benevent blieb noch lange unabhängig, Venetien und Istrien nahm Karl den Byzantinern für sich ab, nur den Exarchat und einzelne Städte in Tuscien und der Sabina erhielt der Papst.
Im Juli (774) war Karl bereits wieder am Rhein.
Drittes Kapitel
Karl und der Islam.
Schon Karls Vater, König Pippin, hatte nicht nur feindliche, auch freundschaftliche Beziehungen zu arabischen Fürsten gepflegt. Zwar den Ungläubigen in Spanien, diesen bösen Nachbarn, konnte der Frankenkönig nur mit Schild und Schwert entgegentreten: Pippin hatte durch eine Erhebung der christlichen, westgotischen Bevölkerung in dem von den Arabern noch immer beherrschten ehemaligen»Gotien« im Jahre 752 die Städte Nîmes, Maguelonne, Agde, Beziers und ebenso im Jahre 759 Narbonne, die letzte Trutzfeste der Mohammedaner nördlich der Pyrenäen, gewonnen: den (west)gotischen Einwohnern war im voraus versprochen worden, daß sie auch unter fränkischer Herrschaft nach ihrem gotischen Recht sollten leben dürfen. Wenige Jahre vorher war die Herrschaft des Hauses der Omaijaden in Asien durch die Abbassiden gestürzt worden (750): doch ein Sprößling jenes Geschlechtes, Abderrachmán, war nach Spanien gekommen, hatte dort zu Cordoba ein unabhängiges Omaijadenreich gegründet (756) und gegen einen Angriff des abbassidischen Kalifen von Bagdad erfolgreich verteidigt. So hatten denn dieser Kalif, Almanßur, und König Pippin einen gemeinsamen Feind in dem Omaijaden zu Cordoba.
Dies führte zu freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden: im Jahre 765 ging eine fränkische Gesandtschaft, wahrscheinlich in Erwiderung einer abbassidischen, nach Asien in das ferne Bagdad. Aber auch in Spanien standen häufig die Fürsten einzelner Städte in Waffen wider den Omaijaden zu Cordoba: solche riefen dann wohl fränkische Hilfe an. So tat denn auch im Jahre 777 der Statthalter (»Wali«) von Barcelona und Gerona: als Karl tief im Sachsenlande lagerte, erschienen Gesandte dieses Häuptlings und riefen seinen Schutz an.
Gegen einen Feldzug jenseit der Pyrenäen, in völlig unbekanntem Lande, gegen unbekannte Feinde sprach gar mancherlei, zumal solange noch viel wichtigere Aufgaben in der Nähe der Lösung harrten. Allein unwiderstehlich drängten zu diesem Unternehmen die beiden mächtigsten Gewalten in Karls großer Seele: einmal die tiefe, tateifrige Frömmigkeit und dann die leidenschaftliche Lust an Kampf, Eroberung, Machterweiterung. Schon damals, lange bevor die Kaiserkrone ihn schmückte, war Karl von der Überzeugung durchdrungen, er sei von Gott berufen, »allüberall« die Kirche zu schützen und den rechten Glauben zu verbreiten: daher sein Kampf für den Papst gegen die Langobarden, daher seine großartigen Bemühungen, die heidnischen Nachbarn ringsum: Sachsen, Avaren, Slaven zu bekehren. So aufrichtig, so frei von jeder Heuchelei dieser Glaube war, so höchst angenehm empfand es doch der kampffreudige Held, der machtgierige König, daß ihm jene von Gott auferlegte Pflicht für den Glauben zugleich den Krieg gegen jene Heiden und die Unterwerfung ihrer Länder auferlegte: die Befriedigung seiner heißesten Leidenschaften schien so als gottwohlgefällige Erfüllung frommer Pflicht.
In angenehmster Mischung von christlichem Glaubenseifer und von heldenhafter Lust an Heerfahrt und Eroberung ließ sich Karl auf das weitaussehende Unternehmen ein: gerade auch solche Fahrt in unbekannte Länder und Gefahren reizte ihn. Er hat, im Unterschied von seinem maßvollen, vorsichtig nüchternen Vater, einen großartigen, aber ein wenig phantastischen Zug ins Weite, in die Ferne, in das Ungemessene. Im folgenden Jahre (778) begann er nach sorgfältigen, großen Vorbereitungen den Feldzug über die Pyrenäen: aus seinem eignen Munde wissen wir, daß ihm wirklich die Eroberung von ganz Spanien, die Zerstörung der arabischen Herrschaft daselbst, die Befreiung der spanischen Christen von dem Joche der Ungläubigen als Ziel vorgeschwebt hat.
Aber dieser spanische Krieg sollte der einzige von dem großen Feldherrn in Person geleitete Waffengang werden, der völlig scheiterte. Den Plan dieses seines zweiten großen Feldzugs entwirft er in völlig gleicher Weise wie den des ersten, des Langobardenkrieges von 773. Auch hier zwei Heere, welche auf zwei verschiedenen Straßen vordringen, erst in Feindesland sich vereinen. Von Nordwest nach Südost hinziehend, bilden die Pyrenäen die natürliche Grenze zwischen der iberischen Halbinsel und Frankreich. Dementsprechend wählte Karl seine zwei Straßen von Nordosten und von Nordwesten: das eine Heer, bestehend aus dem Aufgebot der östlichen Gebiete Karls: also der Bayern, Alamannen, Ostfranken, Burgunden, wie der vor kurzem erst unterworfenen, aber schon zur Heeresfolge herangezogenen Langobarden, dem aus der Provence und dem ehemals gotischen Septimanien, zog über die Ostseite der Pyrenäen: also über Narbonne und Urgel. Ein Blick auf die Karte zeigt, daß für diese Scharen jeder andre Weg ein sinnloser Umweg gewesen wäre. Der Befehlshaber dieses Heeres wird uns nicht genannt. Das zweite Heer führte Karl selbst; es bestand aus den Völkern des Nordwestens (also Aquitaniern, Neustriern, Bretonen, salischen Franken und Friesen). Es zog auf dem westlichen Wege durch das Land der Basken, wohl über St. Jean-Pied de Port, Burguet und den Paß von Ronceval auf Pampelona: erst vor Saragossa vereinten sich beide Heere. Wenn das Unternehmen fehlschlug, so lag der Grund nicht in den kriegerischen, sondern in den politischen Verhältnissen. Karls arabische Verbündete, welche ihn gegen Abderrachmán, den Omaijaden zu Cordoba, zu Hilfe gerufen hatten, waren vor seinem Eintreffen in Krieg untereinander geraten und zum Teil durch diese Kämpfe, zum Teil von dem Omaijaden vernichtet worden. Schwerer noch wog, daß die christlichen Goten und die christlichen Basken in Spanien, zu deren Beschützung und Befreiung dieser »Kreuzzug« hatte dienen sollen, feindlich gegen Karl auftraten: sie wollten lieber als die fränkische Herrschaft anerkennen sich der Araber allein erwehren, ja sogar Verträge mit diesen schließen. War doch auch die Lage der Christen unter der Herrschaft des Islam, falls sie nur die Schatzung zahlten, eine keineswegs gedrückte: jedenfalls eine höchst beneidenswerte, verglichen mit der der heidnischen Sachsen unter der Herrschaft Karls: die Sachsen wurden vor die Wahl gestellt: Taufe oder Tod: die Christen in Spanien durften unter der Herrschaft der Araber ungestört ihren Gottesdienst halten.
In den Bergen von Asturien aber hatte das kleine Häuflein von Goten, welche sich aus der Schlacht bei Xeres de la Frontera am Guadalete (711) gerettet, Freiheit, Volkesart und Glaube unter Führung des sagenhaften Helden Don Pelayo bewahrt und allmählich wieder mehr Land gewonnen, begünstigt durch die unaufhörlichen Kämpfe der Araber und Berber untereinander.
So war nach und nach ein kleines christliches Königreich Asturien erwachsen: die Hauptstadt, Pampelona, lag in der Landschaft Navarra, auch viele christliche Basken der Pyrenäen, von den Arabern nie unterworfen, gehörten zu diesem Staat. So feindlich verhielten sich aber jetzt diese Goten und Basken, – unbestimmbar, ob mit den Arabern verbündet oder für sich allein – zu den Franken, daß Karl mit dem Westheer Pampelona, das auf seinem Wege lag, erstürmen mußte. Er überschritt nun in einer Furt den Ebro und zog gegen Saragossa, vor dessen Mauern er sich mit dem Ostheer vereinigte. Die Stadt konnte doch nicht bezwungen werden: offenbar, weil die vorausgesetzte Mitwirkung der arabischen Verbündeten versagte: einer hatte vor Karls Erscheinen in Spanien den Untergang gefunden, den andern führte Karl jetzt bei dem Rückzug in Ketten mit nach »Francien«.
Ob der Rückzug wieder auf zwei Straßen erfolgte, wissen wir nicht; fest steht nur, daß Karl sein Heer wieder auf dem westlichen Wege zurückführte: er zerstörte jetzt Pampelona oder doch die Mauern der Stadt, die er nicht behaupten konnte und in feindlichen Händen nicht lassen wollte. Als nun das Heer nördlich von Pampelona die Pyrenäen überschritt, da geschah in der Schlucht von »Ronceval« (am 15. August 778) jener Überfall der fränkischen Nachhut, von dem jahrhundertelang Lied und Sage erzählt haben: denn hier fiel »Roland der Held«. Derselbe gehört nicht nur der Sage an: die gleichzeitigen Geschichtsquellen wissen von einem Hruotlandus, Markgraf der bretonischen Mark (Bretagne), der hier den Tod fand mit dem Pfalzgrafen Anshelm und dem Tafelwart Eggihard (seniskalkus, der für die königliche Tafel zu sorgen hat; es ist das Amt, das im Nibelungenlied Herr Rumold der Küchenmeister bekleidet). Wahrscheinlich begegnet Rolands Name und Unterschrift (»Rotlan, comes«) auch in einer Urkunde des Abtes Fulrad von St. Denis (oben S. 32) vom 25. Dezember 776: hier steht er als Zeuge neben und mit demselben Pfalzgrafen Anshelm, neben und mit dem er bei Ronceval fallen sollte. Er war wohl hervorragend unter Karls Paladinen: denn die bretonische Mark wurde stets nur ausgezeichneten Männern anvertraut, die keltischen Clane jener Landschaft mußten gar oft mit dem Schwert in Gehorsam gehalten werden. Das ist alles, was die Geschichte von dem viel gefeierten Helden der Sage zu berichten weiß. Es ist vielleicht bezeichnend für »Rolands« gefürchtete Tapferkeit, daß nicht solang er waltete, erst nach seinem Fall die Bretonen wiederholt (786, 789, 811) zu den Waffen greifen, obwohl auch Rolands Nachfolger im Markgrafentum (oder doch in den Kämpfen) daselbst, Andulf und Wido, ausgezeichnete Paladine Karls waren, die stets rasch mit ihnen fertig wurden. Dem Seniskalk Eggihard hat ein Zeitgenosse eine rührende Grabschrift verfaßt, aus welcher wir auch den Tag des Gefechts erfahren:
Grabschrift des Aggiardus
Unter dem schmalen Gestein sind hier die Gebeine gebettet, Aber die Seele flog hoch zu den Sternen empor.
Edlem Geschlecht entstammt, aus dem tapfern Volke der Franken, Milde war er und sanft, freundlich von Sitten und Art.
Ach kaum war ihm der Flaum auf den rosigen Wangen entsprossen, Ach daß früh, vor der Zeit, blühende Jugend auch stirbt.
Aggiard war er benannt, wie sein Vater vor ihm genannt war Und in des Königs Palast pflog er erhabenen Amts.
Ihn hat der Tod uns entrafft durch das Schwert, unersättlich im Raube, Aber das ewige Licht zog ihn zum Himmel hinauf.
Als der gewaltige Karl aus dem sandigen Spanien heimzog, Starb er: nur für die Welt, aber er lebt nun für Gott.
Ihn betrauern zugleich in betrübtem Herzen die Franken, Ihn Aquitanien, ihm weinet Italien nach.