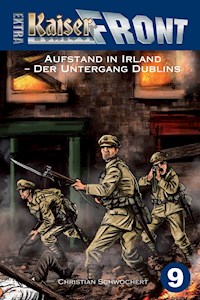9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HJB Verlag & Shop KG
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Fast ganz Europa wird vom Großen Krieg heimgesucht. Auch an der Südostgrenze des Kaiserreiches Österreich-Ungarn werden heftige Kämpfe ausgefochten. Die Gegner der Mittelmächte heißen dort Rumänien und Russland. Um den österreichischen Waffenbruder zu unterstützen, entsendet das Deutsche Reich Truppen nach Rumänien. In ihren Reihen sind Friedrich Ranke und der Siebenbürger Sachse Klaus von Kühnen. Der Auftrag steht für die deutschen Soldaten von Anfang an unter keinem guten Stern: Ein eigentlich für sie zuständiger Offizier desertiert, noch bevor sie ihn überhaupt kennenlernen. Und der Zug, der sie zu ihrem Ziel bringen sollte, wird unterwegs überfallen. Zwar gelingt es, den Angriff abzuwehren, aber kaum haben sie das zu sichernde Gebiet erreicht, stehen sie unter Beobachtung. Die einheimischen Bürger des kleinen Dorfes Gran empfangen sie mit Wohlwollen, aber sie ahnen nichts von der drohenden Gefahr: einer Partisanenarmee! Im Osten des Landes steht General August von Mackensen der Masse der von England und Russland unterstützten rumänischen Armee gegenüber. Insbesondere die Engländer tun sich dabei hervor, in den besetzten Landesteilen einen bewaffneten Aufstand zu organisieren. Daheim im Reich koordinieren Kaiser Wilhelm II., Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff den Krieg. Sie wissen, dass von ihren Entscheidungen das Überleben des Vaterlandes abhängt. Währenddessen hört der junge Hans von Dankenfels von den Heldentaten der deutschen Soldaten und fasst den Entschluss, zur Armee zu gehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Kaiserfront Extra
Band 7
Partisanenkampf in Rumänien
Military-Fiction-Roman
von
Christian Schwochert
Inhalt
Titelseite
Vorwort
Vorgeschichte
Kapitel 1: Einsatz in Rumänien
Kapitel 2: Der Kampf um Gran
Kapitel 3: Das Inferno von Bukarest
Kapitel 4: Die große Schlacht um Rumänien
Kapitel 5: Operation Dracula
Nachspiel
Empfehlungen
Stahlzeit
Inferno – Europa in Flammen
Viktoria
T93
Impressum
Vorwort
Dieses Buch widme ich dem tapferen und ehrenhaften General Robert E. Lee. Wie viele Verbrecher seine Denkmäler auch schänden mögen, sie ändern dadurch nichts an der Tatsache, dass General Lee ein aufrechter und anständiger Mensch war, den wir uns zum Vorbild nehmen sollten.
Christian Schwochert
Berlin, 22.10.2017
Vorgeschichte
Am 28. Juli 1914 erschoss der serbische Attentäter Gavrilo Princip in Sarajevo den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und dessen Gemahlin Sophie. Dieser feige und hinterhältige Anschlag war der Funke, der das Pulverfass Balkan zur Explosion brachte. Das Kaiserreich Österreich-Ungarn erklärte Serbien den Krieg, und es folgten Kriegserklärungen der mit Serbien verbündeten Mächte gegen Österreich-Ungarn. Das mit der Donaumonarchie verbündete Deutsche Kaiserreich eilte seinem Brudervolk zu Hilfe, da eine Niederlage Österreichs die Gegner Deutschlands gestärkt hätte. Ebendiese Feinde waren es auch, die den Krisenherd Balkan befeuert hatten. Politiker wie der deutschenfeindliche Außenminister Großbritanniens, Sir Edward Grey, hatten schon seit Jahren gegen das Kaiserreich der Deutschen agitiert und von ihren bequemen Hinterzimmern aus Intrigen gesponnen. Durch das Attentat auf Franz Ferdinand hatten diese dem Reich feindlich gesonnenen Mächte nun die Gelegenheit, Deutschland in den Krieg zu treiben. Ihr hinterlistiger Plan erwies sich allerdings als schwer durchführbar; zumindest schafften sie es nicht aus eigener Kraft. Dank der klugen Militärtaktik deutscher Offiziere wie Generalfeldmarschall von Hindenburg, Generalquartiermeister Ludendorff und General von Lindenheim gelang es der Kaiserlichen Armee, den Krieg in Europa rasch ins Feindesland zu verlagern. Die Serben wurden in der Schlacht auf dem Amselfeld vernichtend geschlagen, Russlands Heere massiv nach Osten getrieben, und die Franzosen in einen erbitterten Stellungskrieg verwickelt, der allerdings für keine der beiden Seiten große Vorteile brachte. England führte Seeschlachten und Seeblockaden gegen das Reich durch, konnte damit allerdings keine nennenswerten Erfolge erzielen, und eine Landung der britischen Flotte in den deutschen Häfen war unmöglich. Innerhalb Deutschlands versuchten linke Vaterlandsverräter gegen das siegreiche deutsche Heer zu agieren; was ihnen jedoch keinen Erfolg brachte, da die Mehrheit der Deutschen nach glänzenden Siegen wie in der Schlacht von Tannenberg an einen Sieg des Reiches glaubte.
Die britischen Politiker sahen ein, dass die Situation festgefahren war. Deshalb suchten sie sich für den Kampf gegen Deutschland weitere Helfer. Zwar führten sie auch Krieg gegen Österreich-Ungarn, Bulgarien und das Osmanische Reich, aber ihr Hauptgegner hieß Deutschland. Aus britischer Sicht mussten natürlich die Verbündeten des Reiches ebenfalls niedergerungen werden, aber der Hass der englischen Medien und Politiker richtete sich hauptsächlich gegen Deutschland. Die Karte Europas im Jahr 1914 war relativ übersichtlich und natürlich wollten die Briten Verbündete haben, die sich in der Nähe befanden und sofort eingreifen konnten. Selbstverständlich versuchten sie auch die USA zum Kriegseintritt zu überreden. Da jedoch die Amerikaner mehrheitlich gegen einen Krieg waren, überredeten die britischen Politiker Länder wie Italien und Rumänien zum Kriegseintritt gegen Deutschland. Sie stellten den beiden Nationen dafür große Gebietsgewinne in Aussicht. Auch bei der Schweiz versuchten sie ihr Glück, stießen dort allerdings auf taube Ohren, da die Schweizer auf ihrer Neutralität bestanden. Bei Italien und Rumänien waren sie jedoch erfolgreich. Italien trat am 23. Mai 1915 in den Krieg ein und Rumänien folgte am 27. August 1916. Bereits im selben Monat stießen die Rumänen auf das Gebiet der kaiserlichen und königlichen Doppelmonarchie vor. Der Zeitpunkt war von Rumänien strategisch gut gewählt, weil er während der russischen Brussilow-Offensive stattfand. Das Kriegsziel der Rumänen war die Eroberung Siebenbürgens, der Bukowina und des Banats, die mehrheitlich rumänisch besiedelt waren. Aber ihre Pläne scheiterten ebenso wie die Offensive der Russen. Für ihren Wunsch, diese Landesteile der benachbarten Doppelmonarchie zu beherrschen, hatte Rumänien folgenden Grund: Das 1877 unabhängig gewordene Land befand sich schon seit geraumer Zeit in einem ethnischen Konflikt mit Österreich-Ungarn. Bei Ausbruch des großen Krieges im Sommer 1914 hatte der rumänische König Carol I. im Kronrat seines Landes für den Kriegseintritt Rumäniens auf Seiten der Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn votiert, war allerdings durch die anderen Mitglieder des Kronrates überstimmt worden. Der Hauptgrund für den Wunsch des Königs war vor allem die dynastische Verbindung zum deutschen Kaiser, denn das rumänische Königshaus entstammte einer Seitenlinie des Hauses Hohenzollern. In einer heftigen Auseinandersetzung mit den pro-deutschen Konservativen setzte der rumänische Ministerpräsident Ion I. C. Brătianu 1914 die Neutralität Rumäniens durch. König Carol I. konnte nicht ahnen, dass diese Neutralität der erste Schritt zum Krieg gegen die Mittelmächte war und Brătianu bereits den Kriegseintritt plante. Das englische Geld, das in seine Taschen floss, war ihm dabei eine große Entscheidungshilfe.
Nach dem Tod Carols I. im Jahr 1914 bestieg sein Neffe Ferdinand I. den rumänischen Königsthron, und die Befürworter eines Kriegseintritts aufseiten der Alliierten gewannen die Oberhand. Sie legten fest, dass die Kriegsziele Rumäniens die Gewinnung des größten Teils von Siebenbürgen, des Banats und der Bukowina sein sollten. Bis zum August 1916 gelang es Brătianu, den Kriegseintritt durchzusetzen. Im Vertrag von Bukarest mit den Alliierten ließ sich Rumänien diese Gebiete zusichern und erklärte Österreich-Ungarn am 27. August 1916 den Krieg. Der Ministerpräsident und der von ihm beeinflusste König hatten die Medien und die Eliten des Landes dazu gebracht, sich für den Krieg auszusprechen, obwohl damit einmal mehr ein gewaltiger Graben zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung ausgehoben wurde. Aber woran sie nicht gedacht hatten, war, dass sie diesen Krieg verlieren könnten.
Zwar führte die rumänische Armee mehr als eine halbe Million Soldaten ins Feld, aber diese waren mangelhaft ausgerüstet und obendrein schlechter ausgebildet als ihre Gegner. Wohin zum Beispiel soll eine Einheit marschieren, wenn keiner in der Truppe Straßenschilder oder Karten lesen kann? Die Rumänen wurden vernichtend geschlagen, und ihrem Vorstoß folgten zwei Gegenoffensiven. Die eine kam aus Österreich-Ungarn und die andere aus Bulgarien.
Ein gemischter Verband aus deutschen, bulgarischen und österreichisch-ungarischen Truppen unter Generalfeldmarschall August von Mackensen überschritt die Donau und machte sich auf den Weg in Richtung Bukarest. Die Soldaten der Heeresgruppe Mackensen drangen am 06. Dezember 1916 in die rumänische Hauptstadt ein.
Mit der Eroberung von Rumäniens Hauptstadt sollte der Kampf allerdings bei Weitem nicht beendet sein. Stattdessen trat der Krieg in eine neue Phase ein, die wesentlich brutaler werden würde, als bisher im Osten üblich.
Kapitel 1: Einsatz in Rumänien
Bukarest, 06.12.1916
Der rumänische König Ferdinand I., sein Ministerpräsident Brătianu und der englische Verbindungsoffizier sowie ein Großteil der Verteidiger hatten die rumänische Hauptstadt bereits Tage vor von Mackensens Eroberung verlassen. Die Einnahme war kein Problem gewesen; es hatte nur wenig Widerstand gegeben und die vereinzelten rumänischen Kämpfer waren schnell besiegt worden. Der deutsche Generalfeldmarschall freute sich über seinen Sieg, und während die Truppen in die praktisch wehrlose Hauptstadt des Feindes einmarschierten, dachte er daran, was jetzt zu tun war: Ich muss mich um die Sicherung der Stadt kümmern und anschließend dem Feind folgen, um ihn schließlich im Osten zu schlagen. Vermutlich wird sich die rumänische Armee nicht nach Russland zurückziehen sondern versuchen, ihr Ostgebiet zu halten. Gelingt es mir, sie dort zum Kampf zu stellen, muss ich allerdings aufpassen, dass sie mir nicht einfach entkommen und sich nach Russland absetzen; besonders der König und sein Ministerpräsident dürfen mir nicht entkommen. Um zu siegen ist es allerdings nötig, dass ich den Rücken frei habe. Daher werde ich nach Berlin und Wien eine Nachricht schicken, dass weitere Truppen zur Besatzung Rumäniens nötig sind. Die Ordnung muss aufrechterhalten werden; wenn nötig, wird unsere Führung eben neue Einheiten ausheben müssen.
Der Generalfeldmarschall setzte seine Gedanken sofort in die Tat um und schickte entsprechende Nachrichten an die Befehlshaber.
Hermannstadt, 01.01.1917
Dem Wunsch von Mackensens folgend, hatten das Deutsche Kaiserreich und das Kaiserreich Österreich-Ungarn frische Truppen zur Besetzung der in Rumänien eroberten Gebiete geschickt. Ein Teil der Besatzungstruppen traf am 01. Januar 1917 in Hermannstadt ein. Die Stadt gehörte, ebenso wie das weiter östlich gelegene Kronstadt, zum Siedlungsgebiet der deutschstämmigen Siebenbürger Sachsen. Außer diesen lebten dort die ungarischstämmigen Szekler. Die Mehrheit im Großraum Siebenbürgen stellten allerdings die Rumänen, wobei es auch kleinere Minderheiten wie Juden und Zigeuner gab. Zusammengehalten wurde der Vielvölkerstaat vor allem durch den christlichen Glauben und die Treue zum österreichischen Kaiser Franz Joseph I. Als der betagte Kaiser am 21. November 1916 starb, sorgte dies für eine erste ernsthafte Gefährdung des Zusammenhalts.
Um derlei politische Dinge machte sich der deutsche Soldat Friedrich Ranke nicht allzu viele Gedanken, als er und seine Mitstreiter mit dem Zug im Bahnhof von Hermannstadt eintrafen. Die große Stadt war nicht ihr eigentliches Ziel; sie sollte lediglich eine Zwischenstation sein. Keiner der deutschen Soldaten, die in Rumänien eingesetzt werden sollten, sprach nämlich rumänisch. Deswegen sollte in Hermannstadt ein Fähnrich namens Klaus von Kühnen zusteigen, dessen Vater ein Siebenbürger Sachse und dessen Mutter eine Rumänin war. Da der junge Mann sowohl Deutsch als auch Rumänisch beherrschte und obendrein für die kaiserliche und königliche Armee tätig war, würde er ihnen als Übersetzer sehr hilfreich sein. Friedrich stieg aus und hielt nach dem Fähnrich Ausschau. Soweit mir erklärt wurde, sollen wir erst ihn hier in Hermannstadt aufnehmen und anschließend in Kronstadt einen Leutnant, der ebenfalls rumänisch spricht und in der k.u.k. Monarchie dient. Dieser wird uns dann anführen, wenn wir von Kronstadt aus nach Süden aufbrechen und das von uns zu bewachende Besatzungsgebiet von einer österreichischen Truppe übernehmen, die anschließend wieder im Kampf eingesetzt wird, dachte Friedrich und schaute sich auf dem Bahnhof um.
Obwohl der junge Soldat sich fernab seiner Heimat befand, wirkte das Gebäude vertraut auf ihn. Man merkt, dass unsere deutschen Brüder diese Stadt maßgeblich geprägt haben, dachte er, während er sich umblickte.
Vom Bahnhofsgebäude aus konnte Friedrich einen hervorragenden Eindruck von der Stadt gewinnen; sie wirkte sauber, ordentlich, sicher und ausgezeichnet geplant. Die Bauwerke sahen aus wie Prachtbauten in Berlin, München oder Wien.
»Warten Sie auf mich?«, fragte plötzlich eine Stimme hinter Friedrich.
»Wenn Sie der Fähnrich Karl von Kühnen sind?«, erkundigte sich Friedrich.
»Der bin ich. Freut mich, Sie kennenzulernen.«
Von Kühnen reichte Friedrich die Hand.
»Wir sollten gleich wieder einsteigen. Im Zug kann ich Ihnen die anderen Soldaten vorstellen«, meinte Friedrich.
»Ach, warten Sie ruhig noch ein paar Minuten. Der Zug hält hier recht lange und ich finde, wir sollten den Anblick von Hermannstadt im Schnee genießen. In Kronstadt wird der Zug lediglich ein paar Minuten halten, sodass wir nur Zeit haben, unseren Leutnant einzusammeln. Wir werden da nicht viel von der Stadt sehen, deshalb ist das hier die letzte Chance, eine gut funktionierende und vor allem saubere Metropole zu betrachten.«
Daraufhin murmelte Friedrich: »Ich hab da ein ganz mieses Gefühl.«
»Das ist vollkommen berechtigt«, entgegnete der Fähnrich, dem dieses nicht entgangen war.
Friedrich entschloss sich, den Tipp von Karl zu befolgen und genoss die Aussicht auf Hermannstadt, bevor sie in den Zug stiegen. Ich lasse mir lieber alles von ihm erklären, wenn die anderen Kameraden dabei sind, dachte Friedrich, während er Karl von Kühnen zu den anderen Soldaten brachte.
Ein paar der Gefährten kannte Friedrich bereits aus der Zeit, in der sie an der Waffe ausgebildet worden waren. Daher stellte er dem Fähnrich seine Leute nacheinander vor: »Fähnrich von Kühnen, das sind Ernst Bauer, Joachim Jensch, Adam Stötzner, Wolfgang Arvidsson, Nils Haase; die anderen von euch habe ich ja erst vor Kurzem kennengelernt, weshalb ich darum bitte, dass Ihr euch selbst vorstellt.«
Die restlichen Soldaten im Wagen stellten sich dem Fähnrich vor, worauf Friedrich zu diesem sagte:
»Hiermit übergebe ich Ihnen formal das Kommando über diese Männer, bis wir unseren Leutnant treffen. Bei unserem Aufbruch war die Verantwortung für diese Truppe nämlich mir übergeben worden, da kein Offizier bei dieser Fahrt anwesend sein würde.«
Dann ergriff der Fähnrich das Wort. Zuerst bedankte er sich mit kurzen Worten und überbrachte dann die schlechte Nachricht: »Ich weiß, Sie werden das mit Sicherheit nicht gerne hören, aber besser, Sie erfahren es jetzt, als dass Sie später vor vollendete Tatsachen gestellt werden.«
Aufmerksam blickten ihn die Soldaten an, als er eine kurze Pause machte und dann fortfuhr: »Wenn wir mit diesem Zug den Leutnant in Kronstadt abgeholt und über die Grenze nach Rumänien gefahren sind, wird der Zug anhalten, wir steigen aus und es geht zu Fuß weiter in das uns zugewiesene Gebiet. Die Gegend liegt südlich von Kronstadt und zeichnet sich durch Wald, Wiesen und Dauerweiden aus. Die nächstgelegene Stadt ist Kronstadt, aber wir werden drei Tagesmärsche von ihr entfernt sein. Der Fußmarsch ist leider nötig, weil die Dörfer nicht mit dem Zug erreicht werden können. Ich weise Sie außerdem darauf hin, dass keine richtigen Straßen zu den unserer Obhut überlassenen Dörfern führen, sondern lediglich Feldwege. Fließendes Wasser gibt es ebenfalls nicht, dafür einen Brunnen und einen kleinen Bach in dem Dorf, wo wir unseren Sitz haben werden. Von dort aus behalten wir die ganze Gegend im Auge. Die zurzeit anwesenden Truppen werden uns ihr Funkgerät überlassen, sodass wir Kontakt nach Kronstadt und zu den anderen Besatzungszonen halten können. Ich weiß, diese neumodische Erfindung steckt momentan noch in den Kinderschuhen, aber praktisch ist sie trotzdem. Besonders, wenn keine Telefonleitungen vorhanden sind. Leider gibt es bisher nicht sonderlich viele Funkgeräte in unserem Machtbereich, aber weil Gran ein abgelegener Stützpunkt ist, wurde dort eins hingebracht, das immerhin bis Kronstadt senden kann. Ein Telefon wäre sicher praktischer; die Verständigung darüber ist besser als über Funk. Aber es ist eben, wie es ist. Ansonsten sind wir von der Außenwelt ziemlich abgeschnitten. Wohnen werden wir in Lehmhütten, aber keine Sorge – in denen ist es nie richtig kalt. Außerdem sehe ich gerade, dass Sie Ihre Winterausrüstung bei sich haben und die Uniformen, ebenso wie meine eigene, gut gefüttert sind. Ich weiß, das alles klingt nicht sonderlich angenehm, aber die gute Nachricht ist, dass diese Mission nicht allzu gefährlich ist. Schlimmstenfalls bekommen wir es mit Räuberbanden oder einzelnen versprengten Soldaten der rumänischen Armee zu tun. Keine große Gefahr, zumal sie schlechter ausgerüstet und ausgebildet sind als wir. Die Einheimischen dieser Dörfer sind uns nicht feindlich gesonnen; solange wir uns ihnen gegenüber anständig verhalten und bei der Versorgung des Dorfes mit anpacken, werden wir keine Probleme und immer genügend zu Essen haben. Den meisten Leuten auf dem Land ist es egal, ob ihr Herrscher in Bukarest, Wien oder Berlin sitzt; Hauptsache, sie können auf die Art leben, wie sie es seit Jahrhunderten tun. Dazu sollten Sie wissen, dass jedes Gesetz, das in Bukarest erlassen wird, ungefähr fünf Kilometer außerhalb der Hauptstadt vollkommen wirkungslos ist.«
Karl von Kühnen hielt kurz inne, als er bemerkte, wie sich der Zug in Bewegung setzte. »Sehr gut, es geht los. Ich werde die Zugfahrt nutzen, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen möglichst ein paar Worte Rumänisch beizubringen. Denn dass die Dorfbewohner kein Deutsch sprechen, dürfte klar sein. Woher hätten sie es auch lernen sollen; es gibt dort kaum Schulen.«
Friedrich fragte: »Wie heißt das Dorf, in dem wir unseren Posten beziehen?«
»Nun, das in den Karpaten gelegene Dorf nennen die Einheimischen ›Gran‹. Und um die Beantwortung der vermutlich nächsten Frage vorwegzunehmen: ich weiß nicht, wie viele Einwohner es hat«, antwortete Karl.
Ernst Bauer meldete sich zu Wort: »Sind Sie schon einmal in dieser Gegend gewesen?«
»Ich war bereits fünfmal dort; deswegen hat die Armee mich für diese Aufgabe ausgewählt. Es ist eine unheimliche Gegend; wer von Ihnen das Buch ›Dracula‹ von Bram Stoker kennt, dürfte eine ungefähre Vorstellung davon haben. Die Umwelt ist alles andere als menschenfreundlich. Man muss genau aufpassen, wo man hintritt oder was gegessen werden kann«, erklärte der Fähnrich.
»Zum Beispiel?«, fragte Joachim Jensch.
»Es gibt dort beispielsweise Pilzarten, die ich kenne, die aber nicht einmal die Bürger in Bukarest kennen, obwohl sie Rumänen sind. Wer diese Pilze zu sich nimmt, verfällt dem Wahnsinn. Die Einheimischen wissen das natürlich. Zwar kennen sie kein Heilmittel, aber durch ihre jahrhundertelange Erfahrung in dieser Gegend haben sie herausgefunden, dass einem Menschen diese Pilze nichts mehr anhaben können, wenn man regelmäßig eine ganz kleine Menge davon zu sich nimmt. Dadurch bleibt der Verzehr von größeren Mengen dann wirkungslos.«
»Das erinnert mich an die bayerischen Bauern, die kleine Mengen Arsen konsumieren, um dadurch gegen große Mengen gefeit zu sein«, meinte Adam Stötzner.
»Trotzdem sollten wir keine kleinen und erst recht keine großen Mengen von Arsen oder diesen Pilzen zu uns nehmen. Man sollte das Schicksal nicht unnötig herausfordern. Und wenn auch im Winter keine solchen Pilze zu finden sein dürften, sollten Sie trotzdem darüber Bescheid wissen«, erklärte der Fähnrich. Friedrich nickte zustimmend. Karl von Kühnen erklärte fast die ganze Zugfahrt in Richtung Kronstadt Dinge zur Geschichte Rumäniens und über die Mentalität der Menschen in diesem Land. Diese Erklärungen konnten die Soldaten jedoch nicht auf das Grauen vorbereiten, das ihnen bevorstand.
Kronstadt, 02.01.1917
Als der Zug am frühen Abend des 02. Januar 1917 im Bahnhof von Kronstadt ankam, wurden die Soldaten um Friedrich Ranke bereits erwartet. Friedrich und Karl stiegen aus, um gemeinsam den Leutnant in Empfang zu nehmen. Tatsächlich wartete ein Leutnant auf sie und winkte sie heran. Neben dem Mann standen zwei einfache Soldaten. Friedrich und Karl gingen zu dem Offizier und begrüßten ihn. »Es freut mich, dass Sie uns nach Gran begleiten«, sagte Fähnrich von Kühnen.
Der Leutnant schüttelte den Kopf und entgegnete: »Tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber ich bin nicht der von Ihnen erwartete Offizier. Leutnant Ratten ist desertiert und zur rumänischen Armee übergelaufen. Er hat sich abgesetzt, und ich wurde geschickt, um Ihnen dies mitzuteilen. Sie werden ohne ihn Ihre Mission erfüllen müssen, solange, bis Sie abgelöst werden.«
»Das heißt, ich werde der Ranghöchste in dieser Truppe sein? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist«, zweifelte Karl von Kühnen.
»Sie kriegen das schon hin; schließlich beherrschen Sie die rumänische Sprache. Das war ohnehin der einzige Grund, warum wir Ratten diesen Auftrag gegeben hatten; weil er als gebürtiger Rumäne natürlich seine Muttersprache beherrscht«, erklärte der Leutnant.
»Ich dachte, die meisten Rumänen wären gegen diesen Krieg – das stand jedenfalls in den Zeitungen, die ich gelesen habe«, fiel Friedrich ein.
»Die meisten Rumänen sind tatsächlich gegen diesen Krieg, aber es gibt leider überall schwarze Schafe«, meinte der Leutnant.
»Ich erwarte, dass Sie uns einen Leutnant der k.u.k-Armee zur Verfügung stellen«, forderte Karl.
»Tut mir leid, aber das ist unmöglich. Zum einen ist Leutnant Ratten nicht der einzige Deserteur und zum anderen müssten wir, würden wir Ihnen einen neuen Leutnant zur Verfügung stellen, diesen anderswo abziehen und durch jemand anderen ersetzen. Und es soll ja nicht irgendein Leutnant sein, sondern jemand, der rumänisch spricht.«
Karl von Kühnen nickte.
»Das ist für uns momentan nicht machbar. Im Übrigen muss ich darauf verweisen, dass der Zug gleich abfährt und Ihre Männer in Richtung Bestimmungsort bringt. Wenn Sie den Zug verpassen, bringt das die ganze Organisation zusätzlich durcheinander; Ihre Leute werden vollkommen führungslos in den Karpaten abgesetzt und sich verlaufen. Dadurch werden die Truppen im Dorf nicht von ihrem Posten weg und zu ihrem Kampfeinsatz können, wodurch sie bei den kommenden Gefechten fehlen werden, was dazu führen könnte, dass besagte Gefechte verloren gehen und …«
»Schon gut! Wir machen uns auf den Weg!«, unterbrach Karl den Leutnant.
Trotz dieser Probleme verabschiedeten sich die Männer einigermaßen höflich voneinander. Schließlich hatte keiner der Anwesenden Schuld an diesem Desaster.
Als Karl und Friedrich wieder im Zug saßen, fuhr dieser kurz darauf ab und sie berichteten ihren Begleitern, dass es keinen Leutnant geben würde.
Tja – alles, was schiefgehen kann, das geht auch schief, dachte Friedrich sarkastisch.
*
Die Fahrt aus Kronstadt heraus verlief relativ ruhig, aber nach ungefähr einer Stunde hielt der Zug plötzlich. »Was ist los?«, fragte Wolfgang Arvidsson.
»Der Zug hält mitten auf der Strecke. Das kann nur eins bedeuten: etwas blockiert die Gleise. Und dafür kann es zwei Ursachen geben; entweder eine natürliche oder eine unnatürliche. Und eine unnatürliche bedeutet entweder Banditen oder feindliche Soldaten. Also, an die Waffen!«, befahl Fähnrich von Kühnen seinen Kameraden, worauf diese ihre Gewehre für den Kampf vorbereiteten.
Tatsächlich erklang draußen ein Schuss und jemand rief auf Rumänisch: »Hände hoch!«
Rasch spähte der Fähnrich aus einem Fenster auf der linken Seite, zog seinen Kopf zurück und sagte zu seinen Männern: »Es sind tatsächlich Banditen. Sie stehen vorne bei den Zugführern und richten die Waffen auf ihn.«
»Wie viele sind es?«, fragte Friedrich.
»Soweit ich das mit einem Blick feststellen konnte, sind es zehn oder zwölf. Wahrscheinlich denken sie, der Zug ist leichte Beute; nicht weiter verwunderlich, denn immerhin ist es ein offensichtlich ziviler Zug. Sie können ja nicht wissen, dass die Armee ihn nutzt. Wenn wir aus dem Zug aussteigen, könnten sie uns einen nach dem anderen erschießen. Wir feuern von den Fenstern aus. Macht euch bereit; auf mein Zeichen öffnen wir die Fenster und schießen. Zwei Männer bewachen die Tür zum nächsten Wagen, falls der Feind bereits im Zug ist. Ich schaue kurz nach, ob auf der anderen Seite auch welche sind«, wies Karl von Kühnen an.
Er schaute nach; dort lauerten allerdings nur zwei Banditen. »Zwei hierher«, befahl der Fähnrich und winkte Wolfgang Arvidsson und Nils Haase dorthin.
Alle Soldaten bezogen ihre Posten und auf Karls Handzeichen hin öffneten sie die Fenster und schossen auf die Räuber. Die zwei auf der rechten Seite sanken tot zu Boden, während die Hälfte der Verbrecher auf der linken Zugseite nicht sofort getroffen wurde und sich davonmachte. Die Deutschen jagten ihnen ihre Kugeln hinterher, wodurch fast alle Flüchtenden getroffen wurden. Nur zwei schafften es zu entkommen. Karl befahl daraufhin sechs Soldaten, den hinteren Teil des Zuges zu kontrollieren und schickte sechs weitere Männer nach vorne. Er selbst befahl acht Männern, ihn zu begleiten und draußen nach dem Rechten zu sehen. Die restlichen zehn Soldaten sollten im Wagen bleiben und von dort aus die Umgebung im Auge behalten. Friedrich war einer der Soldaten, die Karl nach draußen begleiteten. Schnell sahen sie nach, ob es bei den Räubern noch Überlebende gab und als sie deren Tod festgestellt hatten, gingen sie zur Lok und erkundigten sich, ob alles in Ordnung war. Dem Lokführer und den Heizern ging es gut und Karl fragte sie, wann die Fahrt weitergehen könne. »Sobald die Strecke wieder frei ist«, lautete die Antwort.
Daraufhin schaute sich Karl von Kühnen die blockierten Gleise an. Nur etwas Holz. Das bekommen wir schon wieder hin, dachte er und winkte seine Kampfgenossen zu sich.
Zehn Minuten später waren die Äste und Zweige beseitigt und es konnte weitergehen. Als Karl wieder im Zug saß, meinte er zufrieden zu Friedrich: »Keine Toten und keine Verletzten auf unserer Seite. Das erste Gefecht dieser Truppe verlief ziemlich gut; wir können zufrieden sein.«
Friedrich nickte zustimmend. »Wie konnten die Banditen auch dermaßen dumm sein, einen Zug voller Soldaten zu überfallen?«, fragte Friedrich.
»Na ja; es ist ein ziviler Zug, den die Armee für ihre Zwecke beschlagnahmt hat«, antwortete Karl.
»Das ist mir klar, aber damit hätten die doch eigentlich rechnen müssen, oder? Immerhin haben wir Krieg«, meinte Friedrich.
»Vielleicht wissen die nicht, dass wir Krieg haben«, mutmaßte Karl.
»Das ist doch unmöglich!«, rief Friedrich aus.
»Nein, das ist durchaus denkbar. Manche Dörfer in Rumänien sind dermaßen abgelegen, dass sie nicht auf Karten verzeichnet sind. Wenn die Banditen in den letzten paar Jahren keinen Kontakt zur Außenwelt hatten, dann ist es sehr gut möglich, dass sie nichts von diesem Krieg wissen. Je weiter man nach Osten geht, desto abgelegener sind manche Gegenden. In Russland gibt es sogar Dörfer, wo die Menschen glauben, dieses mächtige Land müsse sich weiterhin vor einem Ansturm der Mongolen fürchten«, erklärte Karl von Kühnen.
»Unglaublich.«
»Aber nicht unmöglich«, meinte Karl und lächelte. Friedrich schüttelte nur den Kopf, worauf Karl sagte: »Grämen Sie sich nicht deswegen; die Unwissenheit unserer Feinde kann uns durchaus nützlich sein.«
»Ich frage mich, ob es klug war, die toten Banditen einfach im Schnee liegen zu lassen?«, schaltete sich Nils Haase in das Gespräch ein.
»Die sollen nicht unser Problem sein. Wir fahren hier durch das gefährlichste und am wenigsten erforschte Gebirge Europas; wer weiß, was für Gefahren abseits der Strecke liegen und wie viele menschliche Überreste sich hier überall befinden? Die Tiere der Berge werden sich um die Leichen kümmern …«, meinte Karl ungnädig.
Die restliche Fahrt über sprachen die Soldaten nicht mehr viel. Alle waren froh, dass ihr erster Kampf ohne eigene Verluste überstanden war.
*
Nach einiger Zeit erreichte der Zug den Punkt, an dem die Soldaten aussteigen mussten. Der neue Tag war bereits angebrochen und hatte den Deutschen einen schönen Sonnenaufgang beschert. Karl von Kühnen und seine Leute verließen den Zug, verabschiedeten sich vom Lokführer und den Heizern, um anschließend zu Fuß ihrem Ziel entgegenzumarschieren. Der nun fast menschenleere Zug fuhr ab und der Lokführer ließ als Abschiedsgruß die Signale seiner Lok erklingen.
Hoffentlich gibt es keine weiteren Überfälle. Jetzt sind diese Soldaten nicht mehr da, um uns zu schützen. Lediglich zwei Soldaten sind in jedem Wagen anwesend, um die Kisten zu bewachen, die wir nach Südosten bringen sollen, dachte der Zugführer, während er den Soldaten nachblickte.
Friedrich überblickte das Gelände.
Sie gingen auf einer schneebedeckten Wiese, allerdings war diese sehr klein. Dreißig Meter von ihnen entfernt standen bereits die ersten Bäume. Friedrich blickte sich beim Marschieren kurz um und sah zurück zu den Gleisen.
Um wieder ein Gefühl von Sicherheit zu erlangen, fragte er den Fähnrich: »Sie wissen ganz genau, wo wir hin müssen?«
»Aber sicher. Ich bin schon mehr als einmal hier gewesen. Machen Sie sich keine Sorgen«, beruhigte ihn Karl von Kühnen.
»Dann ist es ja gut«, entgegnete Friedrich.
»Bleibt alle dicht beieinander! Und behaltet eure Umgebung gut im Auge!«, rief der Fähnrich seinen Kameraden zu.
Nach wenigen Schritten hatten die Soldaten den winterlichen Wald betreten und marschierten in Richtung Gran. Plötzlich vernahm Friedrich ein Geräusch und rief: »Vorsicht!«
Schnell legte er mit seinem Gewehr in die Richtung an, aus der er das Geräusch vernommen hatte. Seine Mitstreiter folgten diesem Beispiel. Ein paar Sekunden später hetzte ein Reh an ihnen vorbei, was einige Soldaten herzhaft lachen ließ. »Und ich dachte schon, da kommt wer weiß was auf uns zu«, meinte Wolfgang Arvidsson erleichtert.
Völlig unerwartet folgte auf das Reh eine Rotte Wildschweine. Mit ihren gewaltigen Hauern stürmten sie auf die Soldaten zu. »Feuer!«, rief Karl von Kühnen, worauf seine Gefährten auf die Tiere anlegten und ihnen ihre Kugeln entgegenschickten.
Wenige Schüsse später lag das Schwarzwild tot im Schnee. »Seht euch ihre Hauer an; hätte einer von denen euch am Oberschenkel getroffen, wäre dies leicht das Ende gewesen«, meinte von Kühnen.
Der Fähnrich machte ein nachdenkliches Gesicht, worauf Friedrich ihn fragte: »Worüber denken Sie nach?«
»Ich überlege, ob es sinnvoll wäre, eins der Tiere als Geschenk für die Dorfbewohner mitzunehmen. Dadurch könnten wir ihnen gleich zu Anfang unsere freundliche Gesinnung offenbaren. Andererseits aber dauert der Fußmarsch bis zum Dorf noch eine ganze Weile und ich will uns nicht zumuten, ein ganzes Schwein ewig lange durch die Berge zu schleppen. Zumal es im Dorf genügend zu essen für den Winter geben dürfte und wir selbst ebenfalls etwas bei uns haben, weshalb wir für unterwegs auch nichts benötigen. Nein, das würde uns lediglich behindern; wir lassen die Kadaver hier. Andere Tiere werden sich darum kümmern«, entschied er, wonach die Truppe ihren Weg fortsetzte.
»Es war eine gute Entscheidung, keines von den Tieren mitzunehmen. Wir haben bereits genug zu schleppen; unsere Waffen, Munition, Verpflegung. Und der gute Joachim Jensch muss zusätzlich unseren Erste-Hilfe-Kram transportieren«, meinte Friedrich.
»Ja, das alles ist schon ein nicht unerhebliches Gewicht. Zumal wir bedenken müssen, dass jedes zusätzliche Kilo unsere Kampfkraft einschränkt«, sagte Karl von Kühnen.
Der Fähnrich nickte und überlegte schon einmal, wie er die drei Dörfer in seinem Zuständigkeitsbereich von Gran aus sichern konnte: Sonderlich schwer wird es sicher nicht; gelegentlich werden wir Gran verlassen und nach den beiden anderen Ortschaften schauen müssen, aber das kriegen wir schon hin. Die Bewohner haben seit Jahrhunderten auf sich selbst aufgepasst und eigentlich dürfte es keine Probleme geben. Solange wir diese Leute auf die Weise leben lassen, wie sie es gewohnt sind und wir sie ordentlich behandeln, ist alles in Ordnung.
Von Kühnens kleine Truppe lief durch den Schnee und verließ dabei niemals den Weg, den sich ihr Anführer vorgenommen hatte. Trotzdem wunderte sich Julius, wieso sie keine Geräusche hörten, die für Berge und Wälder sonst typisch waren. Nirgendwo vernahmen sie die Laute von Tieren. Seltsam. Es müsste doch wenigstens ein Tier in diesen Wäldern zu hören sein, dachte Friedrich und schaute sich um.
Für eine Sekunde glaubte er, aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrzunehmen. Als der junge Soldat allerdings genauer hinsah, fiel ihm nichts auf. Ist wohl nur Einbildung gewesen. Und die Stille ist vermutlich auf den Winterschlaf vieler Tiere zurückzuführen, dachte er, blieb aber trotzdem wachsam.
Die Soldaten gingen weiter und plötzlich hatte Friedrich das Gefühl, als ob sie jemand oder etwas von weiter hinten anstarren würde. Schnell drehte er sich um, ohne stehenzubleiben. Sein Blick registrierte lediglich seine Begleiter hinter sich und die winterliche Landschaft, durch die sie sich bewegten. Ich werde offenbar langsam paranoid. Hoffentlich erreichen wir bald das Dorf, damit wir endlich wieder Teil der menschlichen Zivilisation werden. Gut, nach allem, was mir Karl von Kühnen berichtet hat, wird Gran nicht auf dem neuesten Stand der Technik sein; aber besser als gar nichts.
Friedrich beschloss, seine Gedanken beiseite zu drängen und lieber die Umgebung weiter im Auge zu behalten.