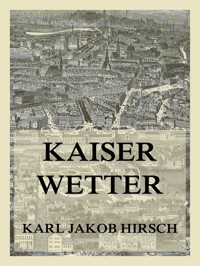
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Kaiserwetter" veranschaulicht anhand des Lebens mehrerer Familien und einzelner Figuren im Hannover des frühen 20. Jahrhunderts die glänzende Fassade, hinter der Großbürger und Kleinbürger, Christen und Juden, Könige und Kärrner ihren Gesellschaftsidealismus in schmutzige Gelüste abzureagieren pflegten -- und der Alltag wird nur noch durch den Festtag übertroffen, den Wilhelms II. Einzug und Empfang mit sich bringt. Ein kritischer Roman über eine im Umbruch befindliche Gesellschaft, die am Ende in den I. Weltkrieg gleitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Kaiserwetter
KARL JAKOB HIRSCH
Kaiserwetter, Karl Jakob Hirsch
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849680396
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Erster Teil1
Es beginnt1
Die Stadt und ihr Sohn. 5
Hohes Fest11
Der Schüler de Vries. 17
Der Knabenlehrer Jünger23
Es wird gefeiert33
Station. 42
Schwere Nacht47
Hohenzollernwetter51
Zweiter Teil.60
Sonntagsfahrt60
Irgendein Nachmittag. 66
Rotes Wetter72
Tödliche Langeweile. 77
Ein Abend. 82
Klein-Holland. 87
Das Vierte Gebot92
Reisenacht97
Amselschlag. 103
Einer geht fort108
Das Herz auf dem rechten Fleck. 113
Klein-Holländischer Alltag. 116
Dritter Teil122
Es knistert im Gebälk. 122
Mauserung. 128
Sonnenflecke. 133
Ein Huhn geht spazieren. 139
Dämmerstunden. 143
Promenadenkonzert146
Die Toten stehen auf153
Abstieg. 159
Sedantag. 163
Es geschieht etwas. 169
Ein Sonntagnachmittag. 173
Vierter Teil.178
Ein Freudentag. 178
Kurzschluss. 184
Das Welfenross bäumt sich. 193
Eine auffällige Familie. 198
Hochzeitsfackeln. 202
Vater und Sohn. 211
Das Volk, drängt sich. 215
Trauermarsch. 219
Ende und Anfang. 222
Erster Teil
Es beginnt
Briefträger Tölle sah auf die Uhr, drehte sie in der Hand hin und her.
Soll ich nun gehen oder rasch mal telefonieren, dass Mussmann mich vertritt?
So dachte Emanuel Tölle am 21. Juni, nachmittags sechs Uhr. Er saß in der Wohnstube am Fenster und sah gedankenlos auf den Engelbosteler Damm hinunter. Eine Beerdigung ging vorüber, ein kurzer Trauerzug in Zylindern und Gehröcken. Er schob sich zwischen klingelnden Straßenbahnen und fluchenden Kutschern hindurch, in Sonne und Staub, durch Lärm und Alltag. Kein Kranz, keine Blume lag auf dem Sarg. Judenbeerdigung, dachte Tölle und sah auf den Kupferstich an der Wand in goldenem Rahmen. "Der Schutzengel" hieß das Bild. Weißbehemdeter Engel mit Gänseflügeln geleitete ein zartes Kind über den Abgrund.
Die Tür zum andern Zimmer öffnete sich.
"Herr Tölle... gehn Se ruhig, das kann noch lange dauern... ich geb schon Bescheid, die Lage ist prächtig..."
Hebamme Lippelt schloss behutsam die Tür zum Schlafzimmer, in dem Luise Tölle ihr erstes Kind erwartete. Die Wehen dauerten schon zwölf Stunden.
Aber Tölle musste zum Nachtdienst, der um sieben Uhr begann. Als er die Treppe hinunterging, öffnete sich in der ersten Etage eine Tür. Die dicke Witwe Müller machte ein bedauerndes Gesicht.
"Wie geht’s... Herr Tölle?"
"Weiß nicht, muss zum Dienst."
Unten auf der Straße war es noch sehr heiß. Die Sonne brannte, aber er war Schlimmeres gewohnt als Sergeant der Landwehr, zwölf Jahre bei den Vierundsiebzigern stramm gedient. Die Bult war seine zweite Heimat, die Manöver Lichtpunkte seines Daseins, die Kaisermanöver Erfüllung aller Sehnsüchte gewesen. Beinah von Majestät angesprochen, wenn nicht Hauptmann Wülfing mit einer Meldung dazwischengekommen wäre, dachte er immer mit inniger Begeisterung an den Dienst unter der Fahne. Dass Majestät die Absicht hatte, mit ihm zu sprechen, konnte er durch Zeugen belegen. Emanuel war erfüllt von dem Bewusstsein, dass ein Gott lebt über den Sternen und auf ihn herabsah. Was ihn nicht hinderte, das irdische Leben zu genießen, es zu schmecken und davon zu naschen.
Die Mädchen in ihren sommerlich durchscheinenden Blusen ließen ihn erschauern, trotzdem er vieles erlebt hatte und glücklich verheiratet war. Wie er so die Artilleriestraße hinunterging, vergaß er die Kindsmutter und den Nachwuchs, der ihm bevorstand, sein Schnurrbart sträubte sich vor Vergnügen, und bei Wöltje schnell mal einen zu kippen war entschuldbar für einen so hart geprüften Mann. An der Christuskirche begegnete ihm ein hübsches Mädchen, machte heitere Augen und zeigte freigebig plastische Formen. Das Leben geht eben weiter, dachte Tölle.
In der Artilleriestraße hatte Hermann Wöltje eine kleine Wirtschaft. Es gab dort echte Lüttje Lage, das Nationalgetränk der Hannoveraner, schwer zu trinken für Auswärtige, da es darauf ankommt, gleichzeitig einen hellen Kornschnaps und ein Glas Lagerbier in die Kehle zu gießen. Wöltjes prima Bockwurst und la Aufschnitt waren zu rühmen, ebenso das Spezialgericht, "Klöterjahn" genannt, ein wohlschmeckendes, aber schwerbekömmliches Essen, welches gebieterisch nach einem nachfolgenden Schnaps verlangte. Eingeweihte behaupteten, dass der Klöterjahn von Jahr zu Jahr schlechter würde. Ob es nur Gerede war oder Neid und Verleumdung, weiß man nicht. Vielleicht hatte auch Mutter Wöltje das Geheimnis der Zubereitung von echtem Klöterjahn mit in ihr Grab auf dem Engesohder Friedhof genommen. Wöltje wurde nach ihrem Tode (sie starb am siebenten Kind) das Opfer von Haushälterinnen, die schlimmer waren als Ehefrauen.
,,Tach, Tölle." — "Tach, Wöltje ..
"Na, wie geht’s?"
"Ach, da muss man Geduld haben, das ist zum Auswachsen..."
"Tjawoll... tjawoll", brummte der Wirt und ließ ein Bierglas recht schön volllaufen. Als er den Schaum mit der Schaumkelle abschippte, meinte er: "Müssen wir alle mal durchmachen."
Wöltje war übrigens ein Menschenhasser, ein Nörgler und ein Sozialdemokrat. Wenn das herauskäme, dürfte der königlich preußische Beamte Tölle nicht mehr ins Lokal kommen. Aber für Tölle war es sehr gut, bei Wöltje zu verkehren. Da war mal andere Luft als in den Lokalen am Postgebäude. Tölle war für Abwechslung.
"Ich komme vielleicht nachher mal wieder vorbei", sagte Tölle und ging. Draußen schlug es schon halb sieben. Mächtig spät, denkt er, aber als er laufen will, fällt ihm ein, dass er heute doch entschuldigt sei. Wäre ja noch schöner!
Am Bahnhof lief ihm Mussmann in den Weg: "Mensch, mach fix." Tölle meinte, von ihm könne man heute nicht soviel verlangen. Mussmann lachte: "Ich glaube, es hat schon mal jemand vor dir ein Kind gekriegt."
Im Dienstzimmer war Hochbetrieb. Tölle ging an den Sortiertisch und arbeitete. Oberpostschaffner Marahrens kam um neun. Das war sein Freund. Marahrens ging gleich zu Tölle: "Na...?"
Das war wenigstens Anteilnahme. Um halb zehn klingelte das Telefon. Tölle stürzte hin.
Es war dienstlich. Er sagte "ja, ja... nein, jawoll..." und "das ist in Ordnung". Er sah draußen auf dem Bahnhofsplatz die Menschen laufen. Auf der Eisenbahnüberführung stand eine Lokomotive und pustete. Irgendwo schrie ein Kind. Tölle dachte an zu Hause.
Wo nur der Anruf der Hebamme bleibt? Die Nummer hat er ihr genau aufgeschrieben. Ob der Vorsteher wohl Krach macht, wenn angerufen wird mitten im Dienst? Das ist verboten. Paragraph elf der Hausordnung, Absatz vier.
Es wurde zehn, elf, halb zwölf. Um zwölf Uhr stand Tölle auf, ging zu Marahrens ins Nebenzimmer: "Du, ich geh mal in die Kantine, en Happenpappenessen .. . wenn angeläutet wird..."
"Ja, ja, geh schon... ich weiß Bescheid... keine Bange", lachte Marahrens und kaute an seinem Butterbrot. Der Geruch kitzelte Tölle angenehm. Er hatte Hunger, fragte: "Aus Bennigsen ...?" — "Tjawoll... Landleberwurst."
Unten in der Kantine war der Budiker Witkop gerade beim Aufwaschen. "Höchste Zeit", brummte er, "mach gleich dicht."
Als er von Tölle die familiären Umstände erfuhr, wurde er gutmütig. Er machte sogar noch mal das Gas an und ließ eine Bockwurst ziehen. Ein kleines Helles extra und gratis zur Feier des Tages. "Wird schon alles werden." Die Wurst schmeckte gut, fast wie eine von Ahrberg. Nach zehn Minuten war Tölle wieder oben im Dienstzimmer.
Es war neue Post zum Sortieren da. Es dauerte bis zwei Uhr.
Tölle sah auf den Bahnsteig 3 des Hauptbahnhofes. Der Bremer Zug stand da, abfahrtbereit. Tölle sah, wie sich die Menschen in Knäueln vorwärtsbewegten. Die Reisesaison hatte begonnen. Die Kaffeebude war aufgemacht. Tölle glaubte den Kaffee zu riechen. Das würde aber bei ihm noch dauern, bis er Kaffee bekam. Ach Gott, wo blieb bloß der Anruf?
Tölle beneidete die Reisenden, die da sorglos und übernächtig auf dem Bahnsteig umherliefen. Wie gerne würde er auch mal reisen. Seit der Militärzeit hatte er das nicht getan. Als Soldat war er ja öfters durch Deutschland gefahren, aber im Viehwagen. Aber wenn er las "Nordseebäder" oder "Berlin", dann bekam er Reiselust.
Tölle saß an seinem Tisch, die Augen fielen ihm zu, er war den Aufregungen des Tages nicht mehr gewachsen. Sein einfacher und gerader Sinn war verwirrt. Frau und Kind wurden ihm zu erdrückenden Tatsachen, mit denen er sich schwer abfinden konnte.
Emanuel Tölle, der Sohn des Tischlers Friedrich Bernhard Tölle aus der Stadt Linden vor Hannover, war ein schüchternes und etwas zurückgebliebenes Kind gewesen. Erst beim Militär ging eine dünne Kruste von ihm ab, darunter schimmerte der Mann Tölle, der Staatsbürger und Beamte, aber in ihm schlummerte noch etwas anderes. Der Mensch Tölle, von dunklen Sehnsüchten und ausschweifenden Träumen verfolgt. Manchmal erschrak er vor sich selbst, an weichen Sommerabenden oder in dunklen Nächten, wenn er Frauen und Mädchen vor sich sah, wenn er finster vor Schnaps und Bier nach Hause ging und jede Straßenhure ihn verlockte.
Um zwei Uhr fünfundvierzig rasselte das Telefon, Tölle schlief. Marahrens kam aus dem Nebenzimmer: "Mensch . . . Tölle . . . wach auf!" Schlaftrunken hörte er die Stimme von Minna Lippelt, der Hebamme: "Ein Junge ... acht Pfund ...!"
Die kürzeste Nacht des Jahres war vorüber. Der neue Tag kam zögernd hinter den Häusern des Raschplatzes herauf. Eine rosarote Wolke stand über dem Bahnhof, als Vater Tölle nach Hause ging.
Die Stadt und ihr Sohn
Als im Jahre 1866 das Schicksal in Gestalt der siegreichen Borussia aus der Haupt- und Residenzstadt eine schlichte Provinzstadt machte, trauerte sie nicht lange einer vergangenen Zeit nach, sie wuchs und vergrößerte sich, blühte auf und wurde eine saubere Offiziers- und Beamtenstadt.
Das springende Pferd, das Welfenroß, wurde zum braven preußischen Remontegaul.
Die Stadt hatte um 1900 eine Viertelmillion Einwohner. Das Generalkommando des 10. Armeekorps, die Reitschule und das Ulanenregiment waren daselbst, außerdem ein Füsilierregiment Nr. 73 und das Infanterieregiment Nr. 74. Artillerie und Train vervollständigten den militärischen Bestand.
Saubere breite Straßen wurden gebaut, Kirchen und Häuser in einem neugotischen Stil, der heute noch als warnendes Beispiel dienlich ist.
Am Hauptbahnhof saß der König August auf hohem Ross und sah bis zu Café Kröpcke hinunter, während er und sein Pferd den Rücken den ankommenden Fremden zukehrten.
Das Hoftheater hatte eine große Vergangenheit. Die Namen von Bülow und Marschner gaben ihm einst Glanz und Ruhm.
Bildungs- und Wohltätigkeitsanstalten jeder Art waren vorhanden, Technik wurde im ehemaligen Welfenschloss gelehrt und Krieg in der Kriegsschule in der Nähe des Waterlooplatzes. Von geradezu internationaler Bedeutung war die Reitschule.
Bürgerstolz und Kinderfreude war der Wald, die Eilenriede. Sie dehnte sich im Osten der Stadt aus und barg in sich die Vergnügungslokale und Erholungsstätten.
Lister Turm, Pferdeturm, Steuerndieb, Bischofshole, Kirchröder und Dohrener Turm. In diesem Wald war der Triumph der Zivilisation deutlich. Hier war wild wuchernde Schöpfung so planvoll gebändigt, hier war die Natur auf so vornehme Art geordnet worden, dass der Hannoveraner mit Recht sagen konnte: das gibt es nur bei uns!
Schloss Herrenhausen mit seinem französischen Park und seiner Fontäne war weniger schmerzliche Erinnerung an Königszeiten als gutes Fremdenwerbungsmittel. Auch der Georgen- und Welfengarten konnten sich sehen lassen samt der großen Allee vom Königsworther Platz bis Herrenhausen.
Dies ist der grobe Umriss der Stadt, in der Bernhard Tölle aufwuchs. Er wurde ein kräftiger Bengel, der Liebling der Mutter, und fühlte sich wohl. Geschrei und Jammer des Augenblicks blieben ihm, wie allen kleinen Kreaturen, nicht erspart, und Mutter Luise opferte Gesundheit und Nächte ihrem Sprössling.
Vater Tölle ertrug es mit der freundlichen, dumpfen Art, die den Hannoveraner auszeichnet. Er ist ein tätiger und schlauer Mensch, nicht so temperamentvoll wie der Rheinländer, aber auch nicht so phlegmatisch wie der Hanseate. Der Hannoveraner ist ein dauerhafter Charakter, voll Sinn für das Praktische und auch für das Schöne. Die Künste spielten zwar keine überragende Rolle in der Stadt, man hielt sie wie einen Schmuck, man ließ sie blühen und gedeihen zum Ruhme der Stadt und war eigentlich nicht unduldsamer gegen ihre Verfertiger als in anderen Städten und Ländern. Das Beamtentum war tonangebend und mehr noch der Offizier. Dieser hatte in der Reitschule und in den hervorragenden Regimentern Betätigung genug, und er glänzte in der grauen und sachlichen Stadt wie ein Halbedelstein auf einem schmucklosen Kleid. Man ließ ihn glänzen, man drückte mehr als zwei Augen zu, wenn ein Verstoß von Seiten des Offizierskorps die bürgerlichen Gemüter erregte.
Die Rangfolge war wie in den Kinderspielen: König, Edelmann, Bürger und Bettelmann. Der vierte Stand murrte und war stark vorhanden, aber machtlos. Die gottgewollte Ordnung hatte gewiss in Hannover ihren sichersten Platz.
Auch die Frömmigkeit der Staatskirche hatte jenen nüchternen und herzhaften Ton, den man liebte. Noch nicht westfälisches Schwarzbrot und nicht mehr mitteldeutsches Weizenbrot, so dazwischen lag der Geschmack der Hannoveraner.
Aber in dieser strebsamen und grauen Stadt wuchsen liebliche Mädchen. Vielleicht hatte das englische Regime in sie einen Baustoff gelegt, der sie von den übrigen Provinzweiblichkeiten unterschied.
Die Hannoveranerin ist tadellos und wagemutig zugleich. Sie ist Hüterin des häuslichen Herdes, aber auch bereit, in die Flammen eines faszinierenden Vulkans zu springen, und was sie tut, geschieht mit einer sauberen und frischgewaschenen Natürlichkeit, mit kühler Haut und zarter Wangenröte, forsch und zärtlich.
Der Briefträger Tölle war bald nach der Geburt des kleinen Bernhard vom Engelbosteler Damm in die Artilleriestraße gezogen. Es war eine hübsche Dreizimmerwohnung in der dritten Etage, in einem besseren Haus mit viel Balkonen und figürlichem Schmuck. Hier spielte sich Bernhards Jugend ab. Er war ein blonder, frischer Bengel, hübscher Butjer und Krachschlager, Lärmteufel auf allen Straßen, mit Löchern in Kopf und Knie. Bernhard besuchte die Schule am Clevertor. Er schlenderte wurstig und verspielt in den Unterricht, aber war beim Lernen sehr bei der Sache. Er spielte sich gerne auf, übertrieb und log, puffte starke Bengels von hinten in den Rücken und rettete sich immer rechtzeitig. Er lümmelte sich vor Bäcker- und Papierläden herum, ärgerte ältere Fräuleins mit abscheulichen Grimassen und machte dann wieder ein sanftes Frätzchen. Er war jedenfalls seinen Eltern gewachsen. Vater Tölle konnte nichts machen, wenn der Bengel log oder Schabernack trieb, und die Tränen Mutter Luisens waren keine besonders wirksame Waffe im Kampf gegen die Unarten des kleinen Berni. Eine merkwürdige Angewohnheit von ihm war, immer zu behaupten, er hätte bei dem Einkauf von Stahlfedern oder Schreibheften etwas "zubekommen". Einmal einen Bleistift, einmal Abziehbilder, und das gute Briefträgerehepaar war verwundert über so viel Freigebigkeit der sonst so schlechten Menschheit. Niemals hatte Berni etwas "zubekommen", er hatte es regelrecht gekauft und das Geld der unachtsamen Mutter aus der Küchenschublade gestohlen. Eines Tages hatte Bernhard, sein Abendbrot heftig kauend, erzählt, er hätte in der Papierhandlung in der Goethestraße vier große Bogen Abziehbilder "zugekriegt", was ziemlich unglaubwürdig schien. Also machte sich die misstrauische Mutter anderntags seufzend und ächzend auf, in die betreffende Papierhandlung zu gehen, um ein paar Stahlfedern zu kaufen. Dann sagte sie, ob sie nicht was "zubekäme", wie ihr Sohn. Es gab große Verwunderung, das hätte man nie getan, das könne man sich bei den Zeiten nicht leisten. "Entschuldigen Sie man bloß... ich dachte man bloß", konnte Luise Tölle nur flüstern. Sie weinte den ganzen Tag vor sich hin, sah Zuchthaus und Richtbeil über dem Haupte ihres Berni schweben.
Tölle sprach ernst mit seinem Sohn, aber er blieb beim Leugnen. Vater Tölle schlug ihn nicht. "Mein Sohn braucht das nicht", pflegte er zu sagen. Tölle glaubte schließlich seinem Sohn mehr als den weinerlichen Besorgnissen Luisens. Er meinte: "Lass man, Muttern, der Junge ist schon richtig."
Und Bernhard blieb "richtig". Er hatte das Bestreben und die Fähigkeit zu beherrschen, war immer Mittelpunkt bei den Kameraden und bei den Lehrern sehr beliebt.
Ohne ein Streber und Büffler zu sein, konnte er alles gut und gründlich. Tölle war die letzte Hoffnung der Lehrer, wenn alle sonst versagten. Er wusste nicht nur das Richtige, sondern brachte es auch mit einer schneidigen Fixigkeit heraus. Dass er unter dem Pult einen "Schulfreund" aufgeschlagen hatte und daraus die Übersetzung ablas, kam niemals heraus. Und die andern "petzten" nicht. Blond und scheinheilig stand der Bengel Tölle in der Klasse, senkte flüchtig die Augen, erhaschte im Fluge die betreffende Stelle im kleinen Heftchen unter dem Pult und sagte es dann genau so auf, als ob es ihm gerade eingefallen wäre.
Mit dem Sohn des Fahrradhändlers Käferhaus in der Hainhölzer Straße verband ihn ideale Freundschaft und spekulative Absicht. Denn der Sohn eines Fahrradhändlers war eine Art Prinz oder vielmehr Kronprinz. Das Fahrrad war höchstes Ziel, das ein Junge von zehn Jahren erreichen konnte. Und wenn man Glück hatte, einen Fahrradhändlerssohn zum Freunde zu besitzen, musste man dem Schicksal dankbar sein. Die ganze Familie Käferhaus hatte natürlich Fahrräder. Mutter, Vater und Sohn fuhren nun hoch zu Stahlross an schönen Tagen auf den Radfahrwegen der Eilenriede nach Steuerndieb oder zum Pferdeturm, um dort Kaffee zu trinken.
Beneidenswerte Menschen, die sich das leisten konnten! Ein armer Briefträgerssohn hatte keinerlei Chancen, in den Radfahrerhimmel zu kommen, es sei denn, er hätte einen solchen Freund wie Waldi Käferhaus. Der sorgte nun für Bernhard, hatte dann und wann ein Fahrrad zur Hand, und so lernte Berni heimlich und schnell diese hohe Kunst.
Das Unglück wollte es, dass Bernhard und Waldemar eines Nachmittags sich auf die Hainhölzer Straße wagten und der unerfahrene Bernhard ins Wackeln geriet, so dass er umkippte. Ein Bierwagen der Herrenhäuser Brauerei erfasste Bernis Rad, und nur dem mutigen Herbeispringen eines Unteroffiziers vom Trainbataillon war es zu verdanken, dass dem Bengel außer einigen Abschürfungen an Gesicht und Händen nichts passierte.
Das Fahrrad war freilich so demoliert, dass auch die Käferhaussche Kunst da vergeblich war. Mutter Luise fiel fast in Ohnmacht, als Berni in diesem Zustande nach Hause kam. Der Junge hatte sich ein Räubermärchen ausgedacht, das er aber vor Schwäche und Schreck nicht aufrechterhalten konnte. "Ich wollte euch doch überraschen", meinte Bernhard, aber Emanuel Tölle tobte vor Zorn. Fast hätte er seinen Sohn geschlagen.
Die Bekanntschaft mit dem kleinen Joe de Vries, dem einzigen Sohn des Rechtsanwalts S. de Vries, machte Bernhard auf eigentümliche Art. Sie hätten sich wohl niemals kennengelernt, wenn nicht eines Tages zwischen den Schülern der Oberrealschule und den Gymnasiasten eine Balgerei entstanden wäre, eine von den schon traditionell gewordenen Auseinandersetzungen in der Goethestraße zwischen den Schülern jener beiden Lehranstalten, die nahe beieinander und doch durch eine abgrundtiefe Bildungskluft getrennt lagen. Der Übermut der Vornehmen musste geduckt und das Heraufkommen der Sklaven verhindert werden. Die Gymnasiasten hegten einen tiefen Abscheu gegen eine Gattung Mensch, die es durchaus nicht darauf anlegte, die griechischen unregelmäßigen Verben kennenzulernen, die "nur" Französisch und Englisch lernte und die man durchaus verachten musste. Es war kein Klassenkampf im wirklichen Sinne, der da zwischen Real- und Lyzeumsschülern ausgetragen wurde, denn mancher Gymnasiast hatte eine arme Mutter zu Hause, die sich das Brot vom Munde absparte, um den Sohn studieren zu lassen, und mancher Realschüler hatte vermögende und wohlhabende Eltern, die aber keine akademische Bildung bei ihrer Nachkommenschaft erstrebten.
Im Getümmel eines solchen Kampfes, der um zwölf Uhr mittags Ecke Clevertor und Goethestraße ausgefochten wurde, befand sich auch ein schwarzer, schwächlicher und kurzsichtiger Judenjunge: Joe de Vries.
Er war irgendwo da mit hineingekommen, trotzdem ihm jede handgreifliche Regung fernlag. Er hatte es sehr eilig gehabt, wollte schnell nach Haus laufen, da ertönte hinter ihm der Ruf "Itzig". Er war das gewohnt und kümmerte sich wenig darum, er kniff die Lippen zusammen und ging weiter. Der Ruf "Itzig" war damals allgemein verbreitet, er war die Feststellung eines Juden, er bedeutete eine wegwerfende und verächtliche Sache. Joe wusste das, ertrug es, wie seine Eltern und Voreltern und Urahnen, verlor nichts von seiner wehmütigen Lebensfreude und war auch nicht erbost. Aber die Gymnasiasten, die diese Beschimpfung hörten, stürzten sich erbittert auf die Realschüler. Sie stimmten zwar im Prinzip dem Ausdruck "Itzig" aus vollem Herzen zu, aber aus Realschülermunde durfte ein solcher beleidigender Zuruf nicht ungesühnt bleiben.
Die Schlacht begann. Joe, der Anlass und Mittelpunkt des Kampfes, wurde zu Boden geworfen. Er wehrte sich nicht. Ein großer Junge, der Schüler Wilkening, saß auf seinem Rücken und presste ihm die Brust zusammen. Es war kaum zum Aushalten, vor seinen Augen begann es zu flimmern. Er öffnete den Mund, schrie, aber kein Ton kam aus seiner Kehle. Plötzlich wurde der Bedränger zurückgeworfen. Joe konnte atmen. Er richtete sich auf, konnte aber nur schwer sehen, da seine Brille zerbrochen war.
Es war der stämmige Schüler Tölle gewesen, der sich auf den langen Wilkening gestürzt hatte, aus Wut über so eine Feigheit. Er sah, wie der kleine schwarze Bengel japste, und schon saß er dem andern im Genick.
Joe stand zitternd und erschöpft auf der Straße. Er beschloss wegzulaufen. Sein Befreier stand hinter ihm, der Feind hatte eine blutende Nase.
Bernhard Tölle schlug dem kleinen Joe freundschaftlich auf die Schulter: "Na ... lauf man ... du ... Memme!"
Das Wort Memme war eine Konzession an seine Kameraden, die grinsend hinter ihm standen. Joe sah ihn an, wurde rot vor Freude, sagte dann: Danke auch.." lief auf seinen kurzen Beinchen die Goethestraße hinunter, bog in die Lützowstraße ein und verschwand.
Er war noch sehr aufgeregt, das Erlebnis hatte ihm gezeigt, wie hilflos er war. Trost gab ihm die Freude auf den heutigen Abend, an dem er beschenkt werden sollte. Es war das Chanukkafest, an dem man Lichter anzündete, und die Eisenbahn würde er bestimmt bekommen und vielleicht auch das kleine Harmonium.
Hohes Fest
Wenn die Suppe zu spät auf den Tisch kommt, wenn die Forelle zu lange gekocht hat, wenn der Wein nicht kalt genug ist, wenn ein Besuch, der eigentlich ganz gleichgültig ist, plötzlich absagt, wenn von den Winzigkeiten des irdischen Lebens irgendetwas anders wird, als er gehofft und geträumt hat, dann verliert er die Geduld, obwohl er der angesehene, plaudernde, dichtende, musizierende Rechtsanwalt Samuel de Vries ist, der sich nun nach dem Tode des frommen Vaters Raphael de Vries nur noch S. de Vries nennt.
Trotzdem er eine hübsche Frau hat und einen begabten, aber schwächlichen Jungen, den kleinen Joe, überfällt ihn mit den wachsenden Jahren Melancholie und Unruhe. Seine schmalen weißen Hände, sein kokett zugeschnittener Spitzbart, seine Belesenheit und Interessiertheit haben ihn durch eine sorglos verhätschelte Jugend geführt. Er war für die Eltern immer der Beste, der Einzige, der Intelligenteste gewesen. Er hatte es verstanden, sich eine bürgerliche Position zu schaffen, wie sie nur wenig Juden besaßen. Es war die Zeit, in der es zu beweisen galt, dass man eigentlich gar nicht anders sei als die Nichtjuden. S. de Vries begründete in einer süddeutschen Universitätsstadt eine Studentenverbindung, die es darauf anlegte, genauso zu trinken, genauso sich zu duellieren und zu randalieren wie die rein christlichen Burschenschaften und Korps.
Frömmigkeit war im Hause de Vries traditionell und selbstverständlich. Der Name des großen Rabbiners Isaak de Vries in Amsterdam verpflichtete Söhne und Enkel.
Raphael de Vries war ein schlechter Kaufmann und ein guter, wohltätiger Mensch gewesen. An seinem Sarge trauerten die Armen um ihren Beschützer und Freund. Raphael de Vries starb in dem Glauben, dass sein Sohn Samuel ein frommer und gottesfürchtiger Mann sei. Die letzte Stunde seines Lebens war die erste seines Enkels, den er Joseph zu nennen wünschte, der aber Joe genannt wurde.
Heute, an dem heiligen und höchsten Tage, stand der kleine Joe mit seinem Vater in der Synagoge, auf dem Platz, auf dem schon der Großvater gebetet hatte, täglich morgens und abends, jahraus, jahrein. Für S. de Vries war es nur noch eine lästige Pflicht. Er war ein aufgeklärter Mensch, für ihn war das Gebot des Sinai verweht und verschollen. Wenn er den kleinen Joe noch im traditionellen Sinn erzog, dann geschah es aus einer Art Feigheit und in dem Bewusstsein, es seinem Familiennamen schuldig zu sein.
Der kleine Joe war sehr aufgeregt. Er stand erwartungsvoll in der Vorhalle der Synagoge und ließ die ermatteten Menschen an sich vorüberziehen. In Zylindern und schwarzen Mänteln, mit dem sorgfältig eingepackten Gebetbuche unterm Arm, strömte es auf die Bergstraße und Rote Reihe. Equipagen standen wartend mit unruhigen Pferden vor der Synagoge. Man hatte seit dem Vorabend sich kasteit, nichts gegessen und getrunken, kein Labsal dem Körper zugeführt, dagesessen und gestanden in Sterbekleidern und gebetet und gesungen, um Gott zu bewegen, Gerechtigkeit zu üben und Gnade. Nun war es entschieden, wer leben sollte und wer sterben, wer beglückt und wer erniedrigt würde im kommenden Jahr. Nichts konnte man tun, als sich ergeben und fromm sein, den Namen Gottes heiligen und im unscheinbarsten Geschehnis Gottes Allmächtigkeit preisen.
Das höchste Fest war vorüber, soeben hatte der Schofarton, von den zitternden Lippen des alten Vorbeters geblasen, das Ende des furchtbaren und heiligsten Tages verkündet. Blass und überhungrig kamen die Frauen und Mädchen die Treppe herunter, die von dem Balkon führte, auf dem sie nach dem Gesetz abgesondert saßen.
Joe hatte zum ersten Male gefastet. Es war sein freier Wille gewesen, denn er war erst elf Jahre alt, und bis zu seiner Aufnahme in die Gemeinde, also noch zwei Jahre lang, wäre er von der Pflicht entbunden gewesen. Aber er wollte mittun, er wollte nicht mehr Kind sein und daneben stehen, wenn die Erwachsenen das taten, was seit Tausenden von Jahren Gebot war. Gewohnheit war es bei den meisten und eine dumpfe abergläubische Angst oder eine weichherzige konziliante Geste einer alten Mutter gegenüber oder die leere und verzweifelte Phrase "der Kinder wegen".
Rechtsanwalt de Vries konnte sich von allem frei machen, konnte an Gott zweifeln und verbotene Sachen essen, sich’s bei Hummer und Austern gut gehen lassen, aber am Versöhnungsfest nicht zu fasten, das brachte er nicht übers Herz.
Joe de Vries hatte am Nachmittag stark mit der Versuchung gekämpft, etwas zu essen, eine Kleinigkeit nur, Schokolade oder eine Krume Brot, denn er fühlte sich sehr schwach. Hunger konnte man es gewiss nicht nennen, es war mehr als Hunger. Ein Ausgehöhltsein, ein Leersein, ein unnennbares Schwächegefühl und eine Mattigkeit in den Knien. Dabei war ihm fröhlich ums Herz. Joe hörte süße Schubertmusik in sich, die "Rosamunde" mit ihrer hüpfenden, tanzenden Melodie, ein Geistermarsch, ein seliges Intermezzo voll Wohlklang und berauschendem Behagen.
Joe lebte völlig in der Musik, seine Tage und Nächte waren davon erfüllt. Meistens saß er am Klavier und legte seine noch immer kleinen Finger in die richtigen Tasten. Er konnte schon die Dammsche Klavierschule bis in die schwierigeren Kapitel bewältigen. "An Alexis" spielte er sogar mit seiner Mutter, die eine geringe, aber ausreichende Fingerfertigkeit besaß. Joe hatte von der Musik schon vieles kennengelernt. Die leichten Stücke von Bach und die Präludien spielte er mit zarter Empfindung. Der alte Klavierlehrer Klapproth, der ihn zweimal wöchentlich unterrichtete, hatte große Freude an dem aufmerksamen und begabten Schüler, Johanna de Vries war stolz und am stolzesten S. de Vries, der Vater, der in seinem Joe einen Wagner und Brahms vermutete.
Joe hatte mit dumpfem, schwerem Kopf den Tag überstanden. Seine Schwäche wurde ihm zum Genuss, zur feinsten, geistigsten Empfindung. Nun stand er da und wartete, dass der Wagen seines Vaters vorfahren würde. Er wurde freundlich von den Menschen angesprochen, man ehrte in ihm den Namen der Familie, sogar der kurzsichtige Rabbiner Seligmann sagte: "Na, kleiner Mann, hast du Hunger?" Mit Stolz erzählte Joe, dass er gefastet hätte.
Da kam auch Edith mit ihren Eltern und erkundigte sich teilnahmsvoll. "Das tust du nur aus Genusssucht, Joe, damit dir mal das Essen schmeckt", meinte sie. Aber Joe wurde ganz rot und sagte: "Am Essen liegt mir gar nichts, ich könnte meinetwegen noch einen Tag fasten." Das war nun Prahlerei, denn im Grunde freute sich Joe ganz unbeschreiblich auf das Essen.
Wie herrlich wurde das auch vorbereitet! Man setzte sich nicht einfach zu üppigem Mahle, nein, man trank zuerst ganz starken Kaffee mit reiner Sahne, aß dazu frische Mohnbrötchen, mit Butter dick bestrichen, die nach Heu und Wiese duftete, dann pausierte man eine gute halbe Stunde, bis das eigentliche Abendessen kam, das aus Suppe, Braten, Gemüse und Nachtisch bestand. Dazu trank man leichten Rotwein, natürlich für Joe mit Wasser vermischt. An diese Herrlichkeiten dachte er, an die Genüsse des Magens, und war erfüllt von dem Gefühl, ein erwachsener Mann zu sein.
Johanna de Vries kam endlich und umarmte ihren Sohn, dann löste sich der Rechtsanwalt de Vries aus einer Gruppe von Männern, mit denen er Gemeindeangelegenheiten besprochen hatte. Er war trotz seiner inneren Abtrünnigkeit noch in der Gemeinde tätig und dort als glänzender Redner beliebt und bekannt.
Die Equipage des Rechtsanwalts de Vries war vorgefahren, der Kutscher Karl Appenroth legte grüßend die Hand an den Zylinder. "Na, Karl, wie geht’s", sagte der Rechtsanwalt wohlwollend, als er als letzter in den Wagen stieg. — "Danke, Herr Doktor, ich hab ja mein Essen binnen."
Johanna liebte die joviale Art ihres Mannes gar nicht. Sie fand das unschicklich, aber was sollte sie machen? Sie musste leiden und dulden, und darin war sie Meisterin. Die Ehe hatte sie gelehrt, auf manches zu verzichten, das sie früher als selbstverständlich genommen hatte, als sie noch zu Hause war. Sie stammte aus einer jener seltsamen Judenfamilien, die man besonders in Hamburg trifft, deren Töchter eine eigentümlich mongolisch-japanische Gesichtsform haben.
Sie hatte eine große Mitgift gehabt. Ihre Eltern waren sehr fromm gewesen, ihr Vater war Ruben Lewinsky, der in Hamburg zu den größten Grundstücksmaklern gehörte. Der alte Lewinsky war schon über sechzig. Die Mutter starb, als Johanna zehn Jahre alt war.
Der Wagen fuhr die Bäckerstraße entlang bis zur Goethestraße, an altertümlichen Häusern vorbei. Es war dies Althannover, ein verarmter und schmutziger Stadtteil, einstmals stolzer Mittelpunkt städtischen Lebens. Man fuhr am Clevertor vorbei durch die Brühlstraße über den Königsworther Platz. Das Wetter war herbstlich rau, es fing an zu regnen. S. de Vries war sehr aufgeräumt, er neckte den kleinen blassen Joe.
"Was gibt’s zuerst, Joe?"
"Kaffee."
"Und dann?"
"Ich weiß nicht... ach so... dann gibt’s gar nichts, und dann gibt es Suppe."
"Denk mal, Joe, wenn du nun langsam die Tasse an den Mund führst, und ganz langsam... ganz langsam läuft ein Schluck Kaffee dir in den Magen... kannst du dir das vorstellen?"
Joe lag an seine Mutter angelehnt, die sehr müde war und Kopfschmerzen hatte; er richtete sich auf, nahm seine letzte Kraft zusammen und sagte: "Ja, Vater... ich stelle es mir vor." Er lachte in sich hinein vor Freude.
Auf der Straße liefen alle Menschen so schnell. Es brannte Licht in den Geschäften, es war ja für die andern Alltag. Die Straßenbahnen ließen ihre Glocken in einem fort tönen, es war viel los auf den Straßen. Joe war es ganz traumhaft zumute. Seit heute früh war er in der lichterglänzenden Synagoge gewesen. Mittags zwar hatte er ein paarmal nach draußen gehen dürfen, um frische Luft zu schöpfen, aber das war gar nicht so schön gewesen, da nachher die Luft in der Synagoge noch schlechter zu ertragen war.
An der Schlosswender Straße geschah es, dass ein Schlachterwagen in schnellem Tempo auf den Königsworther Platz fuhr und plötzlich vor dem die Straße kreuzenden Wagen haltmachen musste. Der Kutscher konnte das Pferd nicht mehr zum Stehen bringen, es rutschte auf dem Asphalt aus. Die Deichsel des Schlachterwagens drang durch die Scheiben des Wagens, in welchem der kleine Joe mit seinen Eltern saß.
Joe sagte im gleichen Augenblick: "Sieh mal, Vater … da klirrte Glas, ein Geschrei von Passanten, ein Fluchen, ein schreckliches Durcheinander entstand. Karl Appenroth wurde vom Bock gestoßen, der kleine Joe lag ohnmächtig auf dem Polster.
Der Rechtsanwalt und seine Frau waren unverletzt geblieben. Ein Schutzmann bemühte sich, Ordnung zu schaffen, die Menschen schrien und schimpften. Johanna kümmerte sich nur um ihren bewusstlosen Sohn, sie nahm ihn, irgendein gutmütiger Mann half ihr dabei und trug den bewusstlosen Jungen in das nahe Haus in der Parkstraße, wo die Räume festlich erleuchtet waren.
Der Rechtsanwalt musste erst die Formalitäten erledigen, dem Schutzmann Rede und Antwort stehen, bis er eiligst und verstört nach Hause lief, wo ein Arzt sich schon um den Verletzten bemühte. Außer einer Hautabschürfung an Arm und Brust war aber nichts Ernstliches festzustellen.
So endete der erste Fasttag des kleinen Joe.
Der Schüler de Vries
Joe war ein unruhiges, träumendes, kindisches und dann wieder ernsthaftaltkluges Geschöpf. Klein und mager, mit etwas zu großem Kopf und kurzgebissenen Nägeln, kurzsichtig und mit abstehenden Ohren behaftet. Eine ewig rutschende Stahlbrille auf sehr großer Nase, ein Judenjunge, ein "Miesnick", keine Schönheit.
Nur in der Musik lebend, wuchs er in seinen einsamen Stunden zu einer Größe auf, die nur ihm bewusst war. Allein abends in dunklem Zimmer phantasierte er von nicht gelebter Freude und nie erreichter Liebe, trauerte um nicht Geborenes, nicht Gewachsenes, tanzte vor fremden Gottheiten, vor märchenhaften Frauengestalten ...
Nach solchen Abenden war die Nacht tief und traumlos, der frühe Schulmorgen aber entsetzliche Marter. Schon das Auf stehen war eine Qual. Johanna de Vries musste drei- oder viermal ins Zimmer kommen, um den immer wieder einschlafenden Jungen wachzurütteln. Joe musste dann gewaltsam angezogen, gewaltsam an den Frühstückstisch gesetzt werden. Wie im Traum gelangte er in die Parkstraße, auf den Königsworther Platz, lief auf seinen kurzen Beinchen durch die Brühlstraße am Clevertor vorbei in die Goethestraße und kam immer ziemlich abgehetzt knapp vor dem Glockenschlag acht ins Gymnasium.
An der Ecke Clevertor und Goethestraße war ein Briefkasten, der im Leben des kleinen Joe eine Rolle gespielt hatte, als er an einem der ersten Schultage mit seinem Kopf in schmerzhafte Berührung kam. Blutend und ohnmächtig hoben ihn die Passanten auf und brachten ihn auf die Feuerwache zum Verbinden. Damals war Joe knapp sieben Jahre alt. Der Zusammenstoß mit dem Briefkasten bewahrte ihn vor einem halben Jahr Quälerei, denn man brachte den armen Joe nach seiner Genesung gleich in ein Nordseebad zur Erholung.
Am Clevertor war die Realschule mit den rüden und gewalttätigen Schülern dieser für einen Humanisten verabscheuungswürdigen Bildungsanstalt. Joe hatte aber einen Freund dort, Bernhard Tölle, der den armen Joe einmal vor Prügel bewahrt hatte. Diese Freundschaft war seltsam, denn es bestanden gar keine gemeinsamen Interessen zwischen Bernhard und Joe. Auch war der soziale Unterschied zu groß. Briefträgerssohn und Rechtsanwaltssprössling, da gab es eigentlich keine Brücken. Doch war das Zusammensein mit Berni immer erfrischend und vergnügt, ja, ab und zu durfte Berni ins Haus der Eltern kommen, in die schöne Villa in der Parkstraße. Aber Frau Johanna untersagte ihrem Sohn den Gegenbesuch.
Bernhard liebte Musik nur im Viervierteltakt, er war ein begeisterter Anhänger von Militärmärschen und bestimmte auch Joe, den Hohenfriedberger Marsch auswendig zu lernen. S. de Vries mochte Bernhard gern leiden, er gab ihm manchmal einige Zigarren für den "Herrn Papa". Dieser war stolz auf die vornehme Freundschaft seines Sohnes, und für Mutter Luise bedeutete sie geradezu Triumph und nahe Verwirklichung ihrer Dienstmädchenträume. Sie wünschte nichts sehnlicher, als einmal den Rechtsanwaltssohn in ihrem Hause zu sehen. Eine Stufe zu diesem Glück wurde erreicht, als eines schönen Tages, es war Sonntag, die Familie de Vries mit der Familie Tölle im Kirchröder Turm zusammentraf.
Langsam aus dem Hintergründe des Kaffeegartens herankommend, wuchsen Vater und Mutter Tölle in den Gesichtskreis der Familie de Vries. Da gab es kein Ausweichen, die Jungens begrüßten sich mit Hallo und Geschrei und die Erwachsenen mit Geziertheit und künstlicher Freude.
"Also... das sind deine Eltern?" sagte Johanna zu Berni, der in seinem frischgewaschenen Matrosenanzug ihr die Hand reichte und dazu einen Kratzfuß verübte, der geradezu hoffähig war. Während die Jungens sich der Spielwiese zu bewegten, ohne sich um die Verlegenheit der beiderseitigen Eltern zu kümmern, entwickelte sich mühsam eine Art Unterhaltung.
"Na... guten Tag... freut mich sehr, Sie kennenzulernen ... Ganz meinerseits, Herr Doktor. Wie geht es jetzt der Gesundheit Ihres Sohnes? Danke der Nachfrage, besser... ja die Schule... na, wird schon werden. Und Sie, Herr Tölle... haben Sie viel Dienst ... ja, es macht sich... so, so... ja, ja so... jawohl ... natürlich... hm ... Das Wetter ist gut... ja... na. Regen war ja genug... rauchen Sie? danke, sehr liebenswürdig."
Frau Johanna hatte ein falsches, etwas zu süßes Lächeln aufgesteckt. Ihr war die Begegnung einfach peinlich. Da hinten lorgnettierte Frau Isenstein lebhaft auf die Gruppe, und Johanna glaubte ihr spöttisches Lächeln zu sehen. Dabei war der Briefträger Emanuel Tölle in seiner prächtigen Uniform und überhaupt ein stattlicher Mann. Mutter Luises Blässe war erschreckend, sie hatte bestimmt etwas an der Niere.
Luise konnte sich an dem Foulardkleid der gnädigen Frau kaum satt sehen, ihr eigenes war nur bescheiden, schwarz mit weißen Tupfen. Und der Hut der Frau Rechtsanwalt war riesig groß, das war die letzte Mode, aber nur für die ganz feinen Leute.
Der Garten war gedrängt voll, man musste sich also beizeiten nach Plätzen umsehen. Wer wollte nun entscheiden, ob die Familien sich zusammensetzen sollten oder nicht? Die Briefträgersgattin war von dem Ereignis der Begegnung derart aus dem Gleichgewicht gebracht, dass die Theorie ihrer Gewandtheit im Verkehr mit den Vornehmen sie gänzlich im Stich ließ. Was nützte ihr im Augenblick die Erfahrung ihrer Dienstmädchenjahre, wo sie doch immer nur bei erstklassigen Herrschaften gedient hatte und daher genau wusste, was sich schickt. So zum Beispiel musste die Stimme immer etwas Beleidigtes und grundlos Gekränktes an sich haben. Gedehnt und geziert, ablehnend und doch verbindlich. "Tjaaöö .. Luise wäre vor Glück gestorben, wenn sie sich mit dem Rechtsanwaltsehepaar an einen Tisch hätte setzen können. Sie seufzte vor quälender Aufregung.
"Na... da wollen wir nicht länger stören", meinte Emanuel mit männlicher Entschlossenheit. Bierdurst raute ihm die Kehle, und überhaupt fand er es an der Zeit, sich zu verabschieden. Seine Meinung von der vornehmen Welt stand fest. Gott ja, es gab eben Arme und Reiche, aber vor allem gab es Militär und Zivil. Schließlich war ein Rechtsanwalt doch nur ein Zivilist.
Er konnte sich lebhaft ausmalen, was de Vries für ein schlapper Soldat geworden wäre, wenn er gedient hätte. Ja, wenn er gedient hätte! Darüber sprach man am besten nicht. Das Nichtgedienthaben war eine Krüppelhaftigkeit, die man nur mit dem Mantel der christlichen Nächstenliebe zudecken konnte.
Die Familien nahmen Abschied. Familie Tölle ging in den hinteren Garten, wo auch eine kleine Bierbude war, während Johanna in ihrem Foulardkleid der Terrasse zu rauschte. S. de Vries in einem dunkelblauen Anzug, hohem, steifem Kragen und einem kreisrunden Strohhut auf dem Kopfe folgte ihr. Der Schatten der Begegnung drückte etwas auf die Stimmung beider Familien. Dem Rechtsanwalt war es überall zu heiß, eigentlich wollte er auch noch Spazierengehen, und bei Tölles lagen dunkle Schatten auf dem Gemüt von Mutter Luise, die keinen rechten Lebensmut mehr hatte. Sie fühlte Schmerzen im Rücken und wusste, dass sie es nicht mehr lange machen würde.
Bernhard stopfte den mitgebrachten Topfkuchen in den Kaffee und war zufrieden. Vater Tölle blinzelte in die Sonne und stellte sich allerhand vor. Joe saß dösend auf seinem Stuhl vor einem Glas Milch, er nahm ab und zu ein paar Schluck und war sehr abwesend. Er hörte Musik, immer spielte ihm eine himmlische Musik auf und beglückte ihn.
Leider auch in der Schule, wo er unter den Lehrern nicht viel Freunde hatte. Er war immer "Pluck". So nannte man den schlechtesten Schüler, der schandehalber auf der vordersten, also letzten Bank am letzten Platz saß. Joe döste auch in der Schule.
Mit Direktor Fettköter hatte er es ganz verdorben, ja, es hätte kürzlich ein trauriges Ende genommen, Karzer oder, schlimmer noch, Relegation aus der Schule wären ihm sicher gewesen, wenn nicht ein einziger unter den Lehrern, der Knabenlehrer Fritz Jünger, ein Machtwort gesprochen hätte.
"Der Schüler de Vries", so sagte der Lehrer Jünger, "ist so geartet, dass er für die Tat nicht verantwortlich gemacht werden kann." Das kann man nun auffassen, wie man will. Direktor Fettköter beruhigte sich nur, indem er den geistigen Schwachsinn des Schülers de Vries als Tatsache feststellte. Wrampelmeyer aber, der Lateinlehrer, forderte härteste Bestrafung. Er strich seinen langen, zornig abstehenden Bart und schnaubte: "Exemplarische Strafe ... Herausschneiden der Pestbeule..." und ähnlich fürchterliches Zeug. Der Tatbestand war folgender: Der Schüler de Vries hatte eine Arbeit, ein französisches Extemporale, mit einer Randzeichnung versehen, die unzweideutig die Figur und die Erscheinung des allseitig verehrten Direktors Woldemar Fettköter trug. Fettköter unterrichtete die Klasse im Französischen und musste mit eigenen Augen in der an und für sich schon fehlerhaften Arbeit des Schülers de Vries am Rande der zweiten Seite, dort, wo er die Fehlerbezeichnungen mit blutig roter Tinte anbringen wollte, sein Konterfei erblicken. Woldemar Fettköter glaubte vom Schlag gerührt zu werden, als er das Heft aufschlug.
Es war in seiner Wohnung am Warmbüchenkamp an einem kalten Winternachmittag. Frau Hermine hatte versprochen, für den Abend Puffer mit Bickbeeren zu backen, schöne knusprige Puffer, das stimmte Woldemar versöhnlich. Aber was wollten die knusprigsten Puffer bedeuten gegen dieses Bubenstück, gegen die Anpöbelung von Seiten des schlechtesten Schülers, des Quintaners de Vries.
Welche Verkennung menschlicher Ehre und Würde lag in dieser Wahnsinnstat!
Der dösende, schreibende Joe hatte in diesem Extemporale eine Zeichnung an den Rand des Schreibheftes gekritzelt. Wäre es irgend etwas gewesen: ein Haus, ein Tier, ein Baum oder vielleicht das Gesicht eines inbrünstig geliebten Musikers (etwa Wagners spitzkinniges Antlitz oder Beethovens Rundstirn mit der eigensinnig-tragischen Unterlippe), es wäre zwar eine grobe Ungehörigkeit gewesen, die härtesten Tadel verdient hätte, aber sie wäre vielleicht entschuldbar gewesen. Aber das dicke, schwammige, stoppelbärtige Gesicht Woldemar Fettköters, des Direktors des königlichen Gymnasiums, im Profil zu zeichnen, es auf ein kurzes, dickes Untergestell zu setzen mit schlotterigten Hosen und krummen Beinen, dies zu tun und es noch dem Porträtierten abzuliefern im Vertrauen auf Gottes Hilfe oder auf einen Zufall, das war Verblendung oder plötzlicher Irrsinn.
Gänzlich unfassbar war bei diesem kindischen Machwerk, dass auf dem Haupte des Lehrers eine Narrenkappe thronte, mit Liebe gezeichnet, mit kleinen Glöckchen und Tschindara. Sicher erklangen in Joe Papagenoliedchen und heiterste Mozartmusik, dass er sie zeichnete, sicher war er sehr glücklich darüber gewesen, und er lieferte die Arbeit mit dem Bedauern eines Künstlers ab, der sein Kunstwerk nur ungern der Menge überantwortet.
Joe hatte an diesen Streich drei Tage lang nicht mehr gedacht, bis eines Morgens der Direktor plötzlich in die Botanikstunde hereinbrauste, die Fritz Jünger abhielt. Donner und Blitz durchzuckte das Klassenzimmer, Funken stoben um den Kopf des armen Joe, um den das blaue Heft wirbelte. Fettköters Bauch wogte vor seinen erschrockenen Augen, er verstand und begriff nichts, man trampelte auf seinen Ohren herum, marterte seine arme Seele, er war Opfer und nicht Täter.
"Du verlässt sofort die Klasse... nach Hause... du Verbrecher... du Spitzbube... du Lump...!" So und ähnlich umdonnerte der Zorn des beleidigten Schuloberhauptes den fassungslosen Joe de Vries, der in unstillbares Weinen ausbrach.
Nur dem gütigen Zureden Fritz Jüngers war es zu verdanken, dass Joe bis zum Entscheid der Lehrerkonferenz die Schule weiterbesuchen durfte. Vater de Vries erschien sofort beim Direktor, versprach Strafe und Besserung, und so glätteten sich die Wogen rasch.
Fritz Jünger war und blieb Joes einziger Freund, und dieser seltene Mann verdient näher betrachtet zu werden.
Der Knabenlehrer Jünger
Der Lehrer Fritz Jünger lebte seine irdischen Tage in Hannover. Sie sind ein Teil der Ewigkeit, in der er fortleben wird im Gedächtnis von Generationen.
Sein Herz schlug unter einem Jägerhemd und unter einer grauen gestrickten Weste fünfundsechzig Jahre lang. Es war störrisch und unberechenbar, es schlug gelassen in Augenblicken des Schicksals und galoppierte bei geringfügigen Anlässen. Fritz Jünger war ein Mensch und wurde ein Begriff.
Sein Name erheitert heute noch bärtige Männer und gibt ihnen Anlass zu fröhlicher Erinnerung. Die Geschichten von ihm und um ihn sind ungezählt, immer neue kommen hinzu, manche sind wohl erfunden, aber alle sind im tiefsten Grunde wahr.





























