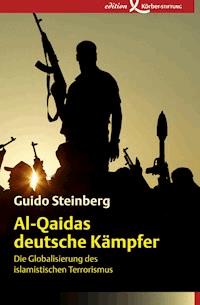9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Wann immer in der Welt islamistische Terroristen ihr Unheil anrichten, ist Guido Steinbergs Einschätzung gefragt. In seinem Buch erklärt der renommierte Terrorexperte die derzeit gefürchtetste islamistische Organisation – IS oder Islamischer Staat. Sie kam scheinbar aus dem Nichts und versetzte innerhalb kürzester Zeit eine ganze Region in Angst und Schrecken. Und mit der Enthauptung von Geiseln vor laufenden Kameras fordert sie den Westen heraus. Doch sind unsere Staaten überhaupt in der Lage, die von IS drohenden Übergriffe und Terroranschläge wirksam abzuwehren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Ähnliche
Guido Steinberg
Kalifat des Schreckens
IS und die Bedrohung durch den islamistischen Terror
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Für meinen Lehrer George Farah (†) und meine syrischen Freunde
Vorwort
Als Einheiten der Terrororganisation ISIS im Juni 2014 die nordirakische Stadt Mossul einnahmen, überraschte dies Politik, Medien und Wissenschaft in Deutschland insgesamt. Es schien allzu abenteuerlich, dass es einer terroristischen Organisation von einigen tausend Mann gelingen könnte, eine irakische Millionenstadt und weite Teile des Nordens und Westens des Landes zu erobern. Doch geschah genau dies, denn der ISIS/IS profitierte, so wie die meisten terroristischen Organisationen, von den Fehlern seiner Gegner. Im Falle des Irak war der Schuldige vor allem die von schiitischen Hardlinern dominierte Regierung des Ministerpräsidenten Nuri al-Maliki, die seit 2011 alles getan hatte, um die Sunniten und (von vielen Sunniten gewählten) Säkularisten von der Macht in Bagdad fernzuhalten. Eine regelrechte Verfolgungswelle gegen sunnitische und säkularistische Politiker und sonstige Gegner der Regierung hatte die meisten Sunniten überzeugt, dass sie im Irak von heute keine Zukunft mehr haben. Als der IS dann zu seiner großen Sommeroffensive 2014 ansetzte, war kaum ein Sunnit bereit, sich den Dschihadisten entgegenzustellen und den bestehenden irakischen Staat zu verteidigen. Jahrelang hatte die US-Regierung ihre irakischen Verbündeten zu überzeugen versucht, dass diese Politik in die Katastrophe führen werde, fand aber kein Gehör.
In Deutschland erregten die Ereignisse großes Interesse, so groß und anhaltend wie kein nahostpolitisches Ereignis mehr seit dem Irak-Krieg von 2003. Zusammen mit der Krise in der Ukraine und in den europäisch-russischen Beziehungen trug der Vormarsch des IS dazu bei, dass viele Deutsche sich bewusster wurden, wie unsicher die Welt bereits nicht allzu weit jenseits der deutschen und europäischen Grenzen geworden ist und dass uns die Ereignisse im Irak direkt angehen. Immerhin ist das Land der unmittelbare Nachbar des NATO-Partners und EU-Beitrittskandidaten Türkei, ziehen die Flüchtlinge aus dem Irak und Syrien nach Europa und Deutschland und haben sich mehr deutsche Dschihadisten als je zuvor den Terroristen angeschlossen. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass die deutsche Politik den Irak vor 2014 elf lange Jahre so wenig beachtet hat, nachdem das Regime Saddam Husseins von den USA und Großbritannien gestürzt worden war. Dies war umso problematischer, als der Irak zumindest potenziell einer der größten Ölproduzenten und damit für die Weltenergieversorgung enorm wichtig ist. Will Deutschland künftigen Krisen in seiner Nachbarschaft frühzeitig begegnen, muss es im Irak, im Nahen Osten insgesamt und in Nordafrika eine weitsichtigere, aktivere und vielleicht auch robustere Politik führen.
Dieses Buch soll dazu beitragen, eine klarere Sicht auf die Ereignisse im Irak und Syrien und vor allem auf die Organisation IS zu gewinnen. Denn obwohl der Sturm auf Mossul überraschte, war die Terrorgruppe seit 2002 bekannt und hatte unter den Namen »at-Tauhid«, »at-Tauhid wa-l-Dschihad«, »al-Qaida in Mesopotamien«, »Islamischer Staat im Irak« (ISI) und zuletzt »Islamischer Staat im Irak und Syrien« (ISIS) immer wieder fürchterliche Gewalttaten verübt. Seit 2010 war der ISI kontinuierlich erstarkt und hatte nicht nur immer mehr Anschläge mit immer höheren Opferzahlen verübt, sondern war auch zahlenmäßig angewachsen. So hatte er schon Ende 2013 die Stadt Falludscha eingenommen und seitdem nicht mehr aufgegeben. Jeder, der sich mit den Ursachen dieser Entwicklung befasst und die Ursprünge des IS, die Lebensläufe seiner Führer, seine antischiitische Ideologie, seine Bürgerkriegs- und Chaosstrategie und seine brutalen Gewalttaten und die multinationale Herkunft seiner Kämpfer bis zu den frühen Tagen der Organisation in einem kleinen Trainingscamp im afghanischen Herat im Jahr 2000 zurückverfolgt, wird besser verstehen, wie es dem IS 2014 gelingen konnte, zu einem der wichtigsten Probleme der Weltpolitik zu werden.
Dieses Buch ist das Ergebnis langjähriger Arbeit, und viele haben durch ihre Informationen, ihre Diskussionsbereitschaft und Hinweise auf Quellen und Literatur dazu beigetragen, meine Sicht auf die irakischen und syrischen Dschihadisten zu schärfen. Genannt werden soll hier vor allem Yassin Musharbash, der den IS und al-Qaida kennt und versteht wie sonst kaum einer in Deutschland. Ähnliches gilt für Nicole Renvert und ihre lange USA-Erfahrung, sie hat mit mir immer wieder die US-amerikanische Politik diskutiert. Karim Hafez hat bei der Suche nach arabischen Quellen und ihrer Auswertung geholfen. Doch ein Buch ist weit mehr als sein Inhalt, und Ilka Heinemann von Droemer Knaur und Leslie Gardner und Darryl Samaraweera von Artellus haben es möglich gemacht. Besonderer Dank gilt Sabine Wünsch für ihre sorgsame Lektorierung des Manuskripts.
Prolog:Der Kalif von Mossul
Anfang Juli 2014 erschien auf dschihadistischen Webseiten ein aufsehenerregendes Video einer Rede Abu Bakr al-Baghdadis in einer bekannten Moschee in der nordirakischen Stadt Mossul. In dieser Rede rief sich der Anführer der Terrororganisation »Islamischer Staat im Irak und Syrien« (ISIS) selbst zum Kalifen aus. Seine Organisation, so Baghdadi, heiße von jetzt ab nur noch »Islamischer Staat« (IS), denn er, der Kalif, sei nicht nur der rechtmäßige Herrscher des Irak und Syriens, sondern aller muslimischen Länder weltweit.
Der Auftritt am 4. Juli war eine Sensation, nicht nur, weil sich der bisher im Untergrund operierende Baghdadi hier zum ersten Mal öffentlich zeigte, sondern auch, weil sein Anspruch auf den Kalifentitel so absurd zu sein schien. »Kalif« bezeichnet den Nachfolger des Propheten Mohammed als Oberhaupt aller Muslime und war zuletzt – bis zum Jahr 1924 – vom mächtigen Osmanensultan Abdülmecid II. in Konstantinopel geführt worden. Kalif Ibrahim – wie sich Baghdadi nun nennen ließ – befehligte hingegen nur eine Terrororganisation von einigen tausend Mann. Dieser Schwäche dürfte Baghdadi sich bewusst gewesen sein, denn in einer Tonbandbotschaft, die kurz nach seinem Auftritt erschien und in der er seinen Schritt erläuterte, sagte er:
»Die Muslime wurden besiegt, nachdem ihr Kalifat gestürzt war; anschließend verschwand auch ihr Staat. Die Ungläubigen schafften es, die Muslime zu erniedrigen und zu schwächen und überall die Herrschaft über sie zu übernehmen, ihre Güter und Bodenschätze zu rauben und ihre Rechte zu stehlen. Dies geschah, indem die Ungläubigen sie mit Kriegen überzogen, ihre Länder besetzten und verräterische Agenten als Herrscher einsetzten, die die Muslime mit Feuer und Schwert beherrschten und betrügerische und wohlklingende Parolen verbreiteten wie Zivilisation, Frieden, Koexistenz, Freiheit, Demokratie, Säkularismus, Baathismus, Nationalismus und Vaterlandsliebe … Diese Herrscher bemühen sich weiterhin darum, die Muslime zu versklaven und sie mit diesen Parolen von ihrer Religion abzubringen, mit dem Ergebnis, dass die Muslime sich entweder vom Islam abwenden und zu Ungläubigen werden … oder unterdrückt, bekriegt und vertrieben werden, getötet, inhaftiert und brutal gefoltert werden, nachdem man ihnen vorgeworfen hat, Terroristen zu sein.«[1]
Der »Islamische Staat« und das Kalifat sollten nun ein neues Zeitalter einläuten, in dem die Muslime zurück zu alter Größe finden würden:
»Frohlocket und erwartet Gutes und erhebet Eure Häupter. Denn Ihr habt heute dank der Huld Gottes einen Staat und ein Kalifat, das Eure Würde und Eure Größe wiederherstellt und Eure Rechte und Eure Souveränität zurückgewinnt. Ein Staat, in dem der Perser und der Araber, der Weiße und der Schwarze, der Orientale und der Westler gemeinsam als Brüder leben. Ein Kalifat, das den Kaukasier, den Inder und den Chinesen, den Syrer, Iraker und Jemeniten, den Ägypter, Marokkaner und Amerikaner, den Franzosen, Deutschen und den Australier vereint. Gott versöhnte sie miteinander, und sie wurden Brüder, die einander für Gott lieben und die in einem Schützengraben stehen, wo sie einander verteidigen und beschützen und sich füreinander opfern. Ihr Blut wurde unter einer Flagge und einem gemeinsamen Ziel und in einem Heerlager eins, und sie genießen diesen Segen, den Segen der Bruderschaft im Glauben, der, wenn die Könige nur seinen Geschmack schmeckten, sie ihre Königreiche verließen und um diesen Segen kämpften. Und Dank sei Gott.«[2]
Voraussetzung sei jedoch, dass die (wahren) Muslime in das Land des Islam im Irak und Syrien auswanderten, um dort gegen die Feinde des Glaubens zu kämpfen:
»O Ihr Muslime, kommt also rasch in Euren Staat, ja Euren Staat. Kommt rasch zu ihm. Denn Syrien gehört nicht den Syrern, der Irak gehört nicht den Irakern, sondern die Erde gehört Gott allein, der sie demjenigen unter seinen Dienern zum Erbe gibt, den er auserwählt … Dieser Staat ist der Staat der Muslime, die Erde die Erde der Muslime, aller Muslime. O Ihr Muslime, wo immer Ihr auch seid, wer in den islamischen Staat auswandern kann, der soll dies tun, denn die Auswanderung in das Haus des Islam ist eine Pflicht.«[3]
So grotesk der Auftritt Baghdadis in schwarzem Turban, schwarzem Gewand und mit langem schwarz-grauem Bart auf viele Beobachter auch wirkte, so spiegelte er doch das große Selbstbewusstsein des Irakers und seiner Organisation wider, das auf die spektakulären Erfolge von ISIS in den Monaten zuvor zurückging. Seit April 2013 war ISIS offen im benachbarten Syrien aufgetreten und hatte dort die Kontrolle über weite Teile des Ostens und Nordens erlangt. Im Irak war es den Truppen Baghdadis Ende 2013 gelungen, ihre alte Hochburg Falludscha einzunehmen und gegen wütende Angriffe der Regierungstruppen zu halten. Anfang Juni 2014 eroberten Einheiten des ISIS die Millionenstadt Mossul im Nordirak und schienen sogar die Hauptstadt Bagdad zu bedrohen. Als Baghdadi das Kalifat ausrief, herrschte seine Organisation schon über weite Teile des Nord- und Westirak ebenso wie über die angrenzenden Teile Syriens; die fast hundert Jahre alte Grenze zwischen den beiden Ländern wurde Makulatur. Die oft belächelte Behauptung Baghdadis, einen eigenen »islamischen Staat« zu beherrschen, klang jetzt nicht mehr ganz abwegig.
Es zeigte sich schnell, dass viele Dschihadisten aus aller Welt seiner Propaganda glaubten. Bereits 2013 waren zahlreiche ausländische Kämpfer zu ISIS übergelaufen, und seit Mitte 2012 waren mindestens 15000 Ausländer nach Syrien gereist, um den bedrängten Muslimen in ihrem Kampf gegen den Tyrannen Bashar al-Assad zur Seite zu stehen. Saudi-Araber, Marokkaner und Tunesier stellten die größten Gruppen, doch auch Türken, Jordanier, Libyer und zahlreiche Kaukasier waren vertreten. Besonders erschreckend war die hohe Zahl der Europäer: Bis Ende 2014 waren mehr als 3000 nach Syrien gezogen, unter ihnen mindestens 550 Deutsche. Obwohl die ausländischen Freiwilligen die Wahl zwischen zahlreichen Rebellengruppen hatten, schlossen sich die meisten dem IS an und machten die Organisation des Möchtegernkalifen so zur vielleicht stärksten Dschihadistengruppe überhaupt.
Der rasche und für viele unerwartete Aufstieg des IS führte zu einem Konflikt mit der mächtigen al-Qaida, die seit den Anschlägen des 11. September 2001 die führende dschihadistische Organisation gewesen war, doch 2014 nur mehr ein Schatten ihrer selbst war. Seit dem Tod Osama Bin Ladens in Abbottabad 2011 führte sein ehemaliger Vize Aiman az-Zawahiri die Geschäfte der Terrororganisation. Wenig charismatisch und bei vielen Anhängern umstritten, gelang es dem Ägypter nicht, das Al-Qaida-Netzwerk von seinem Versteck irgendwo in Pakistan aus zu kontrollieren. Dies zeigte sich besonders schmerzlich am Fall des IS, der 2004 durch einen Treueeid seines damaligen Führers Abu Musab az-Zarqawi formal zur offiziellen Al-Qaida-Filiale im Irak geworden war. Die Ausrufung des Kalifats bedeutete nichts anderes, als dass Baghdadi nicht bereit war, sich Zawahiri unterzuordnen, dass er vielmehr die Führung der Dschihadisten weltweit übernehmen wollte. Vor allem der Zustrom von ausländischen Kämpfern machte klar, dass ihm dies gelingen könnte.
Die Proklamation des Kalifats und des »Islamischen Staates« könnte so zu einem Epochendatum für den islamistischen Terrorismus werden und den endgültigen Niedergang von al-Qaida einläuten – die jedoch von dem noch kompromissloseren, fanatischeren und brutaleren IS abgelöst würde. Inwieweit es Baghdadi und seinen Mitstreitern gelingt, an die Stelle von al-Qaida zu treten und zu einer ernsthaften Bedrohung für die westliche Welt zu werden, wird sich vor allem im Irak und Syrien entscheiden. Sollte der IS in der Lage sein, sich auf Jahre hinaus in den heute von ihm kontrollierten Gebieten und Städten festzusetzen, könnte die Wachablösung tatsächlich gelingen und IS zur gefährlichsten Terrororganisation weltweit werden. Ende 2014 wiesen alle Indizien darauf hin, dass es lange dauern dürfte, IS aus seinen Hauptstädten Mossul und Raqqa zu vertreiben und den irakischen und den syrischen Staat – in welcher Form auch immer – zu stabilisieren.
Dies ist ein besonders erstaunlicher Befund, wenn man bedenkt, dass der erste Vorläufer des IS erst im Jahr 2000 gegründet wurde. Als der jordanische Terrorist Abu Musab az-Zarqawi mit einer Handvoll Getreuer nahe der afghanischen Stadt Herat ein Trainingslager gründete, konnte niemand voraussehen, dass die Truppe seines Nachfolgers Baghdadi nur vierzehn Jahre später die Weltpolitik erschüttern würde.
1Eine neue Terrororganisation: Die Gründung durch Abu Musab az-Zarqawi
Es waren erstaunliche Details über die Frühgeschichte des IS, die der Al-Qaida-Militärchef Saif al-Adl im Juni 2005 in einem offenen Brief erzählte, der schnell die Runde in allen dschihadistischen Internetforen machte. Der Ägypter berichtete, dass Abu Musab az-Zarqawi im Jahr 2000 mit nur vier Gefährten aufbrach, um bei Herat ein Trainingscamp für eine eigene, von al-Qaida unabhängige Gruppierung zu errichten. Saif al-Adl hatte die kleine Truppe im Auftrag Bin Ladens in den afghanischen Westen begleitet und ihr jede nur mögliche Unterstützung zugesagt. Dennoch dürfte die Zuversicht seiner Beschreibung eher seine Sicht des Jahres 2005 als seine Gedanken Anfang 2000 widerspiegeln, denn er schrieb:
»Wir verließen Abu Musab und seine Gefährten Khalid [al-Aruri] und Abd al-Hadi [Daghlas] und die [zwei] syrischen Brüder. Wir waren überzeugt, dass sie mit ihrem Projekt außerordentlich großen Erfolg haben würden, denn sie alle waren von großer Entschlossenheit, die allein es schaffen kann, Berge zu versetzen.«[4]
Der sich anschließende Bericht über erste Verstärkungen vermittelte jedenfalls nicht den Eindruck, es mit einer Kraft der Zukunft zu tun zu haben:
»Wir fanden, dass die beiden syrischen Familien, die nach Herat gekommen waren, aus 13 Personen bestanden. Darunter der Familienvater und drei Jugendliche älter als 16 Jahre, zwei Frauen und sechs Mädchen. Hiermit betrug die Zahl der Araber in Herat 18 Personen.«[5]
Zwar sollen Zarqawi und seine Gefährten laut Saif al-Adl geglaubt haben, dass Hunderte Gesinnungsgenossen aus Jordanien und den Nachbarländern sich ihnen anschließen würden, und tatsächlich wuchs die Kämpferzahl in den kommenden Monaten auf einige Dutzend an. Dennoch gab es damals keinen nachvollziehbaren Grund zu glauben, dass aus dieser kleinen Schar innerhalb von nur vier Jahren eine der stärksten terroristischen Organisationen weltweit werden würde. Noch weniger zeichnete sich ab, dass der spätere IS nach einem spektakulären Comeback im Sommer 2014 weite Teile des Irak und Syriens kontrollieren und zu einem der Hauptthemen der Weltpolitik werden würde.
Dass die kleine syrisch-jordanische Gruppe schnell wachsen konnte, lag vor allem an ihrem Anführer. Abu Musab az-Zarqawis Ziel war der Sturz der Monarchie in Jordanien und die »Befreiung« Jerusalems von den Israelis, und zu diesem Zweck wollte er eine Gruppierung aufbauen, die nicht nur aus Jordaniern und Palästinensern, sondern auch aus Syrern, Libanesen und Irakern bestehen sollte. Diese Nationalitäten waren in der al-Qaida kaum vertreten, sodass Saif al-Adl und andere Führungspersönlichkeiten eine Chance sahen, als Zarqawi Ende 1999 in Afghanistan eintraf: Bin Laden hoffte, mit Hilfe von Zarqawi Anhänger im nördlichen fruchtbaren Halbmond zu gewinnen und langfristig an al-Qaida binden zu können, und unterstützte deshalb das Projekt. Er konnte nicht ahnen, dass er dabei half, den schärfsten Konkurrenten von al-Qaida um die Führung der dschihadistischen Bewegung aufzubauen.
Der neue Bin Laden
Der für die Geschichte Zarqawis, der irakischen al-Qaida und des IS wichtigste palästinensische Deportierte war Isam al-Barqawi alias Abu Muhammad al-Maqdisi, der lange der ideologische Mentor Zarqawis war und bis heute der vielleicht wichtigste religiöse Vordenker der dschihadistischen Bewegung ist. Maqdisi wurde 1959 in einem Dorf bei Nablus im palästinensischen Westjordanland geboren, wuchs aber in Kuwait auf und geriet gegen Ende der 1970er Jahre unter den Einfluss militanter Islamisten. Er brach ein naturwissenschaftliches Studium im irakischen Mossul ab und begab sich für zwei Jahre an die Islamische Universität von Medina, wo er sich intensiv mit dem Gedankengut der Wahhabiya befasste – derjenigen Reformbewegung, die weitgehend deckungsgleich mit dem heutigen Salafismus ist und eine der wichtigsten ideologischen Wurzeln des Dschihadismus bildet. Die wahhabitischen Einflüsse finden sich auch in seinem Hauptwerk, dem 1984 erschienenen Buch »Die Gemeinschaft Abrahams« (Millat Ibrahim), in dem er sich auf das angebliche Vorbild des Propheten Abrahams und einen Koranvers (60:4) bezieht, aus dem er das dschihadistische Konzept der »Loyalität (gegenüber dem einzigen Gott) und des Vermeidens von Polytheismus und seiner Anhänger« (arabisch kurz al-wala’ wa-l-bara’) ableitet. Demzufolge ist es die Pflicht des Gläubigen, den Unglauben vieler nomineller Muslime als solchen zu benennen und ihnen gegenüber eine offen feindselige Haltung einzunehmen.[6] Im Kern handelt es sich um eine religiöse Rechtfertigung für die Abgrenzung der Dschihadisten von ihrer Umwelt und für den Kampf gegen die nominell muslimischen Regime in der arabischen Welt. »Die Gemeinschaft Abrahams« hatte besonders großen Erfolg unter den arabischen Kämpfern in Afghanistan und Pakistan, wohin Maqdisi wie so viele saudi-arabische Studenten in den 1980er Jahren reiste und wo er einige Jahre verbrachte. Bis heute gilt das Buch als eines der Standardwerke des Dschihadismus, und es wird in den aktuellen Publikationen von IS immer wieder zitiert.
Der junge Abu Musab lernte Maqdisi im pakistanischen Peschawar kennen, wohin er im Jahr 1989 reiste, um sich am Kampf der Afghanen zu beteiligen. In den vorangegangenen Jahren war Zarqawi in seinem Heimatviertel in Zarqa Mitglied einer Jugendgang gewesen und vor keiner Auseinandersetzung zurückgeschreckt, was ihm den Ruf eines Schlägers einbrachte.[7] Er hatte die Schule abgebrochen, und in einigen Quellen ist von Alkoholmissbrauch und dem Vorwurf sexueller Belästigung die Rede. In einer Nachbarschaftsmoschee zum Salafismus bekehrt, schloss sich Zarqawi den jordanischen Afghanistankämpfern an und reiste nach Pakistan. Dort soll er als Korrespondent für die Zeitschrift Das festgefügte Band (al-Bunyan al-marsus) gearbeitet haben und knüpfte er seine ersten Kontakte zu Dschihadisten aus anderen arabischen Ländern. Wie so viele andere arabische Afghanistankämpfer kam er zwar erst am Hindukusch an, als die sowjetischen Truppen bereits abgezogen waren, doch soll er 1991 an der Einnahme der ostafghanischen Stadt Khost teilgenommen haben und auch bei dem Einmarsch der Aufständischen in Kabul im April 1992 beteiligt gewesen sein.
Nach seiner Rückkehr nach Jordanien 1992/93 begann Zarqawi seine dschihadistische Karriere. Gemeinsam mit Abu Muhammad al-Maqdisi gründete er die Tauhid-(Monotheismus)Gruppe, die später auch als Baiat al-Imam (Gefolgschaft des Imam) bekannt wurde. Sie legten kleine Waffenlager mit Handfeuerwaffen und Handgranaten an, mit denen sie zuerst trainieren und anschließend von Jordanien aus israelische Ziele angreifen wollten. Doch im März 1994 wurden sie, ebenso wie weitere Gruppenmitglieder, von den jordanischen Behörden verhaftet und zu fünfzehn Jahren Gefängnis verurteilt. Erst die folgenden fünf Jahre machten Zarqawi zu einem führenden jordanischen Dschihadisten.
Maqdisi war der erste Emir der Tauhid-Gruppe, aber er interessierte sich mehr für ideologische Fragen und seine Tätigkeit als dschihadistischer Schriftsteller als für alles Praktische. Der eher zur Tat neigende Zarqawi hingegen blieb zwar intellektuell und rhetorisch weit hinter seinem Mentor zurück, doch zeigte er im Gefängnis schnell seine Führungsqualitäten. Seiner Defizite schmerzlich bewusst, durchlief er eine intensive religiöse und ideologische Schulung und lernte den gesamten Koran auswendig. Dass er gefoltert wurde, nährte seinen Hass auf den jordanischen Staat und dessen Vertreter. Wild entschlossen, sich eines Tages zu rächen, profilierte er sich als Vertreter der dschihadistischen Gefangenen gegenüber der Gefängnisverwaltung, sodass Maqdisi ihm im Sommer 1996 die Führung der Gruppe übertrug und sich fortan auf seine Studien beschränkte. Schon Mitte der 1990er Jahre war Zarqawi so zu einer Führungsfigur für Hunderte jordanische Dschihadisten geworden, konnte wegen der gegen ihn verhängten Haftstrafe aber kaum hoffen, den bewaffneten Kampf in naher Zukunft aufnehmen zu können.[8]
Die Gelegenheit ergab sich überraschend, als Zarqawi und viele andere Islamisten im Februar 1999 anlässlich der Thronbesteigung von König Abdallah II. begnadigt wurden. Bereits Anfang 2000 fahndeten die jordanischen Behörden erneut nach ihm, weil sie vermuteten, er sei an der Planung von Anschlägen zum Jahrtausendwechsel in Jordanien beteiligt gewesen, doch zu diesem Zeitpunkt hatte sich Zarqawi bereits nach Pakistan abgesetzt. Dass er von dort überhaupt in das Al-Qaida-Hauptquartier im afghanischen Kandahar gelangte, war einem Zufall geschuldet. Eigentlich hatte der Jordanier wie so viele seiner Landsleute geplant, sich dem bewaffneten Kampf in Tschetschenien anzuschließen, aber bevor er seine Planungen abgeschlossen hatte, lief sein Visum aus, und er musste Pakistan rasch verlassen. Da ihn in Jordanien das Gefängnis erwartete, blieb ihm keine Wahl, als ins Nachbarland zu reisen und bei Bin Laden und Co. um Hilfe zu bitten.[9]
Die Hilfe wurde gewährt, und das kleine Trainingslager in Herat wuchs trotz der bescheidenen Anfänge schnell, denn al-Qaida half auch bei der Anreise jordanischer, palästinensischer und syrischer Kämpfer über den Iran. Unter den Jordaniern und den Palästinensern war Zarqawi seit seiner Zeit im Gefängnis zu (damals noch bescheidener) Prominenz gelangt, und die Nachricht von der Gründung einer Gruppe, die sich selbst »at-Tauhid« nannte – unter den Arabern Afghanistans aber auch als »Armee Groß-Syriens« (Dschund ash-Sham) bekannt wurde – und ein eigenes Trainingslager eröffnet hatte, verbreitete sich schnell. Schon nach kurzer Zeit soll die Zahl der waffenfähigen Bewohner des Camps auf über vierzig gestiegen sein. Ein weiteres Anwachsen der Organisation wurde jedoch durch den Beginn der amerikanischen Intervention in Afghanistan im Oktober 2001 und das schnelle Vorrücken der mit den USA verbündeten Nordallianz verhindert. Zarqawi und seine Gefolgsleute setzten sich zunächst nach Kandahar und anschließend nach Pakistan und Iran ab.
Die iranische Hauptstadt Teheran wurde für wenige Monate der neue Zufluchtsort Zarqawis und seiner Anhänger. Ihre Lage war schwierig, denn die iranische Führung zeigte keine Sympathien für die ungebetenen Gäste, und viele konnten nicht in ihr Heimatland zurückkehren, da dort nach ihnen gefahndet wurde. Der Jordanier versuchte, über Gefolgsleute in Europa neue Pässe zu besorgen, um seine Mitstreiter in Sicherheit zu bringen. Als iranische Sicherheitskräfte einige der Hotels stürmten, in denen Zarqawis Leute untergebracht waren, verhafteten sie 23 Mann – darunter mit Khalid al-Aruri (alias Abu al-Qassam) Zarqawis Stellvertreter – und damit einen Großteil der Mitglieder der jungen Organisation. Zarqawi selbst konnte sich dem Zugriff der Iraner entziehen und floh mit einigen Getreuen kurz darauf in den kurdischen Nordirak.[10]
Irakisch-Kurdistan hatte sich infolge des Kuwaitkrieges 1991 faktisch aus dem irakischen Staatsverband gelöst. Die beiden Kurdenführer Masud Barzani (der später Präsident Irakisch-Kurdistans werden sollte) und Dschalal Talabani (der 2005 bis 2014 als Präsident des Irak amtierte) beherrschten das Gebiet, das nur aufgrund des Schutzes der amerikanischen Luftwaffe – die im Nordirak seit 1992 eine Flugverbotszone für Kampfflugzeuge des Regimes von Saddam Hussein sicherte – eine immer gefährdete Autonomie bewahren konnte. Doch die kurdische Regierung war zerstritten und schwach, sodass es kurdischen Dschihadisten in einer kleinen Enklave in der südlichen Provinz Sulaimaniya gelang, die Macht zu übernehmen und sich der Angriffe der Talabani-Milizen zu erwehren. Es handelte sich um einige Dörfer in einer Bergregion in der Umgebung der Stadt Halabdscha direkt an der iranischen Grenze. Die kurdischen Dschihadisten nannten sich seit Dezember 2001 »Helfer des Islam« (Ansar al-Islam) und wurden für die nächsten Jahre die wichtigsten Verbündeten Zarqawis im Irak.[11] Im Verlauf des Jahres 2002 baute Zarqawi von diesem Refugium aus seine Organisation für den bevorstehenden Kampf im Irak um.
Noch im Oktober 2002 verübte die Zarqawi-Gruppe ihren ersten terroristischen Anschlag. Das Opfer war der US-Amerikaner Lawrence Foley, der in der jordanischen Hauptstadt Amman für die staatliche amerikanische Entwicklungshilfeorganisation Agency for International Development (USAID) arbeitete und Diplomatenstatus hatte. Die beiden Täter, ein Jordanier und ein Libyer, lauerten Foley morgens vor seinem Haus in der ruhigen Mittelschicht-Wohngegend Abdoun auf und erschossen ihn mit einer Pistole mit Schalldämpfer aus nächster Nähe. Der Mord war keine anspruchsvolle Operation, denn Foley war ein vollkommen wehrloser gesetzter Herr von sechzig Jahren, der auf dem Weg zu seinem Auto war und nicht beschützt wurde. Zunächst blieb unklar, zu welcher Organisation die Attentäter gehörten, denn es bekannte sich eine unbekannte Gruppe namens »die Edlen Jordaniens« (Shurafa al-Urdunn) verantwortlich, die als Motiv das amerikanische Blutvergießen im Irak und die Hilfe der USA für Israel nannte.[12] Nach ihrer Verhaftung gaben die Mörder jedoch an, im Auftrag Zarqawis gehandelt zu haben.
Auch der Anschlag auf Lawrence Foley ließ noch nicht vermuten, dass die Zarqawi-Gruppe innerhalb kurzer Zeit zu einer der gefährlichsten Terrororganisationen weltweit werden würde. Doch die Tat verunsicherte die große westliche Gemeinde in Amman, das bis dahin als sicherer Aufenthaltsort gegolten hatte, und der ungeklärte Mord an einem israelischen Geschäftsmann in demselben Viertel rund ein Jahr vorher erschien nun in einem anderen, bedrohlicheren Licht. Der Anschlag auf Foley war gleichsam eine terroristische Absichtserklärung: Zarqawi machte klar, dass seine Aktivitäten nicht nur seinem Heimatland galten, sondern dass er auch auf die USA und den Westen insgesamt abzielte. Noch aber fehlte ihm eine auch nur halbwegs sichere Basis, von der aus er diesen Kampf führen konnte.
Die Tauhid-Zelle in Deutschland
Nach dem Verlust des Stützpunktes in Afghanistan war Deutschland der wichtigste Brückenkopf der Zarqawi-Organisation. Nur wenige Monate vor dem Mord an Foley hatten die deutschen Behörden einen Anschlagsplan einer kleinen Schar palästinensischer Terroristen vereitelt, die zu Zarqawis Tauhid-Gruppe gehörten. Diese Deutschlandverbindung bestand bereits seit dem Jahr 2000 oder sogar noch länger. In seiner Darstellung der Frühgeschichte der at-Tauhid in Afghanistan schreibt Saif al-Adl von einer syrischen Familie, die aus Europa nach Herat kam. Der Al-Qaida-Militärchef führt aus:
»Nachdem er zwei Jahre in Herat gearbeitet und aufgebaut hatte, begann Abu Musab zu überlegen, ob er diejenigen Gefährten, denen er vertraute, in Regionen außerhalb Afghanistans schicken solle, damit sie dort Männer rekrutierten und Geld sammelten. Soweit ich mich erinnere, wurde der Anfang in der Türkei und in Deutschland gemacht, weil die syrischen Brüder, die zu ihm gestoßen waren, gute Beziehungen in beiden Ländern hatten.«[13]