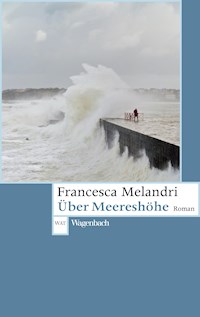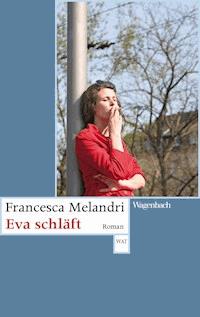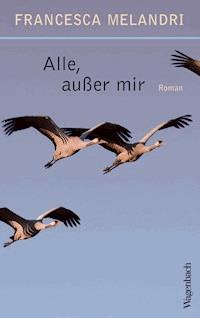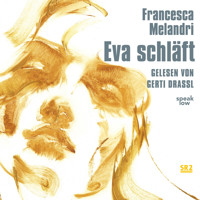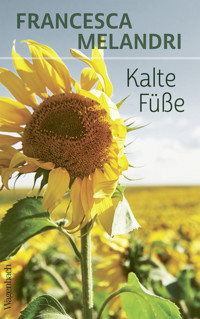
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Militärlazarett in Venedig. Desinfektionsmittel, Fieberschweiß, der unerträgliche Gestank von Wundbrand. Der Sohn liegt im hintersten Bett, er schläft. Die Mutter hebt die Decke am unteren Ende an. Zwei Beine, zwei Füße. Eins, zwei, drei, sie zählt die Zehen – bis zum zehnten. Vorsichtig legt sie die Decke zurück: Endlich kann sie in Ohnmacht fallen. Im Winter 1942/43 flohen italienische Soldaten in Schuhen mit Pappsohlen vor der Roten Armee, Zehntausende erfroren. Der »Rückzug aus Russland« hat sich als Trauma im kollektiven Gedächtnis Italiens eingebrannt – auch in der Familie von Francesca Melandri. Ihr Vater hat ihn überlebt. Doch erst als Anfang 2022 Bilder und Orte des Kriegs in der Ukraine omnipräsent sind, wird ihr klar: Es ist vor allem die Ukraine, in der der Vater gewesen ist. Was hat er dort wirklich erlebt, warum war er überhaupt dort? Francesca Melandris »Kalte Füße« ist ein berührendes Zwiegespräch mit einem geliebten Menschen: ein unerschrockenes Buch über das, was der Krieg gestern wie heute in Körpern und Köpfen anrichtet, über das Erzählen als Überlebenskunst – und unsere historische Pflicht angesichts des Angriffs auf die Ukraine, die Stille zum Sprechen zu bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Was bedeutet Krieg? Und was, wenn man auf der falschen Seite kämpft?
Francesca Melandri erzählt die Geschichte ihres eigenen Vaters – und bringt die Stille einer ganzen Generation zum Sprechen. Eine zutiefst persönliche Spurensuche der Autorin von Alle, außer mir: ein unerlässliches Buch zum Verständnis unserer Gegenwart.
»Francesca Melandri verwebt menschliche Schicksale meisterhaft mit der großen Geschichte Europas.«
Andrej Kurkow
FRANCESCA MELANDRI
Kalte Füße
Aus dem Italienischen von Esther Hansen
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
I GESCHICHTEN
Rettung
Füße
Spinat
Walenki
Nikita
Phrasen
Ungenauigkeit
Glück
II GESCHICHTE
Brot
Vox Populi
Spiegel
Besatzung
Plündern
III IDEEN
-ismen
Rot
Lehrerin
Sibirien
Kultur
IV KÖRPER
Vogel
Zeugen
Geschlecht
Schlaf
V ENTSCHEIDUNGEN
Pinon
Max
Zwiebel
VI BLICKE
Mapuche
Heldentum
Leider
Eitelkeit
VII VISIONEN
Ozean
Schreiben
Sturm
Anmerkungen und Danksagung
Für alle »irgendwelchen Irynas«
ihr dachtet und wir dachten, der Krieg
ist nicht bei uns, hat nichts mit uns zu tun, ist nicht hier,
ist ein Film, abends bei Popcorn und Bier,
ein Held wird gerettet, Soldat James Ryan, Fallschirmsprung
aus dem Düsenjäger,
doch dann stimmt das gar nicht,
eines Morgens stehst du auf, und er ist da
und der Krieg bist du
Iryna Schuwalowa, Ihr dachtet und wir dachten, der Krieg
Ich bin der Krieg, der mitten im Frieden wohnt,
in einer Welt, die nichts von Krieg versteht
und nur »zutiefst beunruhigt« ist.
Lida Zinko, Es ist nicht dein Krieg
Die Schreie der Kriegsparteien
hallen endlos durch die Nacht der Erde,
die anderen kommen verärgert hervor
und suchen über den weiten Ozeanen das Licht.
Die geboren werden und sterben,
hatten eine gesetzte Zeit
und sie zu verlängern
kehrten sie zurück und lauschten
oft den Schreien in der Nacht,
bevor sie die Kerze löschten,
streckten sie die Arme aus
und reichten sie brennend weiter
Franco Melandri, An Annas Hand
I GESCHICHTEN
Rettung
Ich glaube nicht, sagte ich, dass man sich vor der Realität retten kann.
An Annas Hand
Da sind sie, Papa, die Frauen, von denen du so oft erzählt hast, mit zunehmendem Alter immer mehr. Ich habe sie gesehen, deine Frauen, in der ersten Kriegswoche. In einem YouTube-Video, stell dir mal vor, YouTube kanntest du zu deinen Lebzeiten nicht einmal. Sie trugen Kapuzenjacken und Hausschuhe, diese mythischen Wesen, ohne die du nur ein Name in einem Beinhaus wärst – oder ein Name und sonst nichts –, ohne die es mich nicht gäbe. Es war das Video mit diesem russischen Soldaten, dünn, blass, unheimlich jung. Seine bleichen Wangen sind rotgefleckt, über der Teetasse in seiner Hand kondensiert der Wasserdampf, in der anderen hält er ein Stück Brot. Er wird von heftigem Schluchzen geschüttelt, hängt da wie ein nasser Lappen. Wenn er jetzt in sein Brot beißt, schießt es mir durch den Kopf, wird er sich verschlucken. Er ist der einzige Mann in dem Video, ein Kindersoldat. Um ihn herum Frauen, nur Frauen, deine berühmten Frauen, der Quell alles Guten, das dir widerfahren ist, nie hätte ich gedacht, ihnen hier zu begegnen, mehr als zehn Jahre nachdem du weitergegangen bist, wie ihr Alpini es nennt, und achtzig Jahre nachdem die Frauen dich gerettet haben. Eine von ihnen reicht dem Soldaten ihr Telefon und sagt in einem Tonfall, mit dem man einen Halbwüchsigen zurechtweisen würde, der seine Hausaufgaben vergessen hat: »Ruf deine Mutter an und sag ihr, dass du noch lebst.«
Dieses Video habe ich Anfang März 2022 gesehen. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine, besser gesagt: die »militärische Spezialoperation«, wie man diesem Jungen erklärt hatte, war seit etwa einer Woche in vollem Gange. Zur selben Zeit sperrten andernorts ein paar seiner Kameraden Alte, Frauen und Kinder in dunkle Kellergeschosse, wo viele vor Hunger und Kälte sterben sollten. Andere schossen mit Maschinengewehren wahllos auf Passanten, Radfahrer und Spaziergänger und ließen ihre Leichen wie Dreck auf der Straße zurück, wo sie wochenlang unbeerdigt liegen blieben. In dem Moment, als die Frau dem Jungen in Uniform spontan aus Mitleid ihr Mobiltelefon reichte, vergewaltigten andere Soldaten in der gleichen Uniform, aufgeputscht durch das von ihren Kommandeuren ausgegebene Viagra, Frauen, junge Mädchen, Kinder und mindestens einen Säugling; ein paar ließen die Soldaten danach wieder laufen, andere überrollten sie mit ihren Panzern. Doch das wussten zu diesem Zeitpunkt weder er noch die Frauen in Hausschuhen. Und auch ich wusste es nicht, als ich das Video sah. Niemand wusste es. Die wenigsten außerhalb der Ukraine hatten in jenen ersten Kriegstagen jemals von einem Ort namens Butscha gehört; wir hatten die Leichen auf den Straßen noch nicht gesehen, das Foto mit der schwarz verfärbten Hand, die einen Schlüsselanhänger in Form einer blauen Fahne mit gelben Sternen umklammert hält – unserer Fahne, der Fahne aller Europäer –, oder die andere totenschwarze Hand mit den rotlackierten Fingernägeln. Wir kannten die Satellitenaufnahmen von den Massengräbern am Stadtrand Mariupols noch nicht. Auch von Mariupol selbst hatten wir noch nie gehört, und erst als es zu spät war, erfuhren wir, dass es einmal eine schöne Stadt mit lebendigen Cafés entlang der Strandpromenade gewesen war.
Wir wussten noch nichts von der Folter, der die Russen bestimmte Gruppen von ukrainischen Gefangenen unterzogen – Schwulen, Aktivisten, Journalisten –, und wir waren noch nicht dazu übergangen, manche Zeitungsartikel nicht mehr zu Ende zu lesen, weil uns allein die Kenntnis gewisser Details schon zu Komplizen des Grauens machte. Der Kommandeur der russischen Streitkräfte Sergei Surowikin, auch bekannt als General Armageddon, hatte noch nicht bewiesen, wie gewissenhaft er die Methode der verbrannten Erde anzuwenden wusste, die er zuvor in Syrien perfektioniert hatte: Bombardements ganzer Wohnviertel, das Verminen von Kornfeldern, Einkaufszentren als Angriffsziele, Zerstörung der zivilen Infrastruktur, kurz: die Taktik der totalen Verwüstung, auch wenn das Heer keinen Meter vorankommt.
Die Kinderrechtsbeauftragte im Büro des Präsidenten der Russischen Föderation – so ihr Titel – hatte sich noch nicht zufrieden darüber gezeigt, dass von den Zehntausenden nach Russland verschleppten ukrainischen Kindern weniger als zweitausend Waisen waren, was im Umkehrschluss hieß, dass alle anderen ihren Familien weggenommen worden waren, um mit ihnen die große Unwucht der russischen Demografie auszugleichen. Das alles wussten wir noch nicht. Und der Kindersoldat wusste es ebenfalls nicht. Oder doch, vielleicht hatte er das eine oder andere schon gesehen und konnte auch deshalb nicht aufhören zu schluchzen, wer weiß. Die ukrainischen Frauen jedenfalls wussten es sicher nicht. Deshalb drückten sie ihm eine Tasse Tee und ein Stück Brot in die Hand und ein Telefon, damit er seine Mutter anrufen konnte.
Ich muss dieses Video immer wieder anschauen, drücke unzählige Male auf Replay und habe einen Kloß im Hals. Warum? Klar, es gibt kaum etwas Ergreifenderes als ein Fünkchen Liebe inmitten von Hass, oder? Wenn du den weinenden Jungen in Uniform, der dein Land überfällt, nicht wie einen Feind behandelst, sondern wie einen Sohn: Ist das nicht Menschlichkeit? Krieg ist etwas Schlimmes, nur die Bösen wollen ihn, Krieg führen immer die anderen, die Mächtigen, nicht die normalen Menschen. Normale Menschen sind einfach, pragmatisch und großmütig, und Frauen sind bekanntermaßen besser als Männer, Männer haben schließlich den Krieg erfunden, also los, mach schon, ruf deine Mutter an und sag ihr, dass du noch lebst.
»Alles nur Phrasen«, höre ich dich sagen.
Ja, Papa, du hast Recht.
Alles nur Phrasen.
So reden Leute, die vom Krieg keine Ahnung haben. Leute wie ich, eine Frau mittleren Alters, die immer im Frieden und Wohlstand meines Kontinents gelebt hat. Der die Vorstellung eines Kriegs vor der eigenen Haustür ferner liegt als die vom Leben eines Kopffüßers auf dem Korallenriff. Leute wie ich, die vom Krieg nur wissen, dass sie nichts wissen. Doch der Kloß in meinem Hals ist real. Wenn es mir so schwerfällt, dieses Video anzuschauen, warum drücke ich dann immer wieder auf Replay?
Bis ich es verstehe. Dieser Junge könntest du sein. Und in den Frauen sehe ich ihre Großmütter oder Urgroßmütter, die dir ein Stück Brot und eine Tasse Milch gaben, als du ihr Land überfallen hast. Ich sehe die Frauen, von denen du immer so voller Liebe gesprochen hast, dass wir schon Witze darüber machten, ob du in einer dieser heimeligen Isbas zwischen Dnipro und Don nicht vielleicht einen kleinen Iwan zurückgelassen hast, unseren slawischen Bruder. Und erst jetzt, wo ich ein halbes Jahrhundert später die Ortsnamen des damaligen Krieges wiedererkenne – Sumy, Charkiw, Luhansk –, begreife ich es: Deine berühmten »russischen Frauen«, von denen du immer mit großen Augen gesprochen hast, in denen mehr lag als Dankbarkeit – eher ein Gefühl, das die Sonnenblumen für die Sonne hegen oder die kalten Füße für den Ofen –, deine Retterinnen, das waren keine Russinnen.
Sie waren Ukrainerinnen.
Füße
Dagegen gibt es nur eine Medizin: die Erinnerung, die Fakten und Personen nachzeichnet und hervorbringt wie Spucke das Abziehbild.
An Annas Hand
Die in den Familiengeschichten überlieferten Erinnerungen ragen aus der Vergangenheit heraus wie schwarze Felszacken aus einer Schneelandschaft. Sie erheben sich aus dem gleichförmigen Weiß des Vergessens und skizzieren die Geografie der Erinnerung. Nur die in Erzählung verwandelten Erinnerungen formen später den Zustand des »So ist das damals gewesen«. Alles andere bleibt darunter verborgen wie die unter den Eisschichten oder noch tiefer im Permafrost eingelagerten Gneise. Ein Winter legt sich über sie, der viele Generationen, wenn nicht ewig dauert, und unter den chthonischen Kräften von Kälte und Zeit erodieren sie bis zu ihrer Auflösung. Für immer verloren. Doch manchmal sorgt eine erschütternde und nicht vorgesehene Unregelmäßigkeit, etwa eine Klimakatastrophe, dafür, dass verborgene Überreste wieder zutage treten, nicht unversehrt, aber lesbar. Diese Erinnerungen sind manchmal faszinierend, aber harmlos, wie eine prähistorische Mumie, die aus dem Eis auftaucht: Oh, interessante Tattoos, rufen wir vielleicht aus, und der Pfeilköcher – so gut erhalten!, doch der Fund ändert nichts an unserem Blick auf die Welt. Andere Erinnerungen wiederum tauchen aus dem Vergessen auf und stellen alles in Frage. Die vertraute Geografie, in der wir seit jeher gelebt haben, verändert plötzlich ihre Erscheinung. Sie verwandelt sich in eine unbekannte Landschaft, nimmt mitunter nie gesehene Formen an. Und wir entdecken möglicherweise, dass die sonnendurchflutete Ebene, die wir für unser Leben hielten, in Wahrheit der Meeresgrund ist.
Wenn das passiert, ist das nichts für schwache Nerven.
Es gibt so viele Anekdoten im Geschichtenkanon unserer Familie, in unserem heiligen Buch der Erinnerung, zu denen ich dich gerne befragen würde. Doch dafür ist es zu spät. Dann gibt es Ereignisse, die erst kürzlich ans Licht gekommen sind, von denen du uns nie erzählt hast und von denen ich erst nach deinem Tod erfahren habe. Und hier stehe ich nun mit meinem Wunsch, zu verstehen.
Manche Erinnerungen aus unserem Familienepos (und dem Epos anderer Familien) tragen die Überschrift »Rückzug aus Russland«, der in Wahrheit, was ich ebenfalls erst jetzt begriffen habe, ein »Rückzug aus Russland und der Ukraine« war.
Hier eine Schlüsselszene:
Ein Militärkrankenhaus in Venedig. Ich glaube, es war Venedig. Ganz sicher bin ich mir nicht. Ich bin mir über gar nichts mehr sicher, seit das Eis begonnen hat, sich langsam von den Erzähllandschaften zurückzuziehen. Aber Venedig eignet sich immer gut als Schauplatz, deshalb belassen wir es dabei. Ein großer Schlafsaal mit Marmorboden. Das Wasserspiel eines Kanals spiegelt sich in den Fenstern. An den Wänden Dutzende Metallpritschen. Ein unerträglicher Geruch nach Desinfektionsmittel, Ausscheidungen und sauren Fieberausdünstungen, nach dem schweren Atem vieler junger Männer; und über allem der höllische Fäulnisgestank des Wundbrands. Die energischen Schritte einer Krankenschwester klappern durch den Saal, zwei Frauen werden hereingeführt. Es sind deine Mutter und deine Schwester – meine Großmutter und meine Tante.
Oma Bianca mit ihrer berühmten, ihr selbst verborgen gebliebenen und in der ganzen Familie einzigartigen Schönheit, blickt sich suchend nach dem Gesicht ihres Sohnes um. Sie hat keine Sorge, ihn nicht wiederzuerkennen, auch wenn seit ihrem Abschied zweieinhalb Jahre vergangen sind. Ihre Sorge ist eine andere.
Tante Maria Teresa war niemals schön. Mit Anfang zwanzig strahlt sie schon die sinnenfeindliche Autorität einer Sechzigjährigen aus. Seit Kriegsbeginn ist sie ihren Schülern gegenüber, denen sie Lesen und Rechnen beibringt, noch nachsichtiger geworden und verteidigt sie umso kämpferischer gegen alle Demütigungen durch die Erwachsenen – Pfarrer, Schuldirektoren, Bürgermeister. Sie hat dir immer Essenspakete an die Front geschickt, wie auch deinem in El-Alamein stationierten Bruder.
Sie entdecken dich.
Deine Pritsche steht unter einem Fenster. An diesem Punkt der Geschichte frage ich mich immer, wie es sich für dich angefühlt haben muss, nach all dem Schnee und Schlamm endlich wieder in einem richtigen Bett zu liegen. Aber vielleicht hast du das, als du ankamst, auch gar nicht bemerkt. Anders als bei den beiden Kriegsheimkehrern rechts und links von dir ist dein scharfes Profil nicht hinter Verbänden verborgen. Deine Augen sind geschlossen, du siehst sie nicht kommen, die Marien deiner Auferstehung. Deshalb bemerkst du auch das Verhalten deiner Mutter nicht. Sie nennt dich nicht beim Namen, gibt dir keinen Kuss, fasst dich nicht an. Dass du am Leben bist, weiß sie, seitdem der Postbote sie beim Bügeln gestört hat. Der Brief der Befehlsstelle brachte die Antwort auf die monatelangen bangen Fragen: verwundet. Nicht das andere, unsagbare Wort aus den Meldungen, die andere Mütter bekamen. Mehr brauchte sie nicht. Wir gehen, hat sie zu deiner Schwester gesagt, nachdem sie noch schnell die Laken zu Ende gebügelt hatte. Hier an deinem Bett interessiert sie etwas anderes. Etwas, vor dem sie sich fürchtet.
Sie hebt die Bettdecke am Fußende des Bettes leicht an und schaut darunter. Hast du noch beide Beine? Und beide Füße? Ist der Körper, den sie vor knapp vierundzwanzig Jahren auf die Welt gebracht hat, noch heil, oder sind Teile von ihm dort im Osten zurückgeblieben, im Schnee?
Beide Beine sind noch dran, wenn auch erschreckend dünn.
An ihrem Ende zwei Füße.
Ein, zwei, drei – sie zählt deine Zehen.
Zehn.
Deine Mutter lässt vorsichtig die Decke sinken und bricht zusammen.
Endlich darf sie ohnmächtig werden.
Spinat
Die Kinder, die im Park neben meiner Bank spielten, waren alle nett, fast lieb zu mir, liefen aber weg, als ich fragte, ob sie Lust auf ein kleines Spiel hätten, das ich für harmlos, aber wichtig hielt.
Wollt ihr Frieden spielen?, fragte ich sie.
Aber keines kannte die Spielregeln. Deshalb gingen sie weg.
Wollt ihr Krieg spielen?, fragte ich sie.
Da stellten sich alle in eine Reihe und hatten kurz darauf zwei Mannschaften gebildet.
Die sibirischen Frauen folgen der Sonne
Ein Glück, dass ihr nicht mehr am Leben seid, Papa. Du, Mama und Tante Maria Teresa. In diesen Tagen bin ich fast erleichtert, dass ihr schon weitergegangen seid und euch diese neuen, stählernen Zeiten erspart bleiben. Dass ihr auf eure alten Tage nicht mehr erleben müsst, wie sich das neue Jahrtausend in den blutigen Fetzen eures 20. Jahrhunderts verfängt. Wie die Welt des Friedens, die ihr uns hinterlassen habt, in sich zusammenfällt. Wir dachten, diese Welt sei immer noch unsere Welt. Nun wissen wir, dass sie seit langem nur noch Kulisse war. Wir glaubten, in einer verflüssigten Welt zu leben, und wir beklagten uns darüber, doch nun ist sie plötzlich wieder hart wie Stahl.
Für viele Menschen ist diese Erkenntnis unerträglich.
»Nie wieder Krieg!«, haben wir achtzig Jahre lang gerufen. Und hielten das für eine klare, engagierte Haltung, die bedeutete: »Nie wieder werden wir Militäreinsätze, Genozide oder den Einmarsch von Truppen in fremden Ländern tolerieren, wir werden das mit allen Mitteln bekämpfen und das internationale Recht verteidigen, das auf der Unverletzlichkeit nationaler Grenzen beruht und ohne das es keine Demokratie gibt.«
In Wirklichkeit sagten wir lediglich: »Wenn es Krieg gibt, dann bitte nicht vor unserer Haustür. Nur woanders, vielen Dank. Der Krieg darf uns nicht direkt betreffen, uns genügt das vage, wohlige Schaudern immensen Mitgefühls, das uns angesichts des fernen Leids den Rücken hinabläuft« – und immens auch nur deshalb, weil weit genug weg.
»Wir wollen keinen Krieg«, sagten wir und klangen wie ein verwöhntes Kind, das sagt: »Ich will keinen Spinat«, weil es weiß, dass Mama den Teller mit dem ekligen Gemüse schon abräumen und stattdessen Chips auf den Tisch stellen wird. Das seine launenhaften Allmachtsfantasien ein ums andere Mal bestätigt bekommt, genau wie wir. Jahrzehntelang wurden die bösen Kriege der anderen schnell von unserem Tisch abgeräumt, wir mussten uns kaum damit beschäftigen. Natürlich taten uns die armen Opfer leid, klar – aber da sind ja schon die Chips.
Doch wenn wir jetzt sagen: »Nie wieder Krieg!«, kommt keine Mutter und nimmt ihn weg. Der Krieg ist da. Der Krieg hat unseren Kontinent erreicht. Und sosehr wir auch wollen, dass er wie von Geisterhand wieder verschwindet – nein, er verschwindet nicht. Unsere Allmacht ist ausgehöhlt. Nun haben wir die lästige Pflicht, jene Prinzipien anzuwenden, die wir jahrzehntelang vor uns hergetragen haben. Schlimmer noch: Für die Verteidigung dieser Prinzipien sollen wir sogar einen Preis zahlen! Und deshalb haben sich viele Menschen in einem Bunker verschanzt, wo sie Schutz vor dem Bombenhagel der Realität suchen, und diesen Bunker nennen sie Frieden.
Ich habe überhaupt nichts gegen Frieden, Papa. Im Gegenteil, ich bin eine große Verfechterin des Friedens, so wie du es warst. Ich habe sogar meine Tochter nach ihm benannt, deine erste weibliche Enkelin. Doch leider sind wir ein Land von alten Angsthasen. Anders als wir warst du nie wirklich alt: Du bist aus dem Zustand der wilden Fantastereien über das, was möglich ist, direkt in den des komplett unselbständigen, runzligen Säuglings gewechselt. Den verblüfften Groll über das Ende des Status quo habe ich bei dir nie erlebt. Doch wir wandern nun zwischen den Trümmern unserer Feigheit und hoffen, dass sie niemals zu echten Trümmerfeldern werden wie die in Mariupol, Bachmut und Awdijiwka. Die rauchenden Schuttberge, die Drohnenkrater, die ausgebrannten Wohnhäuser sollen bleiben, wo sie sind, weit weg. Und niemals näher an uns heranrücken. Wir sind für Frieden!
Aber ich, ich muss herausfinden, was Krieg ist, Papa.
Deshalb brauche ich deine Hilfe.
Ja, ich bitte dich um Hilfe, und dabei spielt es keine Rolle, ob du auf der falschen Seite gekämpft hast. Diejenigen, die damals auf der richtigen Seite standen – gesegnet sei ihr Andenken –, waren Helden. Doch nicht nur von Heldentum weiß ich nichts. Es ist der Krieg, von dem ich nichts weiß. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Und das, obwohl du auf der falschen Seite gekämpft hast, oder vielleicht genau deshalb.
Dein Krieg bekam in Italien später den Titel Ritirata di Russia, »Rückzug aus Russland«, und er ist eine Opfergeschichte. Die armen italienischen Soldaten in ihren Schuhen mit Pappsohlen sinken mit erfrorenen Füßen in den Schnee und sterben den Kältetod. Das ist alles wahr, niemand weiß das besser als du. Trotzdem verbergen sich hinter diesen drei Worten mindestens zwei Auslassungen. Erstens, dass die Geschichte sich größtenteils nicht in Russland, sondern in der Ukraine zugetragen hat. Und zweitens, dass der Rückzug von einem Ort bedeutet, dass man vorher dort angekommen ist. Die drei ikonischen Worte »Rückzug aus Russland« verschweigen nicht nur die Ankunft, sondern auch insbesondere den Grund dafür. Und der Grund war, dass ihr, dass wir auf der falschen Seite standen. Auf der unabweislich falschen Seite. Wir waren die Verbündeten derjenigen, die ein Jahr bevor du zum ersten Mal die Sonnenblumenfelder von Isjum erblickt hast, ein paar hundert Kilometer weiter in der Schlucht von Babyn Jar innerhalb von nur zwei Tagen dreißigtausend Menschen ermordet hatten, mit Maschinengewehrsalven oder einem Schuss ins Genick. Aus einem einzigen Grund: weil sie Juden waren. Aber du hast diesen Krieg gehasst. Alle hassen den Krieg, seine Opfer und seine Helden, ja sogar der, der ihn liebt. Deshalb bitte ich dich: Sag mir, was Krieg ist, Papa. Gerade du, weil du auf der falschen Seite gestanden hast und ihn nicht mit irgendwelchen Idealen schönreden kannst.
Du warst gezwungen, zu lernen, was Krieg bedeutet. Anders als meine Generation wart ihr nicht in der glücklichen Lage, zu glauben, man könne die Wirklichkeit des Krieges einfach leugnen. Ihr hattet nicht das Privileg, euch vorzumachen, ihn mit einem einzigen Wort, einer Art Bannspruch beenden zu können: Frieden! Der verfluchte Krieg war da, ob ihr wolltet oder nicht. Und nein, ihr wolltet ihn nicht. Doch er war da, so wie er seit Jahrtausenden da ist. Für mich ist es quasi unmöglich, zu verstehen, dass es Krieg gibt, dass er wirklich da ist. Denn der Krieg ist nicht aus Waffen gemacht, sie dienen ihm nur als Werkzeug, er ist vielmehr aus den Körpern der Menschen gemacht. Und mein Körper kennt – zu meinem unverdienten, unendlichen Glück – nur den Frieden. Was also könnte ich davon verstehen?
Ich, wir kennen nur den Frieden. Seit unserer Geburt geschieht alles, was wir tun, in Friedenszeiten, auch die schlimmsten, brutalsten und unangenehmsten Dinge. Selbst ein Mörder hat in Friedenszeiten gemordet. Und auch wer ermordet wurde, wurde in Friedenszeiten ermordet. Die Frau, die von ihrem gewalttätigen Mann umgebracht wurde, hatte ihren eigenen Krieg zu Hause, doch draußen in der Welt herrschte Frieden. Wir können uns aus diesem Grund vom Krieg kein anderes Bild machen als das einer möglichen Beschäftigung unter vielen in Friedenszeiten. Klar, es mag die schrecklichste und brutalste von allen sein, doch letztendlich ist sie nicht so grundlegend anders als tausend andere Dinge, die geschehen können. Selbst wir, die wir womöglich Romane über Kriege geschrieben haben, sind Schriftsteller in einer Zeit des Friedens.
Der Krieg hingegen bringt eine grundlegend andere Zeit mit sich, sagen diejenigen, die ihn erlebt haben. Selbst der Lauf der Sonne ist nicht mehr derselbe. Dass ich sie nicht erleben musste, ist das essenzielle, überwältigende Glück meines Lebens als Europäerin des Westens in den letzten achtzig Jahren, das Glück, an dem alles andere hängt. Aber wir wollten dieses Glück nicht sehen, so wie wir die Luft, die wir atmen, nicht wahrnehmen, bis sie schwarz wird vor Rauch. Doch diese glückliche Ignoranz ist zugleich unsere große Schwäche. Nun sagen viele gutmeinende Menschen: »Wir wollen doch nur, dass Frieden herrscht.« Doch was bringt es, inmitten eines schrecklichen Schneesturms zu sagen: »Wir wollen doch nur, dass Sommer ist«?
Die Zeit deines Krieges ist lange vorbei, und ebenso die Ära der Zeitzeugen. Doch ein Ende des heutigen Krieges ist nicht in Sicht. Du hast mir beigebracht, wie man in den Bergen wandert – »Ein Schritt, ein Atemzug, ein Schritt, ein Atemzug …« –, und das Wandern in den Bergen hat mich Folgendes gelehrt: Wenn Gedanken zu Schemen werden, Gefühle wirr, Worte unbrauchbar und Abläufe umstritten, wenn die Zeit sich verknotet wie eine Schlange, die sich selbst verschlingt, dann ist das, was uns bleibt, die Geografie.
Die Orte bleiben.
Und die Orte dieser beiden Kriege – des einen zu Beginn unseres Jahrtausends und des anderen, in dem du gekämpft hast – sind fast dieselben. Damals wie heute liegt die erdrückende Schwüle unseres Schweigens über denselben Ortsnamen: Irpin, Sumy, Charkiw. Der eisige oder todbringende Dnipro, der unter feindlichem Beschuss durchquert werden muss. Der Donbass, das Donezk-Becken. Isjum, auf dessen Sonnenblumenfeldern dein Krieg an einem Tag im August vor achtzig Jahren seinen Anfang nahm.
Und jenseits der Grenze dann Rossosch, in der Ebene zwischen den Flüssen Donez und Don, Kommandositz des Armeekorps der Alpini, der italienischen Gebirgsjäger, zu denen deine Division Julia zählte. Der Name dieser Stadt war mir nicht vertraut, in deinen Erzählungen kam er nicht vor, anders als Nikolajewka oder Kalitwa. Aber nun taucht sie auf, diese unbekannte russische Kleinstadt, zwei Stunden von der ukrainischen Grenze entfernt, in den Schlagzeilen der russischen Nachrichten auf Englisch: »Rossosch entnazifiziert!«
Komisch, war es nicht die Ukraine, die entnazifiziert werden musste? Und ich finde heraus, dass im Jahr 1993, fünfzig Jahre nach deinem Rückzug, eine Delegation italienischer Alpini der Stadt einen Kindergarten geschenkt hat. Sie nannten ihn Ulybka – Lächeln. Kinder spielen in einem buntbemalten Hof, ein Lächeln für die Gefallenen beider Seiten –, nicht die schlechteste Art der Wiedergutmachung und der Erinnerung an vergangene Gräueltaten. Zehn Jahre später wurde, um die gegenseitige Wertschätzung zwischen ehemaligen Feinden noch zu steigern, vor dem Kindergarten ein Denkmal für die Alpini errichtet. Ein hässlicher Sarkophag aus rotem Ziegelstein, gekrönt von einem stilisierten Alpini-Hut aus Metall, dazu ein Schild mit der russisch-italienischen Aufschrift: AUS EINER TRAGISCHEN VERGANGENHEIT / IN EINE GEGENWART DER FREUNDSCHAFT / FÜR EINE ZUKUNFT DER BRÜDERLICHEN ZUSAMMENARBEIT. Doch dann kehren im Februar 2022 russische Panzer den Lauf der Geschichte um und überqueren die Grenze mit dem Schrei: Denazifikazija! Der unerbittliche Herr des Kremls im dunklen Tschekisten-Anzug, die Unterarme auf den Schreibtisch gestützt, hat erklärt, dass die »Entnazifizierung der Ukraine« den letzten Akt des Großen Vaterländischen Krieges darstelle, der achtzig Jahre zuvor von der Heiligen Mutter Russland begonnen worden war. Der Gemeinderat von Rossosch schließt sich begeistert der heroischen Mission an. Das Denkmal der Alpini wird gestürzt, der Metallhut mit der schwarzen Feder stürzt zu Boden und wird zertrampelt. Die russischen Nachrichtenseiten im Netz jubeln: In der patriotischen Kleinstadt wurde der Nazifaschismus ein zweites Mal besiegt.
Nicht ich bin diejenige, Papa, die diese Verbindung herstellt zwischen der Invasion in der Ukraine und dem Zweiten Weltkrieg. Es sind die deutlichen, ruhig und überlegt ausgesprochenen Worte eines Mannes, der sich als Abgesandter der großen Geschichte versteht, von jemandem, der – wie er gerne betont – im Geist der Zaren Peter, Katharina und Alexander III. handelt: Wladimir Wladimirowitsch Putin.
Wer weiß, wie du reagieren würdest, wenn er dir sagte, dass der von ihm begonnene Krieg eine Fortsetzung deines Krieges sei.
Walenki
»Und die Schuhe?«
Ich sah auf meine Schuhe und begriff, dass ich verloren war.
An Annas Hand
Zwei, nur zwei Episoden deines Krieges waren es wert, in die epischen Dichtungen der Familien aufgenommen zu werden.
Die erste trägt den Titel »Die Hühner von Kalitwa« und spielt am großen Bogen des Don. Dabei handelte es sich nicht um eine gewöhnliche Flussbiegung, die etwas weiter war. »Der groooße Bogen des Don«, sagtest du mit einem langgezogenen »o«, das wie ein mächtiger Strom zwischen den Ufern der Konsonanten dahinfloss: groooßer. Diese fünf Wörter beschworen einen Ort voller Wunder und Legenden, wie der Beginn eines Märchens: Es war einmal mein Vater am groooßen Bogen des Don. Er war dreiundzwanzig Jahre alt und hatte ein Dutzend Männer der italienischen Gebirgsjäger unter seinem Kommando. Er hatte kalte Füße und sorgte sich um die kalten Füße seiner Alpini.
Soldat Kurk, die Hühner-Soldaten, so nannten die sowjetischen Soldaten die Männer der 8. Italienischen Armee, der sogenannten ARMIR, Armata Italiana in Russia, mit ihren Federn auf den Helmen, die aus Alpini und Bersaglieri bestand. In Wirklichkeit befanden sich die Bersaglieri in einem völlig anderen Frontabschnitt als eure Division Julia, und hier waren deine Beschreibungen wie so häufig bemerkenswert ungenau. Doch mir war das egal, solange du bei mir oder meiner Schwester auf dem Bettrand gesessen und erzählt hast. Im Zimmer war es dunkel, nur aus dem Flur fiel ein schmaler Lichtspalt durch die angelehnte Tür, und du erzähltest leise, wie sich die Nacht geheimnisvoll und unerbittlich auf die schneebedeckte Steppe herabsenkte, während ihr, du und deine Alpini, euch langsam aus den Schützengräben herauswagtet …
Das war immer der spannendste Moment der Geschichte, denn dann hast du die Hände vor dem Mund zusammengelegt, den Kopf nach hinten geworfen und ausgestoßen:
»A-uuuuuh!«
Ein melancholisches Heulen, bedrohlich und wild.
Und vor allem verblüffend real, da war ich mir ganz sicher, obwohl ich noch nie einen echten Wolf hatte heulen hören.
Dann verwandelte sich die Zimmerdecke unserer römischen Wohnung in den glasklaren Himmel sibirischer Nächte, und in meinem Bett jagten mir die Lust und die Angst einen magisch kalten Schauer über den Rücken.
Am anderen Flussufer, so hast du deine Erzählung fortgesetzt, standen die Soldaten der Roten Armee, zwanzigmal so viele wie ihr, die armen, wehrlosen Alpini mit eurer schlechten Ausrüstung. Ein Angriff wäre verheerend gewesen. Das wusste ihr Kommandeur sehr genau, Generalleutnant Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, er hätte seine Soldaten gerne auf euch losgelassen. Doch seine Männer stammten – und keiner weiß, woher du das als blutjunger faschistischer Leutnant wusstest, jedenfalls wusstest du es –, aus Burjatien, Jakutien und Tuwa, von den äußersten Rändern Sibiriens. Und mit der Sicherheit eines Anthropologen des 19. Jahrhunderts wusstest du auch, dass diese Leute große Angst vor Wölfen hatten. Größere Angst als vor den Geschützen, hast du hinzugesetzt, vor dem Maschinengewehrfeuer und sehr viel größer als vor den Hühner-Soldaten. Und wirklich, wenn die Sowjets das Geheule hörten, erstarrten sie. Viele Nächte lang habt ihr durchgeheult, und die sibirischen Soldaten ließen euch in ihrem heidnischen Entsetzen in Ruhe.
Es war eine aberwitzige, nicht besonders glaubhafte Geschichte, die vor der Gegenoffensive der Roten Armee abbrach, die natürlich – Wölfe hin oder her – irgendwann kam. Das hast du nicht erzählt. Es wäre wohl auch naiv, von Kriegsheimkehrern wahre und vollständige Geschichten zu erwarten. Man käme ja auch nie auf die Idee, Odysseus zu fragen, wie er sich als ausgewachsener, stattlicher Mann unter dem Bauch eines Schafs hatte verstecken können. Am Ende zählt nur, dass er wieder da ist. Dass Polyphem ihn nicht verschlungen hat.
Und wenn du bei mir auf dem Bettrand gesessen hast, war klar, dass du den Krieg beziehungsweise den Zyklopen überlebt hattest. Das genügte mir.
Im eigentlichen Mittelpunkt der ehrwürdigen, innerfamiliären Saga »Papa in Russland« steht aber eine andere Episode. Sie heißt »Die Geschichte der Walenki«.
Dies ist ihre offizielle Version:
Auch die Wolfs-Hühner hatten die sowjetische Gegenoffensive nicht aufhalten können, und so ist nun die gesamte italienische Armee versprengt. Man muss sich die Bildfläche wie leergefegt vorstellen. Keine Kolonnen zerlumpter, notdürftig in Decken und Mäntel gehüllter Soldaten, wie wir sie von den Fotos des Rückzugs aus Russland kennen, der in Wahrheit größtenteils ein Rückzug aus der Ukraine war. Nur du und deine armen Alpini sind zu sehen, ihr lauft durch die eisige Steppe. Allein, im blendenden Weiß, ohne Essen und Munition. Wenn ihr einem Trupp Sowjet-Soldaten oder schlimmer noch Partisanen begegnet, ist es aus mit euch. Ihr seid trunken vor Müdigkeit und habt vor allem kalte Füße. Eiskalte Füße. Erfrorene Füße. Nichts an der Kleidung der ARMIR eignet sich für einen Feldzug in Russland, doch über die Stiefel wirst du später einmal schreiben: Das ist kein Schuhwerk, das ist ein Verbrechen.
Ihr lauft und lauft durch den Schnee wie in einem Gruselmärchen. Manchmal stolpert einer deiner Männer und fällt hin, die anderem helfen ihm wieder auf. Wie lange noch?, fragst du dich. Wann passiert das Unsagbare, dass ein Alpino zu Boden sinkt und seine Kameraden genau wie du so am Ende ihrer Kräfte sind, dass sie ihn einfach liegen lassen? Einige der Männer könnten deine Onkel sein, manche sind doppelt so alt wie du. Doch du bist ihr Offizier. Du hast ihnen und mehr noch dir selbst geschworen, sie nach Hause zu bringen. Du wünschst dir nichts sehnlicher, als dass ihre Frauen nicht zu Witwen werden wie die Frau deines Adjutanten. Da taucht ein Gebäude auf, genauer gesagt: ein Lagerhaus. Wie sieht es aus? An diesem Punkt deiner Erzählung stellte ich mir immer einen Würfel aus billigem Metall vor, das war für mich ein Lagerhaus: wie in einem Gewerbegebiet außerhalb von Rom. Natürlich stimmte das nicht, aber ich erinnere mich nicht an deine Beschreibungen. Ganz sicher war es keine Isba, wo allein der schöne Klang des Wortes schon Wärme und Gastfreundschaft ausstrahlt und mich an die Almhütten in den Dolomiten erinnerte, nur eben versetzt in die weiße Ebene Russlands und bewohnt von blonden Frauen mit geblümten Kopftüchern. Das Lagerhaus jedenfalls, das ihr dort in der Ferne seht, ob aus Blech oder nicht, ist ganz sicher keine Isba.
Vorsichtig schleicht ihr euch an.
Die Steppe ist menschenleer, und das Lager auch.
Geheimnisvollerweise, wundersamerweise ist die Tür nur angelehnt. Ihr öffnet sie und schaut hinein. Unvorstellbare Reichtümer offenbaren sich euren Blicken: Essen, Munition, Ausrüstung. Eine wahre Schatzkammer, und der sowjetische Drache, der sie bewacht, ist nicht da oder schläft. Ungläubig über so viel Glück betretet ihr den Raum.
Die Munition lasst ihr links liegen. Wenn der Feind euch überraschen sollte, fegt er euch in eurem erbärmlichen Zustand ohnedies hinfort. In der Standardversion der Geschichte beißt ihr in ein paar Würste, in einer anderen Variante lasst ihr Kartoffeln mitgehen. An dieser Stelle frage ich mich immer: Wie sollen sie denn rohe Kartoffeln essen? Oder wolltet ihr die unterwegs kochen? Aber ich habe eben keine Ahnung vom Krieg.
Dann endlich entdeckt ihr den größten Schatz in dieser Wunderhöhle: Walenki! Diese weichen und warmen Filzstiefel, die ihr an den Füßen der russischen Bauern gesehen habt, die in Wahrheit ukrainische Bauern waren, und um die ihr sie so beneidet habt. Ihr vergesst alles andere – Würste, Kartoffeln, die nicht angerührte Munition – und lauft zu den Regalen mit den Schuhen. Ihr zieht Mussolinis verbrecherische Schuhe aus, vielleicht werft ihr sie sogar wütend in die Ecke, wie es auch die verdient hätten, die sie euch gegeben haben, und schlüpft in die Walenki.
Dank der Walenki werden eure Zehen nicht erfrieren und ebenso wenig eure Fersen, was noch schlimmer ist. Dank dieses unbeschreiblichen Schatzes aus Filz müsst ihr nicht mit lahmen Füßen und ohnmächtig in den Schnee sinken und auf den Tod warten, während die erschöpften Kameraden sich weiterschleppen und euren letzten Blicken ausweichen.
Ihr seid gerettet.
Ich erinnere mich noch gut an diesen Punkt der Geschichte. In deinen Augen das verschmitzte Aufblitzen des Unterlegenen, der es den Großen zeigt. David, der Goliath besiegt. Jerry, der Tom an der Nase herumführt. Du und deine armen Alpini, ihr wart die Kleinen, die die Rote Armee austricksen. Mehr noch, den General Winter, der einen von den Füßen aus ganz langsam tötet, ja, der selbst Napoleon besiegt hat – aber euch nicht. Dich nicht.
Im Sprachgebrauch unserer Familie standen die Walenki für weit mehr als nur für Schuhe. Sie waren ein Synonym für Überleben, für Glück und für Heimkehr. Das genaue Gegenteil von Krieg, könnte man sagen. Was ist das Gegenteil von einem lauten, harten und todbringenden Panzer? Antwort: die weichen, leisen Schritte von zwei warmen Füßen in Walenki. Sie sind das Leben, das den Tod besiegt, der einfache Wollfilz, der über die Waffen triumphiert.
Dank der Walenki konnten du und deine armen Alpini nach Hause zurückkehren.
Nikita
Ihr italienischen Hühner, an eurem Weihnachtsfest kochen wir euch. In einem großen Topf kochen wir euch, und wenn eines von euch weglaufen und nach Italien zurückkehren will, soll es das lieber gleich tun. Wir aus Kalitwa wissen nämlich sehr gut, wie man Hühner kocht.
An Annas Hand
Und noch eine Familienlegende:
Du und Mama seid schon einige Jahre verheiratet. Den Krieg habt ihr hinter euch gelassen wie die anderen auch, mit dem Trotz der Lebenden. In einer Schublade stößt sie auf dein Manuskript. Wann hast du das geschrieben? Sie hat dich nie daran arbeiten sehen. Du hättest es einfach heruntergeschrieben, erklärst du, sofort nach deiner Rückkehr. Als du sie noch nicht kanntest. Die Jahre seien vergangen, und du habest nicht mehr daran gedacht.
Sie liest es.
Viele Jahre später wird meine Mutter mir erzählen, was deine Kriegserinnerungen bei ihr auslösten: »Endlich habe ich verstanden, was hinter seinem Schweigen steckte.«
Sie ermutigt dich, das Manuskript einem Verleger zu zeigen. Das gefällt dir: Du weißt, dass sie eine feinsinnige Leserin ist und niemals leere Komplimente machen würde. Unter dem Titel »Es war kalt« reichst du es für einen Literaturpreis ein. Du gewinnst nicht, wirst aber lobend erwähnt. Kein Verlag macht dir ein Angebot, und du bist vielleicht zu stolz, es selbst zur Veröffentlichung vorzuschlagen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls landet das Manuskript in der Schublade.
Die Jahre vergehen, der schreckliche Winter in der Steppe rückt in weite Ferne. Ihr zieht nach New York. Du bekommst eine Audienz bei Chruschtschow, genau an dem Tag, an dem der angeblich bei der UNO-Generalversammlung seinen Schuh auf das Rednerpult schlagen sollte.
Die Geschichte fängt bei dir an, wie du der sowjetischen Delegation bei den Vereinten Nationen eine Nachricht zukommen lässt.
Nur wenige Zeilen:
»Ich bitte um ein Gespräch mit Nikita Sergejewitsch.
Gezeichnet:
Ein Huhn von Kalitwa.«
Kaum hat der Genosse Generalsekretär der KPdSU die Nachricht gelesen, sagt er zur Verblüffung seiner Delegation sofort zu: Ja, der unbekannte italienische Journalist soll eine private Audienz bekommen.
Dir wird mitgeteilt, dass ein Auto des russischen Konsulats dich vor deinem Haus am East River abholen wird. Du antwortest, dass es dir nicht behagt, wenn dich Vertreter des Italienischen Konsulats, das nur wenige Schritte von der Repräsentanz der UdSSR bei der UNO entfernt ist, aus einem Sowjet-Fabrikat steigen sehen. Du kommst lieber auf eigene Faust zur Verabredung. Ich kann nicht einschätzen, ob deine Vorsicht in diesem Fall gerechtfertigt war. Vielleicht, immerhin befandet ihr euch mitten im Kalten Krieg. Vielleicht deutete sich hier aber schon deine angeborene Neigung zur Geheimnistuerei an, die Jahre später als zwanghaftes Lügen definiert und beurteilt werden würde. Ich vermute allerdings, der eigentliche Grund lag in deiner Vorliebe, um nicht zu sagen: Obsession, für die verborgenen und nicht miteinander verbundenen Wendungen der Wirklichkeit. Eine Vorliebe, die dein Leben sicher nicht geradliniger verlaufen ließ und die es deiner Umgebung nicht immer leicht gemacht hat, die deinem Blick aber manchmal eine ungeahnte Tiefe verlieh. Um es auf den Punkt zu bringen: Es machte dir Spaß, Spion zu spielen.
Auf jeden Fall, egal ob nun zu Fuß oder im Taxi, erreichst du die Sowjetische Delegation.
Chruschtschow empfängt dich in bester Laune.
Vielleicht fragst du dich, wer dieser Mann mit den fast kindlich blauen Augen im runden Gesicht in Wirklichkeit ist. Im New York des Jahres 1960 stand sein gutmütiges Bauerngesicht für das Ende des Stalinismus. Doch in den Dreißigerjahren in der Ukraine war er als Funktionär von Moskau mit der Aufgabe betraut gewesen, die richtige und angemessene Menge an Leuten zu erschießen, um den Kommunismus fest in der Bevölkerung zu verwurzeln. Es ist das erste Mal, dass du ihm so nahe kommst, aber es ist nicht das erste Mal, dass ihr euch am selben Ort aufhaltet. Im Dezember 1942 war auch er am groooßen Bogen des Don, als junger Generalleutnant eines sowjetischen Bataillons, das sich am anderen Flussufer verschanzt hatte. Er gibt dir acht Minuten Zeit, um zu sagen, was du zu sagen hast.
Wer weiß, ob du auch beim Genossen Generalsekretär die Hände um den Mund gelegt hast und mit gerecktem Hals in dein Geheul ausgebrochen bist. Nikita sieht dich verdattert an, wie du in dem Büro des Glaspalasts »A-uuuuuh« machst – ein herrliches Bild, ich wünschte, es wäre wahr! Dann erklärst du ihm, dass ihr es wart, die listigen und ethnologisch optimal informierten Alpini, die die sowjetischen Schützengräben mit dem gefürchteten Geheul des sibirischen Wolfes überzogen haben.
Als er hört, dass das, was er und seine Soldaten für Wölfe hielten, in Wahrheit die verachteten Hühner gewesen sein sollen, wird Nikita Sergejewitsch puterrot.
»Lügner! Lügner!«, brüllt er auf Russisch.
Durch das Geschrei alarmiert laufen zwei Wachen herbei. Sie packen dich unter den Armen und schleifen dich aus seinem Büro, während er schändliche Bemerkungen über das Intimleben deiner weiblichen Verwandten herausbrüllt – inklusive deiner Mutter, deiner Schwester und sogar deiner Großmutter.