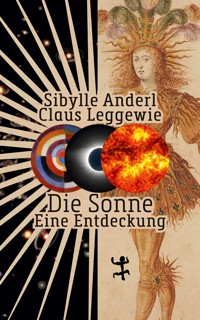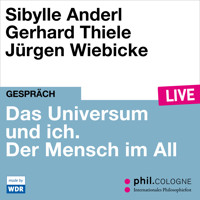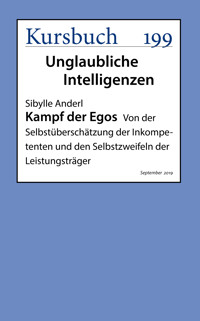
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kursbuch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zu wissen, wie wenig man weiß – so Sibylle Anderl in ihrem Beitrag in Kursbuch 199 –, setze schon einiges an Intelligenz voraus. Aber woher weiß der Einzelne, wie viel oder wenig er weiß? Die eigene Intelligenz adäquat einzuschätzen, fällt dem Individuum scheinbar zunehmend schwer, sodass immer häufiger beobachtet werden kann, dass die weniger Kompetenten zu Selbstüberschätzung neigen, während sich die Leistungsträger von großen Selbstzweifeln gepeinigt sehen. Sibylle Anderl beschreibt die Phänomene des Dunning-Kruger-Effekts und des Hochstapler-Syndroms als Parabel auf die Moderne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Sibylle Anderl Kampf der EgosVon der Selbstüberschätzung der Inkompetenten und den Selbstzweifeln der Leistungsträger
Die Autorin
Impressum
Sibylle Anderl Kampf der EgosVon der Selbstüberschätzung der Inkompetenten und den Selbstzweifeln der Leistungsträger
Dass Sokrates wohl eine rechte Nervensäge gewesen sein muss, ist allgemein bekannt. Die genauen Gründe dafür kann man in Platons berühmter Apologie nachlesen. Demnach hatte Sokrates’ langjähriger Freund Chairephon das Orakel von Delphi darüber befragt, wer der weiseste Mann sei, und als Antwort »Sokrates« erhalten. Sokrates selbst war von dieser Aussage, die ernst zu nehmen schon allein der Respekt vor dem Orakel verlangte, offenbar einigermaßen verwirrt und machte sich auf, sie empirisch zu falsifizieren. Auf der Suche nach Personen, deren Weisheit sein eigenes Wissen überragen würde, fand er unter Politikern, Dichtern und Künstlern allerdings viel Selbstüberschätzung und wenig wirkliche Weisheit. So beschreibt er eine Begegnung mit einem Staatsmann: »Im Gespräch mit ihm schien mir dieser Mann zwar vielen andern Menschen auch, am meisten aber sich selbst sehr weise vorzukommen, es zu sein aber gar nicht. Darauf nun versuchte ich ihm zu zeigen, er glaubte zwar weise zu sein, wäre es aber nicht; wodurch ich dann ihm selbst verhaßt ward und vielen der Anwesenden.« 1
Für Sokrates endete die Enttarnung zahlreicher Pseudowissender letztendlich tödlich. Noch heute macht man sich mit dem Aufdecken der Wissenslücken anderer wenig Freunde. Anders als Sokrates vor knapp 2500 Jahren haben wir heute aber einen psychologischen Begriff für die Selbstüberschätzung der Unwissenden: die Psychologen Justin Kruger und David Dunning beschrieben 1999, dass Inkompetenz nicht nur direkt in Form fehlerhafter Schlüsse und ungünstiger Entscheidungen sichtbar wird, sondern sich darüber hinaus – und fatalerweise – so auswirkt, dass eigene Begrenztheiten nicht erkannt werden können. Entsprechend führe Inkompetenz damit zur systematischen Überschätzung der eigenen Kompetenzen. Solch fehlerhafter Selbsteinschätzung kann aber immerhin durch Weiterbildung abgeholfen werden: »Paradoxerweise konnte den Teilnehmern durch die Verbesserung ihrer Fähigkeiten und der damit verbundenen Stärkung ihrer metakognitiven Kompetenzen geholfen werden, die Limitierungen ihrer Fähigkeiten zu erkennen«, schreiben Kruger und Dunning im Abstract ihres Artikels.2 Dieses seitdem als »Dunning-Kruger-Effekt« bekannt gewordene Phänomen kann damit als späte empirische Bestätigung des Orakels von Delphi gelesen werden: Zu wissen, wie wenig man weiß, setzt bereits einige Weisheit voraus.
Doch nicht nur in Feldern eigener Inkompetenz fällt zutreffende Selbsteinschätzung schwer. Ein anderer psychologischer Effekt, der 1978 erstmalig von Pauline Clance und Suzanne Imes im Kontext der Eigenwahrnehmung erfolgreicher Frauen beschrieben wurde,3 kann zumindest oberflächlich als ein gegenläufiges Phänomen zum Dunning-Kruger-Effekt verstanden werden: Das »Hochstapler-Syndrom« (englisch: »impostor syndrome«) betrifft gerade die besonders Kompetenten, die aber in quälendem Maße an ihren eigenen Fähigkeiten zweifeln. Dabei leiden sie massiv unter der Vorstellung, sie würden mit vorgetäuschter Kompetenz, gewissermaßen als Hochstapler, ihr Umfeld in die Irre führen – und müssten jederzeit mit der Enttarnung rechnen.
Es gibt also einerseits inkompetente Menschen mit gigantischem Ego, die andererseits auf kompetente Menschen mit massiven Selbstzweifeln treffen – die Folgen solcher Konstellationen lassen sich täglich im Alltag und auf vielen gesellschaftlichen Ebenen verfolgen. Was aber steckt hinter dem Dunning-Kruger-Effekt und dem Hochstapler-Syndrom? Worauf beruhen sie? Wo liegen Grenzen und Missverständnisse dieser psychologischen Konzepte? Es lohnt sich, einen genaueren Blick auf diese Phänomene zu werfen und schließlich zu fragen, inwiefern sie gerade heute für uns von Relevanz sind.
Das Problem der Selbstwahrnehmung
Das psychologische Problem der Selbsteinschätzung ist letztendlich eng mit dem philosophischen Problem der Selbstwahrnehmung verzahnt. Seit René Descartes ist in der Philosophie die Sicht verbreitet, dass dem Wissen über unsere eigenen inneren Zustände ein Sonderstatus zukommt. Wir scheinen in Bezug auf unser Innenleben einen privilegierten Zugang zu besitzen: Keiner sollte besser über uns, unser Wissen, unsere Überzeugungen, Wahrnehmungen und Empfindungen Bescheid wissen als wir selbst. Zumindest auf den ersten Blick würden wir außerdem behaupten wollen, dass dieses Wissen über uns selbst einen besonders hohen Grad der Sicherheit aufweist. Insbesondere bei Empfindungen wie Schmerz ist dies evident: Darüber, dass wir Schmerz empfinden, können wir uns normalerweise nicht irren. Diese Form der Unfehlbarkeit gilt gleichwohl keineswegs für all unsere mentalen Zustände.
Oft sind wir in Bezug auf uns selbst in einer Situation, die vergleichbar ist mit unserem Bemühen, andere zu verstehen: Wir stützen uns in behavioristischer Manier auf äußere Anzeichen und Hinweise, die prinzipiell auch anderen zugänglich sind. Im Extremfall benötigen wir sogar die Sicht von außen, um zu einem zutreffenden Bild von uns selbst zu gelangen. So zeigt unser eigenes Verhalten manchmal andere Überzeugungen, andere Wünsche an als die, die wir selbst eigentlich angenommen hätten (Therapeuten und Coaches leben davon, uns dies sehen zu helfen). Gleichzeitig formt die Beobachtung anderer Menschen und deren Reaktion auf unser Verhalten maßgeblich unsere Selbsteinschätzung.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es um eine Einschätzung der eigenen Kompetenz geht. Hier gibt es keinen privilegierten, direkten Weg per Innensicht, um die Falschheit oder Korrektheit unserer Urteile und Entscheidungen zu erkennen. Stattdessen greifen wir auf andere Strategien zurück, deren grundlegende Mechanismen in zahlreichen psychologischen Studien enthüllt werden konnten. So sind wir selbstbewusster, wenn wir schnell zu einer Antwort gelangen. Auch die Vertrautheit mit dem Themenfeld stärkt unser Vertrauen in unsere Urteile. Wenn unsere Antwort auf einer allgemeinen Regel beruht, vergrößert das unsere Sicherheit – und zwar unabhängig davon, dass ein systematisches Vorgehen gleichzeitig mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Denn nicht selten führen uns bekannte rationale Prinzipien auch in die Irre, wenn wir sie jenseits ihrer Geltungsgrenzen anwenden.