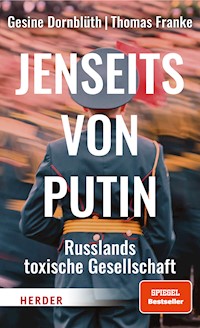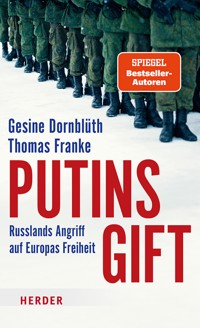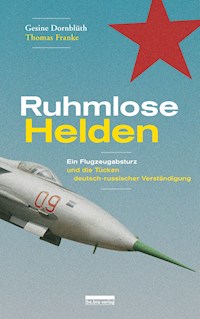Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Weltweit bedroht und zerstört Russland Demokratie und Freiheit. Die Machthaber um Putin fördern populistische und kriminelle Gruppen, unterwandern Medien, manipulieren Geschichte. Nirgendwo ist das erfolgreicher als in Georgien. Das Land vom europäischen Pfad abzubringen und erneut in den Machtbereich Russlands zu integrieren, ist eines der nächsten Ziele Putins. Gesine Dornblüth und Thomas Franke bereisen Georgien seit Jahrzehnten und erzählen von den Menschen und der politischen Lage. Sie nehmen uns mit in ein Land, das seit Jahrhunderten um Freiheit kämpft und neuerdings wieder um seine Unabhängigkeit bangt. Wie in einem Brennglas wird in Georgien deutlich, was auch gefestigte Demokratien ernsthaft gefährden kann. Der Kampf um die Freiheit läuft auf vollen Touren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesine Dornblüth, Thomas Franke
Kampf um die Freiheit
Georgien und der lange Arm des Kreml
Unser Dank gilt Irakli und Rusudan.
Editorische Notiz:
Die Umschrift der Namen orientiert sich an der deutschen Aussprache.
Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025
Hermann-Herder-Str. 4, 79104 Freiburg
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich an
Umschlaggestaltung: Gestaltungssaal, Rohrdorf www.herder.de
Umschlagmotiv: © ekavector – GettyImages, © Lindrik – GettyImages
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft, Timișoara
ISBN (Print): 978-3-451-07312-0
ISBN (EPUB): 978-3-451-83835-4
ISBN (PDF): 978-3-451-83836-1
Inhalt
Karte
Vorwort
Sehr altes Europa: Georgien und die Wurzeln der Zivilisation
Go West: Eineinhalb Jahre vor der Parlamentswahl
Der Mann mit dem Füllhorn: Bidsina Iwanischwili
Gesicht zeigen: Videos für Europa
„An den Eiern aufhängen“: Die Ära Saakaschwili
Kraftprobe: Der Augustkrieg 2008
Frust und Angst: 15 Monate vor der Parlamentswahl
Leben, Lieben, Widerstand: Die Filmemacherin Lana Gogoberidse
Zwischen den Stühlen: Besuch bei Eduard Schewardnadse
Parlamentswahl
Unter Schock
Säuberungen
Europäische Solidarität
Das tiefe Trauma der Ana Natswlischwili
Depression
Der Griff nach der Schlange: Abchasien
Ständige Bedrohung: Südossetien
Agonie und Aufbruch
Komm, setz dich hierher!
Die Präsidentenwahl
Europa reagiert
Feierlaune
Räuber und Mörder
Stalins Mantel
Zwei Präsidenten
Gewaltfreier Widerstand
Miteinander reden
Der ständige Kampf um Freiheit
Die Wahrheit sagen
Verschärfter Stillstand
Parallelwelten
Wir bleiben
Chronologie
Über die Autoren
Über das Buch
x
Vorwort
Seit 200 Jahren kontrolliert Russland Georgien, mal mehr, mal weniger. Die Georgier wollen das überwiegend nicht – und doch passiert es immer wieder. Wie geht das, ein Land einfach so unter Kontrolle bringen? Nach dem Auseinanderbrechen des Sowjetimperiums sah es so aus, als sei das Zeitalter der Diktaturen endgültig überwunden. In der Debatte über die Verbrechen des Kolonialismus ist Russland weitgehend ausgespart worden. Für viele Menschen ist es jedoch immer noch unvorstellbar, wie brachial die russische Führung unter Wladimir Putin imperiale Gewaltherrschaft durchsetzt. In der Ukraine führt sie Krieg, in Georgien muss sie das nicht. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich das russische Zarenreich Georgien schrittweise einverleibt. Seitdem wurde es von Russland aus regiert, erst von den Zaren, später, nach einer kurzen Unterbrechung, von den Sowjetherrschern. Erst 1991 wurde Georgien unabhängig. Die meisten Menschen im Land möchten, dass das so bleibt. Doch bereits in den 90ern besetzte Russland erneut ein Fünftel des georgischen Staatsgebietes. Um sich vor den immer wieder aufflammenden Gelüsten der Kremlherrscher zu schützen, ganz Georgien erneut zum Teil eines russischen Imperiums zu machen, haben die Georgier die Mitgliedschaft in der EU und der NATO als Ziel in der Verfassung verankert. Stabil und quer durch alle Altersgruppen und Milieus wünschen sich vier von fünf Georgiern den Anschluss an den Westen.
Doch seit 2012 regiert eine Partei, die das Land vom Westkurs abbringt und dabei Methoden anwendet, die denen von Putins Machtapparat in Russland ähneln. Es geht darum, das Land komplett unter Kontrolle zu bringen, einen Rechtsstaat zu verhindern. In rasantem Tempo kriminalisiert die Regierung unabhängige Stimmen, lässt ihre Kritiker zusammenschlagen und foltern, besetzt Behörden und Medien mit treuen Gefolgsleuten und hebelt die Justiz aus. Die Partei nennt sich zynisch Georgischer Traum. Sie ist im Besitz eines Oligarchen, dessen Vermögen, als er an die Macht kam, etwa die Hälfte der Wirtschaftsleistung des gesamten Landes ausmachte. Der Oligarch hat kein Interesse an rechtsstaatlichen Prinzipien, für die die EU steht. Deshalb tun die Politiker des Georgischen Traums alles, um eine EU-Mitgliedschaft zu verhindern, behaupten dabei aber ständig das Gegenteil. Sie verdrehen die Realität, bis nichts mehr gilt, die Menschen nicht mehr zwischen Wirklichkeit und Lüge unterscheiden können, sich angewidert von der Politik und der Gesellschaft abwenden, sich ins Private zurückziehen oder das Land verlassen (müssen).
In Georgien entsteht derzeit keine Diktatur nach den Mustern des vergangenen Jahrhunderts, in denen es eine Verheißung gab, eine Ideologie und Personenkult. Es ist eine Form von Unterdrückung durch Organisierte Kriminalität gepaart mit den Geheimdienststrukturen der vergangenen Sowjetdiktatur, wiederbelebt von Wladimir Putin und seinen Leuten im Kreml. Wie Mafiaclans bedienen sie sich aller verfügbaren Machtmittel, um ihre Gegner einzuschüchtern oder auszuschalten. Putin geht es darum, Wohlstand, Demokratie und Freiheit in Russlands Nachbarschaft zu verhindern. In Russland soll niemand auf die Idee kommen, es den Nachbarn gleichzutun und eine Freiheitsbewegung zu initiieren. Darüber hinaus geht es darum, Unruhe im Rest der Welt zu schüren, andere Gesellschaften zu schwächen. Es geht um viel Geld und Macht. Schwache Demokratien, wie die georgische, sind eine leichte Beute.
Tawisupleba heißt Freiheit. Freiheit ist, was die Georgier nur selten hatten, was vielen von ihnen aber sehr wichtig ist. Ihre Hymne heißt „Tawisupleba“. 28 Wörter hat sie, drei davon sind Freiheit. „Die Geschichte Georgiens ist ein Abenteuer des Kampfes um Freiheit“, sagt der Schriftsteller Dawit Turaschwili. Wir sind mittendrin.
Sehr altes Europa: Georgien und die Wurzeln der Zivilisation
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.“ Gott schuf dann mehrere Tage Pflanzen und allerlei Getier an Land, im Wasser und in der Luft. Nach fünf Tagen sprach er: „Lasset uns Menschen machen.“ Das tat er und sprach: „Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.“
Schöpfen war selbstverständlich recht anstrengend, und so „vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig; denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte.“ In Georgien erzählt man sich: Als Gott aber am fünften Tag die Menschen erschaffen hatte, waren darunter auch Georgier. Und die sahen all die Köstlichkeiten, all die Pflanzen und Tiere und den Wein und stürzten sich offensichtlich voller Lust auf die Speisen und Getränke, die da angerichtet waren. Essen und Trinken ist die herausragende Leidenschaft der Georgier. Und als sie damit fertig waren, tranken sie noch ein letztes Glas, schufen ihrerseits legendäre und gefürchtet lange Trinksprüche, ließen den Schöpfer hochleben und sangen vielstimmig, wie es unter Georgiern üblich ist. Und als sie am siebten Tage mit all ihren Tischbräuchen fertig waren, gingen sie zu Gott und fragten: „Lieber Gott, wo ist denn das Land, das du uns zugewiesen hast?“ Da war der Schöpfer ein wenig göttlich verwirrt und fragte: „Wo wart ihr, als ich das Land verteilt habe?“
Ob ihm erste Zweifel an seiner eigenen Vollkommenheit kamen, als er die Georgier kennen lernte, ist nicht überliefert. Heute wissen wir aus verschiedenen Quellen und eigener Erfahrung, dass Gott seine Schöpfung nicht gut kannte. Denn er hatte die Menschheit nicht geschaffen, damit die sein Werk systematisch zerstört. Die Georgier jedenfalls schauten Gott erwartungsvoll an: „Wir waren noch beim Essen, haben getrunken, haben Trinksprüche auf dich ausgebracht, auf die Schönheit der Welt, die du erschaffen hast. Wir haben erst getrunken auf die, die kommen. Dann auf die, die gehen. Und schließlich auf die, die noch da sind.“ Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Georgier vom Wein leicht gelallt haben, als sie vor ihrem Schöpfer standen. Klar ist, es war keine einzige Frau dabei. Mahnend sagte der Schöpfer: „Ihr seid zu spät, die Erde ist aufgeteilt!“ Aus ihrem Rausch jäh geweckt fragten sie, wo sie denn nun hingehen könnten.
Gott schien diese Typen irgendwie liebenswert zu finden. Sollte er nicht die gesamte Schöpfung gleich gern mögen? Aber das ist eine Frage, die Theologen in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich beantworten. Durchaus so, wie es politisch gerade gefordert ist. Der Legende nach hatte Gott sich auch ein Plätzchen für sich selbst reserviert, das schönste natürlich – Gott war demnach also keineswegs selbstlos. Doch diese leicht lallenden und erneut vielstimmig singenden Georgier lullten den Schöpfer dermaßen ein, dass er sich fühlte wie ein Beamter aus Brüssel, die er zu dieser Zeit noch nicht erschaffen hatte. Und so rückte der Schöpfer das Plätzchen raus, das er für sich selbst reserviert hatte. Und, wen überrascht das nun noch, es war Georgien!
Seitdem spielt Georgien in der georgischen Interpretation der Schöpfungsgeschichte eine zentrale Rolle. Sie suchen das Paradies? Fahren Sie in den Westen Georgiens, nach Adscharien am Schwarzen Meer. Ignorieren Sie die schrecklichen Hochhäuser, die in den vergangenen Jahren gebaut wurden und die das Flair ruinieren. Sie sind dazu da, an Russen verkauft zu werden, die nicht mehr in Russland leben wollen. Sie müssen die Stadt verlassen, wenn Sie verstehen möchten, warum Adscharien durchaus das Zeug zum Garten Eden hat. Wandern Sie in den Hügeln rundherum, bestaunen Sie die üppig grüne Landschaft. Es ist feucht und warm und fruchtbar. Es wächst Tee und es wachsen Granatäpfel. Natürlich haben Adam und Eva, als sie vom Baum der Erkenntnis kosteten, nicht in einen Granny Smith oder irgendein anderes gewöhnliches Kernobst gebissen, es war selbstverständlich ein Granatapfel.
Die Schöpfungsgeschichte im Alten Testament soll etwa 3000 Jahre alt sein. Ein Witz, folgt man der ironischen Erzählung von Georgiens Chefarchäologen, Dawit Lortkipanidse. Er hat einen menschlichen Schädel aus der Erde geholt, der 1,8 Millionen Jahre alt ist! „Hier sehen Sie den primitivsten Menschen, der jemals außerhalb Afrikas gefunden wurde“, hat er gesagt und dann lächelnd hinzugefügt, „es ist ein Georgier. Wir haben einfach Glück gehabt, dass wir ihn hier gefunden haben. Sonst wäre er Armenier.“ Nun gab es vor 1,8 Millionen Jahren keine Nationalstaaten. Aber wenige Kilometer vom Fundort entfernt ist heute die Grenze nach Armenien. Und mit den Armeniern streiten sich die Georgier, wer als Erster das Christentum zur Staatsreligion erklärt hat. Die Georgier haben es im 4. Jahrhundert getan.
Im Übrigen könnte im allerweitesten Sinn etwas dran sein, dass die Georgier, als die Schöpfungsgeschichte vor 3000 Jahren aufgeschrieben wurde, tatsächlich all die Köstlichkeiten genossen, die Gott auf der Erde geschaffen hatte, all die Früchte und die Kräuter, die Tiere und den Wein, und dass sie etwas betrunken waren. Denn in der Nähe des Fundortes des ältesten Hominiden außerhalb Afrikas haben Forscher 8000 Jahre alte Tongefäße gefunden, in denen Spuren von Wein enthalten waren. Auch im Wettlauf darum, wer den Wein erfunden hat, können nur wenige mithalten. Die Griechen haben auf Kreta eine 3500 Jahre alte Weinpresse entdeckt, und der Wein und die Ekstase war den „alten“ Griechen bekanntlich so heilig, dass sie einen Gott dahinter vermuteten. Es besteht aber der begründete Verdacht, dass die auch schon ganz schön alten Griechen unter ihrem Anführer Jason mit den Argonauten nach Kolchis gesegelt sind, um dort Wissen und eine Wissende zu rauben, die Königstochter Medea. Medea heißt auf Griechisch „die Wissende“. Die Königstochter Medea soll eben genau das gewesen sein, eine Zauberin, eine Heilerin, eine Seherin.
Kolchis ist das heutige Westgeorgien. Die Kolcher gewannen Gold, indem sie das Fell eines Widders in den Fluss legten und damit Goldpartikel auffingen. Der Sage nach hing das „Goldene Vlies“ in einer Eiche und wurde von einem Drachen bewacht. Medea half Jason, den Drachen einzuschläfern. Als Jason abreiste, nahm er Medea gleich mit. Der griechischen Deutung nach hatte sie sich in ihn verliebt. Das Ganze könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass bereits damals im Schwarzmeerraum Frauen versklavt und zur Prostitution gezwungen wurden. Aus der Zeit des antiken Griechenlands stammt vielleicht auch der Begriff Georgien. Georgós ist das griechische Wort für Bauer. Und fruchtbar genug, um für den Garten Eden zu taugen, ist das Land.
In Kolchis leben heute Megrelen wie unser Freund und Kollege Irakli Absandse, dessen Name dem griechischen Herakles entspricht. Beide, Irakli und Herakles, sind äußerst mutige Männer. Wir haben uns im August 2008 kennengelernt, als Iraklis Heimatstadt Poti in Teilen von russischen Truppen besetzt war, die allerdings profane Konsumgüter raubten. Wir trafen Irakli an dem Fluss, den auch einst Jason mit den Argonauten hinaufgerudert ist, um Medea und das Vlies zu rauben. Genug Mythos also, um jede Niederlage mit großem Selbstbewusstsein wegzustecken.
Es ist schwierig, von den Georgiern zu sprechen. Die georgischen Stämme haben sich jahrhundertelang bekriegt. Sie haben eigene Sprachen und starke Dialekte, regionale Küchen, unterschiedliche Temperamente. „Wir Georgier sind sehr individualistisch“, sagt der Dirigent Swimon Dschangulaschwili. „Wir haben zu allem immer gegensätzliche Meinungen. Das ist natürlich zur Hälfte ein Scherz. Wir streiten ständig über irgendetwas.“ Und das durchaus lautstark und temperamentvoll. „Wahrscheinlich ist deshalb bei uns die Polyphonie entstanden. Unsere Vorfahren konnten sich einfach nicht auf eine Stimme einigen.“ Der mehrstimmige Gesang der Georgier ist faszinierend und bei vielen Menschen auch berüchtigt. Die georgische Polyphonie zu lieben, aber ständig die Augen zu verdrehen und über diese Gesänge zu lästern, gehört auch zur Polyphonie der Georgier.
Im Nationalen Handschriftenzentrum Georgiens lagern die ältesten erhaltenen Niederschriften polyphoner Kirchengesänge. Eine stammt aus dem 10. Jahrhundert. Die schwarze Schrift ist geschwungen, zwischen den Zeilen große Abstände: Platz für Linien, Schnörkel und rote Häkchen für die Melodie. Dem Musiker Dschangulaschwili kommen die Tränen, wenn er sich weiße Schutzhandschuhe überstreift und das mehr als 1000 Jahre alte in Leder gebundene Buch in die Hände nimmt.
„Im Mittelalter fielen hier ständig irgendwelche Mächte ein: Perser, Türken, Seldschuken, Araber, Mongolen. Es war ein einziger blutiger Krieg. Dazu kämpften noch die georgischen Provinzfürsten gegeneinander. Es rührt mich zu Tränen, wenn ich daran denke, was unsere Vorfahren durchgemacht haben; und dass sie es trotzdem geschafft haben, solche Werke zu erschaffen und zu erhalten. Da ist ja nicht nur die Musik. Im 12. Jahrhundert entstand unser Nationalepos, ‚Der Ritter im Tigerfell‘, das erste Stück Renaissancedichtung. Unsere Königin Tamar hat bereits im 12. Jahrhundert die Todesstrafe verboten – im tiefsten Mittelalter, als überall gefoltert wurde. Sie hat sogar die Sklaverei verboten.“
Im Januar 1801 kamen die Russen. Das Zarenreich verleibte sich Georgien ein. Die russisch-orthodoxe Kirche hob die Eigenständigkeit der georgischen Kirche auf und verbot die polyphonen Kirchengesänge. Stattdessen musste die russische Liturgie gesungen werden. Einige Georgier dienten sich den Besatzern an, machten Karriere. Der georgische Nationaldichter Ilia Tschawtschawadse stellte sich ihnen entgegen und gründete die georgische Nationalbewegung.
Mit der Revolution in Russland 1917 wurde Georgien wieder frei. Das hielt aber nur drei Jahre. Im Februar 1921 kam die Rote Armee nach Georgien. Eine wichtige Rolle spielte dabei Iosseb Bessarionis dse Dschugaschwili, genannt Stalin, als Volkskommissar an der Seite Lenins. Stalin ist der berühmteste Georgier. Da es in den vergangenen 200 Jahren nicht so viele berühmte Georgier gab, sind manche stolz auf ihn, einfach, weil sie auch Georgier sind. Die Bolschewiken unter Stalin zerstörten Kirchen, erschossen Priester, vernichteten Bücher. Die wertvollen Handschriften mit den polyphonen Gesängen waren auch bedroht. Ein Mönch brachte sie an einen sicheren Ort, wickelte sie ein, vergrub sie und rettete sie so vor den Besatzern.
All diese Geschichten beweisen, dass Georgier wahrhaft freiheitsliebende Europäer sind. Doch als sie 1991 endlich das ihnen von Gott überlassene Land von den Besatzern befreien konnten, war der Garten Eden ziemlich heruntergerockt. Statt Milch und Honig führten die Flüsse giftige Chemikalien. Im Paradies herrschte Hunger. Die Hauptnahrungsmittel waren für viele Bohnen, Maisbrot und Kartoffeln. Und da dauernd der Strom und das Gas ausfielen, kochten viele gemeinsam in großen Töpfen auf offenem Feuer. Lediglich die gefürchteten Trinksprüche funktionierten, denn Alkohol gab es immer, Alkoholismus wurde zu einem der größten Probleme. Dazu kamen Drogen aller Art. Nicht nur die Landwirtschaft hatte massiven Schaden genommen, auch die Mentalität. In der Sowjetunion wurde eigenständiges Denken und Handeln nicht gerade gefördert, freie Menschen waren eine Bedrohung für die Kremlherrscher in Moskau. Während Letten, Litauer und Esten ihre wiedergewonnene Freiheit absicherten, versanken die Georgier in Depressionen, in Kriegen, die teils von Moskau aus gefördert, teils von Georgiern selbst angeheizt wurden. „Wo seid ihr?“, fragten die besorgten Freunde Georgiens im Baltikum, in Polen, in Westeuropa, als die nun freien Länder sich bereits ihren Platz am Tisch unter dem Schutzschirm der NATO gesichert hatten. Die Georgier waren auch diesmal zu spät.
200 Jahre Besatzung waren vorüber, und die Georgier wussten nichts mit der Freiheit anzufangen. Es ist schwer, eine freie Nation zu bilden, wenn es nicht genug Menschen gibt, die wissen, wie das geht: frei leben. „Tawisupleba“ war das erste Wort, das mir Georgier beigebracht haben. Erst dann folgten „Guten Tag“, „Bitte“, „Danke“, „Prost“.
Go West: Eineinhalb Jahre vor der Parlamentswahl
In Georgiens Hauptstadt Tiflis demonstrieren Tausende. Wie schon so oft in der Geschichte des Landes finden die Proteste auf dem Rustawelis Gamsiri statt, dem zentralen Boulevard, direkt vor dem Parlament. Der Asphalt glänzt, die Luft ist trüb vom Tränengas, dicker Rauch versperrt die Sicht, raubt den Demonstranten den Atem. Polizisten in schwarzer Schutzkleidung, mit Schilden und Knüppeln marschieren, unterstützt von Wasserwerfern, in dichten Blöcken und geschlossenen Reihen auf die Demonstranten zu. Die Georgier nennen sie „RoboCops“. Die Schlägertruppen sehen aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Das rote Leuchten von Pyrotechnik steigert die Dramatik. Eine Frau schwenkt mit aller Kraft eine Europafahne, widersteht dem Strahl des Wasserwerfers, weicht ein wenig zurück, kämpft sich wieder vor. Andere Demonstranten eilen zu ihr, greifen ihr, die furchtlos das blaue Banner mit dem Sternenkreis schwenkt, unter die Arme, damit sie nicht vom Wasserstrahl weggespült wird. Das Bild hat das Zeug, in die Geschichtsbücher einzugehen.
Es ist März 2023, und die Menschen protestieren gegen ein Gesetz, das sie „russisches Gesetz“ nennen. Es soll die Arbeit sogenannter NGOs in Georgien einschränken. Russland hat ein ähnliches Gesetz schon vor Jahren beschlossen. NGO steht für „non-governmental organization“, Nichtregierungsorganisation. Dazu gehören politische Stiftungen, Organisationen wie Transparency International, die sich weltweit um Korruptionsbekämpfung kümmern, und solche, die sich für Kinder, Arme oder Kranke einsetzen. Auch Kirchen, Kultur- und Sportvereine gehören zu den NGOs. Alle, die das Gemeinwesen, also die Zivilgesellschaft stärken. Sie sind ein Bindeglied zwischen Staat und Bevölkerung. NGOs sind das Rückgrat der Demokratie.
Georgien ist ein armes Land, deshalb werden die meisten NGOs aus dem Ausland unterstützt, vor allem aus Ländern der EU. Die georgische Regierung will nun ein Register sogenannter ausländischer Agenten einführen. Dort sollen sich alle NGOs und Medienorganisationen eintragen lassen, die mehr als 20 Prozent ihrer Finanzierung aus dem Ausland erhalten. Die Regierung sagt, das Gesetz sorge für Transparenz. Aber die NGOs machen längst öffentlich, wer sie finanziert. Viele auf ihrer Website, gegenüber den Behörden sowieso. Wenn sie sich künftig in ein Register eintragen, drohen ihnen stärkere Kontrollen und ein hoher bürokratischer Mehraufwand. Vor allem aber wirkt der Begriff „ausländischer Agent“ stigmatisierend. Er weckt Erinnerungen an die finsterste Zeit der Sowjetbesatzung. Der Vorwurf, ein ausländischer Agent zu sein, war in der paranoiden Sowjetunion zeitweise ein Todesurteil, selbst wenn nichts dran war.
Georgien ist Beitrittskandidat der EU. Die georgische Verfassung verpflichtet die Regierung, den EU- und den NATO-Beitritt voranzutreiben. Mit großem Rückhalt in der Bevölkerung. Quer durch alle Alters- und Bevölkerungsschichten sind 80 Prozent der Georgier dafür. Die EU signalisiert frühzeitig: Das NGO-Gesetz ist mit EU-Standards nicht vereinbar. Die georgische Regierung behauptet trotzdem das Gegenteil. Es hat den Anschein, als tue sie alles, um Georgien eben nicht in die EU zu führen. Nebenbei: Wenn Georgien in die EU möchte, warum soll dann die Zusammenarbeit der zivilgesellschaftlichen Organisationen mit den reicheren Partnern in der EU ein Problem sein?
In Wirklichkeit geht es den Mächtigen in Tiflis darum, unabhängige Kräfte zu schwächen und westliche Hilfe als feindlichen Einfluss zu brandmarken. Es geht darum, eine Kontrolle der Mächtigen und Kritik an der Regierungspolitik zu verhindern. Es geht aber auch gegen Umweltschutz, gegen soziale Hilfe für Arme, gegen alles, was schwache Gesellschaften wie Georgien aus eigener Kraft nicht hinbekommen und wofür sie Hilfe aus dem Ausland brauchen, um ihre Demokratie aufzubauen. Deshalb sind die Menschen im Frühjahr 2023 auf der Straße. Die EU bedeutet für sie vor allem eines: Schutz vor Russlands Unterwerfungswahn. Deshalb schwenken sie EU-Fahnen. Deshalb trotzen sie der Polizeigewalt.
Es gibt eine Gruppe von Ländern, die die Verbrechen der Sowjetunion klar benennen. Deren Solidarität untereinander ist nach dem Großangriff Russlands auf die Ukraine 2022 noch mal gestiegen. Das sind vor allem die baltischen Staaten und Polen. Für sie ist ganz klar, der Angriff auf die Ukraine ist der endgültige Beleg für den ungebrochenen Imperialismus Russlands. Eigentlich gehört Georgien auch in diesen Klub. Aber seit 2012 regiert in Georgien der Georgische Traum. Das ist die Partei des Oligarchen Bidsina Iwanischwili, der sein Vermögen in Russland gemacht hat. Der Georgische Traum ist angesichts der russischen Verbrechen gegen die Ukraine merkwürdig stumm. Die Regierung unterstützt nicht mal die Sanktionen der EU gegen Russland. Sie hat Zigtausende Russen ins Land gelassen, vielleicht sogar noch mehr. Mehreren ausgemachten russischen Regimekritikern haben die georgischen Behörden hingegen die Einreise verweigert. Und nun auch noch das „russische Gesetz“. Die Leute auf der Straße nennen den Georgischen Traum deshalb eine „russische“ Partei und sprechen von einem Albtraum. Tagelang dauert ihr Protest. Dann scheint die Regierung nachzugeben. Sie zieht den Entwurf zum NGO-Agentengesetz zurück. Doch die Demokraten geben sich keiner Illusion hin. Im Herbst 2024 sind Parlamentswahlen. Und viele sagen im Frühjahr 2023: Wenn wir diese Regierung dann nicht loswerden, ist es mit unserer europäischen Zukunft auf absehbare Zeit vorbei. Einige haben die Herausforderung angenommen.
An einem Abend im April 2023 bin ich mit Irakli, unserem Freund aus Poti, der längst in Tiflis lebt, unterwegs.
„Go West …“, schallt es aus Lautsprechern, „… life is peaceful there …“ Ein paar hundert Menschen haben sich vor der Staatskanzlei versammelt. Einige wippen mit. Später soll ein politischer Film gezeigt werden. „Thomas, lass uns mal den Organisator suchen“, schlägt Irakli vor. „Ich kenne den.“ In Tiflis kennt irgendwie jeder jeden.
„Go West, in the open air …“
Alle stehen rum, rauchen, ein paar Leute schwenken die rot-weißen georgischen und die blauen Europafahnen. Dazwischen immer wieder auch blau-gelbe Fahnen der Ukraine.
„Go West, where the skies are blue …“
Vorn steht die Videowand, auch darauf das blaue Banner Europas mit dem Sternenkreis. Dahinter eine Kette von Polizisten, unbewaffnet mit Basecaps, noch weiter hinten das Regierungsgebäude, das sie sichern, in gelbem Licht angestrahlter Sandstein, mehrere Stockwerke hoch, tiefer gelegte Fenster.
„Go West, this is what we’re gonna do …“
Ein junger Mann in T-Shirt und Sneakers geht aufgeregt neben der Leinwand auf und ab, redet mit den einen, geht gleich weiter zu anderen. Als er Irakli entdeckt, winkt er, kommt zu uns.
Sein Name ist Wassil Matitaischwili. Er ist bei der liberalen Oppositionspartei Europäisches Georgien aktiv. Sie veranstaltet den Abend. „Für mich persönlich ist ‚Go West‘ von den Pet Shop Boys das Lied“, sagt er. „Wir haben ein paar Songs ausgewählt, die mit der Idee vom Westen und der Entscheidung des georgischen Volkes für den Westen verbunden sind. Ich habe dabei festgestellt, dass fast jeder Rock ’n’ Roll-Popsong aus der westlichen Kultur für die ältere Generation irgendwie für Freiheit steht, egal, ob du Rolling Stones spielst oder Pet Shop Boys.“ Wassil ist 25 Jahre alt. „Für ältere Menschen sind das die Lieder, die sie in ihrer Jugend gehört oder entdeckt haben. In einer Zeit, in der das alles verboten war.“ In der Sowjetunion war westliche Popmusik sehr schwer zu bekommen. „Die erste Begegnung mit dieser Musik war damals irgendwie ein Symbol für das verlorene Leben der Menschen hier. Alles symbolisiert unsere Entscheidung für die Freiheit und unsere historische Mission.“ Damit meint er die Westintegration Georgiens. „Wir müssen das jetzt hinkriegen. Also, all diese Songs stehen für Freiheit. So haben wir die Playlist zusammengestellt. Und dann ist da noch das schwule Element. Irgendwie symbolisiert dieses Lied den schwulen Westen. Den guten schwulen Westen, nach dem wir uns sehnen.“
Die regierungsnahen Massenmedien haben verbreitet, heute Abend solle für die Rechte Homosexueller demonstriert werden. Homosexualität wird von der Regierung seit Jahren zu einem Riesenthema aufgebauscht, um den Menschen in Georgien Angst vor der EU zu machen. In Europa müssten Kinder homosexuell werden, Homosexualität sei eine ansteckende Krankheit – der ganze brandgefährliche Blödsinn, mit dem auch die russische Führung und Rechtsextreme Hass schüren. Sie sprechen von „Gayropa“ und von „Liberasten“. Das sind zentrale Begriffe der Kremlpropaganda. Das Wort „Liberast“ setzt sich aus Liberalismus und Päderast zusammen; „Gayropa“ ist eine Mischung aus Homosexualität und Europa. Weltweit behaupten Rechtsextreme, „Liberasten“ würden die Menschen zwingen, homosexuell zu werden. Auch der Georgische Traum versucht, Leichtgläubige und Ängstliche mit diesem Unsinn zu mobilisieren, und verbreitet, Liberale wollten die georgische Kultur zerstören und Georgien in einen Krieg mit Russland führen. Liberalen Werten setzt die Partei „traditionelle Werte“ entgegen, die es zu schützen gelte. Auch das ist ein Kampfbegriff der putinschen Propaganda und all derer, die den Menschen Angst vor der Zukunft machen, statt mit ihnen gemeinsam Probleme der Gegenwart zu bewältigen. Sie propagieren die „traditionelle Familie“ aus Mann, Frau und vielen Kindern.
In Georgien fällt das auf fruchtbaren Boden, denn das Wissen über Homosexualität ist extrem gering. Das macht es den Regierenden und der Kirche leicht, Homo-, Bi-, Trans-, Intersexuelle und alle anderen zu Sündenböcken zu machen, vor denen man sich und vor allem seine Familie schützen muss. Von besonders schlichten Gemütern und Menschen, die um ihre Identität ringen, kann das als Freibrief für Gewalt verstanden werden. Es gibt Menschen, die bereit sind, Minderheiten umzubringen. Man muss nur ihre Angst und ihr Unwissen in die richtige Bahn lenken. „Das ist die russische Agenda in diesem Land“, sagt Wassil. „Sie versuchen, verschiedene soziale Gruppen gegeneinander in Stellung zu bringen. Zuerst waren es religiöse Minderheiten, dann ethnische Minderheiten, jetzt sind es sexuelle Minderheiten.“ Im Herbst 2024 bekommt Georgien ein Gesetz, das die Rechte sexueller Minderheiten einschränkt – auch das nach russischem Vorbild.
Es geht an diesem Frühlingsabend 2023 in Tiflis aber gar nicht um die Rechte Homosexueller. Die Leute sind hier, um Freiheit für Lasare Grigoriadis zu fordern. Der wurde bei einer Demonstration gegen das NGO-Gesetz festgenommen. „Dieses Regime hat die Polizei in eine Kraft zur politischen Unterdrückung verwandelt. Das haben alle gesehen“, sagt Wassil. Der festgenommene Lasare wird beschuldigt, einen Molotowcocktail auf Polizisten geworfen zu haben. Viele vermuten, dass er auch wegen seines Aussehens herausgegriffen wurde. Er hat blond-strähnige Haare, Piercings am Kinn und an der rechten Augenbraue, Ohrringe. Um die Augen ist er tätowiert. Lasare Grigoriadis taugt als Bürgerschreck für alle, die sich von Äußerlichkeiten leiten lassen und die einen engen Konformismus für verpflichtend halten. „Sie haben bewusst jemanden aus der Generation Z eingesperrt“, sagt auch Wassil, selbst ein Vertreter dieser Generation. „Die Botschaft heißt: Dies ist der Preis, den ihr für den Kampf für den historischen Westkurs Georgiens zahlt. Die Leute sollen Angst haben, gegen das putinistische Regime in Georgien vorzugehen.“ Wassil redet schnell. Er hat die ganze Nacht und auch heute noch an dem Film geschnitten, der gleich gezeigt wird. Er ist nervös.
Der Film startet mit Bildern von der großen Demonstration Anfang März gegen das NGO-Gesetz, bei der Lasare Grigoriadis festgenommen wurde. Das Gesetz sei „ein Angriff auf die große Idee, dass der Westen uns hilft, den postsowjetischen Sumpf loszuwerden und irgendwie ein vollwertiges Mitglied der westlichen internationalen Gemeinschaft zu werden“, sagt Wassil. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Regierenden jene mafiösen Seilschaften gern erhalten möchten. „Ich denke, jeder Polizist muss auch irgendwann begreifen, dass wir nicht gegeneinander stehen, sondern gegen die vereint sind, die versuchen, uns von unserem historischen Weg abzubringen. Also von Europa.“
Als auf der Leinwand das Bild der Frau mit der Europafahne im Strahl des Wasserwerfers zu sehen ist, jubeln die Menschen. Als Regierungspolitiker gezeigt werden, ruft jemand „Sklaven“. „Wir haben es geschafft, Georgien aus dem Krieg herauszuhalten“, behauptet ein Regierungspolitiker im Film. Wieder buhen ein paar Leute. „Das ist ihre zentrale Botschaft“, sagt Irakli. „Wir sorgen dafür, dass es hier nicht so schlimm wird wie in der Ukraine. Wenn ihr aber die Opposition wählt, bekommt ihr Krieg. Ihr habt die Wahl zwischen Krieg und uns als Garant für Frieden.“ Der Premierminister spricht von einer ominösen „globalen Kriegspartei“, die in Georgien eine zweite Front gegen Russland aufmachen wolle. Das ist auch das, was ich in den vergangenen Tagen in Tiflis und im Land von vielen, gerade älteren Leuten gehört habe. „Bloß kein Krieg. Das Wichtigste ist Frieden.“ Sie sagen das auf Russisch, weil sie kein Englisch können und ich zu wenig Georgisch. Für mich fühlt es sich an, als würden sie die Propagandafloskel der Sowjetunion wiederholen. Sie sind traumatisiert von den Kriegen in den 90er Jahren und vom russischen Einmarsch 2008. Russland hat ein Fünftel des georgischen Staatsgebietes besetzt und dort Tausende Soldaten stationiert. Die Bedrohung ist real.
„Wir brauchen einen Mentalitätswechsel“, sagt Wassil. „Wir lassen uns unsere Zukunft nicht von einem russischen Oligarchen und seinen Marionetten kaputt machen. Wir sind nicht bereit, zu akzeptieren oder uns daran zu gewöhnen, dass wir nicht erfolgreich sein können. Wir werden nicht akzeptieren, dass wir keine vollwertigen Mitglieder in der westlichen Gemeinschaft werden. Nur das schützt uns vor Russland. Wir akzeptieren nicht, dass uns ständig Krieg droht. Im Grunde schüren sie Hass und Angst in der Gesellschaft und wollen uns dadurch brechen. Aber das werden sie nicht schaffen.“
Wie zur Bestätigung sind im Film nun Bilder aus dem Jahr 2013 zu sehen. Auch damals schon regierte der Georgische Traum. Eine Reihe bärtiger orthodoxer Priester in vollem Ornat mit dicken Kreuzen um den Hals führte eine aufgebrachte Menschenmenge an. Es waren Tausende, die ganze Straße war voll. Sie hatten es auf die Tbilisi Pride abgesehen. Rund hundert Homosexuelle und ihre Freunde haben damals versucht, eine erste kleine lesbisch-schwule Solidaritätsparade abzuhalten. Die Polizei wusste, was kommt, hatte Kleinbusse bereitgestellt, um die Demonstranten in Sicherheit zu bringen. Daraufhin griff der Mob die Kleinbusse an. Als sie auch da keinen zu fassen bekamen, den sie hätten lynchen können, zog der orthodoxe Pöbel weiter durch die Straßen auf der Suche nach Opfern. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand ums Leben kam. Wer möchte, kann sich bei YouTube ein Bild von den Ausschreitungen machen. Die Behörden haben zwar das Leben der Demonstrierenden gerettet, ihre Pflicht wäre es aber gewesen, das Pogrom zu verhindern und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Wassil Matitaischwili war bei der Pride Parade 2013 in Tiflis noch ein Teenager. „Schwule Themen sind irgendwie auch zu einem Symbol für unseren Kampf für die Westintegration und für Freiheit geworden“, meint er. „Wenn wir in Frieden koexistieren wollen, müssen wir sicherstellen, dass auch in Georgien alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind.“
Im Film schlagen jetzt Radikale einen Kameramann zusammen. Er ist an den Folgen des Angriffs gestorben. Männer mit Christusfahnen verbrennen voller Wut Europafahnen. Das ist in Georgien verboten. Niemand griff ein.
„In den letzten drei oder vier Jahren haben die Polizisten viele illegale Anordnungen ausgeführt, in einigen Fällen waren sie sogar verfassungswidrig“, beklagt Matitaischwili. „Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem die Leute kein Vertrauen mehr in die Polizei haben.“ Dieses Gefühl wird sich noch verfestigen.
An diesem Abend halten sich die Polizisten zurück. Eine junge Frau mit blonden Rastalocken hüpft vor ihnen herum, zeigt ihnen ein Schild mit dem stilisierten Konterfei des festgenommenen Lasare Grigoriadis. Darauf steht: „Ich war’s!“ Gemeint ist der Molotowcocktail, den Lasare geworfen haben soll. Viele hier tragen so ein Schild. „Dieser Junge soll für sieben oder elf Jahre ins Gefängnis. Er ist 21 Jahre alt“, sagt Tea, die selbst erst 18 ist. „Sein Leben soll zerstört werden. Wir sind hier, um zu sagen, dass das nicht fair ist. Also protestieren wir gegen diese Bastarde. Ich weiß nicht, was zum Teufel sie vorhaben.“ Furcht, dass sie auch festgenommen wird, hat sie nicht. Tea geht noch zur Schule, lebt bei ihren Eltern. „Natürlich machen sie sich Sorgen. Aber sie sind stolz auf mich.“ Das geht vielen Georgiern so, die selbst schon etwas für den Schutz ihres Landes vor den kolonialen Gelüsten russischer Machthaber riskiert haben. Nun tun das ihre Kinder und Enkelkinder. „Ich möchte nicht von Russland regiert werden. Ich will in Georgien leben, nicht in Russland.“
Der Film ist zu Ende. Die Leute klatschen, ein paar jubeln sich selbst Mut zu für den Kampf, der auf sie zukommt, um Georgiens Weg in die EU zu retten. Dann erscheint auf der Leinwand die blaue Europafahne, und die Europahymne erklingt: „Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.“ Der Platz erstrahlt im Licht der Handylampen. Einige singen mit. Es folgt die georgische Hymne, und jetzt singen alle. „Meine Heimat ist meine Ikone“, heißt es darin. „Unsere heutige Freiheit, lobpreist unsere Zukunft, gepriesen sei die Freiheit, die Freiheit sei gepriesen.“ Beats setzen ein, und aus den Jubelnden werden Tanzende. Tiflis ist ein Mekka der Technoszene. International stehen georgische DJs hoch im Kurs. Tea ballt die Faust, hält ihr Schild hoch.
Neben der 18-Jährigen tanzt ein schlaksiger alter Mann. Seine Bewegungen sind geschmeidig, seine Augen geschlossen. Er trägt eine enge helle Hose und auf dem Kopf eine Schiebermütze. Kote Kubaneischwili ist 72 Jahre alt und einer der bekanntesten Dichter Georgiens. „Immer sehnen wir uns danach, Europa zu sein, europäisch. Und wir haben es nicht nur verdient, historisch SIND wir Europa.“ Kubaneischwilis Englisch ist schlecht. Ins Russische wechseln möchten wir beide nicht. „Ich spreche sehr gut Russisch. Und meine engsten Freunde sind sehr berühmte russische Dichter. Einige leben jetzt in Georgien. Ich kann den alten Lermontow auswendig, Brodsky, Tarkowski. Aber ich lehne es ab, Russisch zu sprechen. Ich habe 40 Jahre für die Freiheit gekämpft, für unsere Zukunft, denn wir haben eine! Als ich geboren wurde, war Stalin noch am Leben. Mein Großvater wurde 1937 erschossen. Und jetzt müssen wir irgendwie wieder versuchen, gegen Russland zu überleben. Und deshalb tanzen wir, denn das ist unsere einzige Chance!“ Kubaneischwili gleitet wieder weg, verliert sich kurz im Beat und kommt wieder zurück. Nun fällt er doch ins Russische: „Hier, diese jungen Leute sind das heutige Georgien. Die sind heute Sakartwelo.“ Sakartwelo ist die georgische Bezeichnung für Georgien. „Sie müssen die Führung übernehmen und diese Verräter und Kollaborateure vertreiben.“ Das sei leider alles nicht neu, sagt er und federt weiter im Beat des Basses mit den Beinen. „In Russland gibt es nur sehr wenige gute Menschen. Aber ich bin natürlich Optimist. Ich bin Poet. Ich weiß, wenn ich jetzt nicht für Georgiens Freiheit sterbe, wird mein Enkel nicht in einem freien Land leben. Aber dafür sterbe ich gern.“
Am Ende waren etwa 1000 Leute da. Wenig findet Wassil, aber es sei ein Wochentag und das Wetter nicht bombig. „Dass vorher behauptet wurde, es gehe um die Rechte Homosexueller, hat mit Sicherheit auch noch mal Menschen abgeschreckt. Ich denke, wir sollten eine weitere Kundgebung für Lasare organisieren, aber an einem Samstag.“ Wassil wirkt jetzt ein bisschen entspannter. „Ich bin froh, dass alles gut gelaufen ist. Ich bin wirklich überarbeitet. Aber wir machen weiter.“
Europa oder Russland? Im März 2023 hat der Georgische Traum den Demokraten den Fehdehandschuh hingeworfen. Sie haben ihn aufgenommen. Ihnen bleiben anderthalb Jahre bis zum Showdown bei der Parlamentswahl im Herbst 2024. Bis dahin wird der Georgische Traum das NGO-Agentengesetz, das sie das „russische Gesetz“ nennen, in einem zweiten Anlauf verabschieden und damit einen Bruch der georgischen Regierung mit der EU herbeiführen.
Der Mann mit dem Füllhorn: Bidsina Iwanischwili
Die Wut der Demonstranten in Tiflis richtet sich gegen den Georgischen Traum, den sie „Russische Partei“ nennen, vor allem aber gegen den Oligarchen, der die Partei gegründet hat. Seit mehr als zehn Jahren bestimmt Bidsina Iwanischwili die Politik in Georgien. Wer ist dieser Mann?
Am 19. August 2012 ist im Zentrum von Rustawi eine gewaltige Bühne aufgebaut, ganz in Blau. Bereits am Nachmittag fahren Autos laut hupend durch die geraden, teils von Bäumen gesäumten Straßen der Industriestadt. Junge Leute recken die Arme aus den Fenstern, lassen blaue Fahnen im Wind flattern, formen die Finger zum Victory-Zeichen. Helfer verteilen blaue T-Shirts an die Passanten. Denn an diesem Abend spricht Bidsina Iwanischwili, und von ihm erwarten viele Wunder. Vor wenigen Monaten hat er sich seine eigene Partei geschaffen, und deren Farbe ist Blau. Ihr Name, Georgischer Traum, wirkt wie eine Verheißung, und für den Milliardär ist sie eine lohnende Investition in die Zukunft. Am 1. Oktober 2012 stehen Parlamentswahlen an. Iwanischwili will die seit 2004 regierende Nationale Bewegung von Präsident Micheil Saakaschwili ablösen. Seine Partei hat ziemlich abgewirtschaftet. Iwanischwili selbst strebt das Amt des Premierministers an. Auf der Bühne steht in riesigen Buchstaben: „Gemeinsam müssen wir den Georgischen Traum verwirklichen.“
Rustawi liegt eine halbe Stunde Fahrt von Tiflis entfernt in einer Ebene. Die Stadt ist vergiftet und heruntergekommen. Die Häuser sind grau. Die Luft ist schlecht, den Fabriken fehlen Filteranlagen. Rustawi ist gesundheitsschädigend. Aus den einst in der Sowjetunion billig zusammengesetzten Plattenbauten ragen Stahlträger, die Fenster sind verrottet, Müll liegt vor den Häusern. Im Schatten unter einem Baum sitzen ein paar Männer um die 50 und rauchen. Sie sind mit einem Minibus aus Tiflis gekommen, um Iwanischwili zu unterstützen. Auf keinen Fall wollten sie zu spät kommen und etwas verpassen. „Bidsina ist Geschäftsmann“, sagt einer der Männer, „er versteht etwas vom Business. Er hat sich selbst hochgearbeitet. Als Kind ist er barfuß gelaufen, weil seine Eltern ihm nicht mal Schuhe kaufen konnten. Er wird dafür sorgen, dass jeder hier ein Geschäft aufmachen kann, und er wird jedem helfen.“ Der Mann heißt Wasso und ist arbeitslos. Wasso erzählt, er habe bis vor einigen Jahren in der Stadtverwaltung von Tiflis gearbeitet. Dann sei er entlassen worden. „Iwanischwili hat schon viel für Georgien getan. Er ist die einzige Hoffnung für Georgien. Wenn er gewinnt, geht es mit Georgien endlich bergauf.“ Von dem jetzigen Präsidenten Micheil Saakaschwili und seiner Regierung sind die Männer tief enttäuscht. Als Mischa, wie ihn in Georgien alle nennen, vor acht Jahren an die Macht kam, hatten sie an ihn ähnlich hohe Erwartungen. Die friedliche „Rosenrevolution“ 2003 war ein Aufbruch. Endlich sollte Schluss sein mit der ewigen Korruption, die alle beutelte. Es sollte Arbeit und Wohlstand geben. Saakaschwili schien der Garant für Freiheit und Reformen, für Demokratie und Westbindung. Seine Popularität stieg ihm irgendwann zu Kopf.
„Mischas erste zwei Jahre waren ja auch gut. Er hat die Polizei reformiert und Straßen gebaut. Anders als früher haben wir jetzt Strom. Aber wissen Sie, was der kostet? Fünf Mal so viel wie früher!“ Die anderen nicken. Ein Huhn läuft vorbei, pickt im Staub. „Bidsina ist ein ehrlicher Mensch“, sagt Wasso. In Georgien klaffen der demokratische Anspruch und die Realität acht Jahre nach der Rosenrevolution massiv auseinander. Die Georgier sind auf der Suche nach Orientierung.
An einer Hauswand ist ein Gemüsestand aufgebaut. Es gibt dicke Bündel mit lila Basilikum, Estragon, frischen Lauch, die ersten dunklen Weintrauben und in Eimern fast schwarze Maulbeeren. Eine Frau packt Tomaten, Gurken, Paprika und Kräuterbündel in eine Einkaufstasche. Sie kommt gerade von der Arbeit in einer der Fabriken. „Mein Mann ist Rentner“, erzählt sie. Die beiden seien zu zweit, sie selbst sei eine einfache Arbeiterin. „Wer haushaltet, kommt zurecht. Die Leute müssen eben das Licht nicht überall brennen lassen.“
Strom ist im Sommer 2012 ein Politikum. In der Sowjetunion kostete Strom fast nichts. Saakaschwilis Vorgänger, Eduard Schewardnadse, hatte vieles einfach laufen lassen. Strom gab es ohnehin unregelmäßig, und wenn jemand nicht bezahlt hatte, blieb das zunächst ohne Folgen. Wenn es zu arg wurde, stellte die Stadt die Versorgung im ganzen Viertel ab – und irgendwann wieder an. Saakaschwili hat das nach der Rosenrevolution verändert. Er hat die Infrastruktur reparieren lassen. Nun gab es Stromzähler, und die Georgier mussten ihren Verbrauch bezahlen. Wer das nicht tat, dem wurde der Strom abgestellt. Saakaschwili bezahlte die Reformen mit Sympathiepunkten. „Wer vernünftig mit seinem Geld umgeht, der kann sich in Georgien ein Leben auf mittlerem Niveau leisten“, sagt die Arbeiterin am Gemüsestand in Rustawi. „Ich behaupte nicht, dass ich prassen kann. Aber ich habe etwas anzuziehen, und ich muss nicht hungern.“ Iwanischwilis Auftritt am Abend interessiert sie nicht besonders. „Verglichen mit den schlimmen 90er Jahren geht es uns sogar richtig gut. Man muss sich halt ein bisschen anstrengen. Außerdem kann man jetzt abends ohne Angst auf die Straße gehen. Man kann sein Auto parken und muss nicht fürchten, dass es im nächsten Moment gestohlen wird. Das ist auch schon viel wert – verglichen mit früher.“
Vertreter der Zivilgesellschaft, unabhängige Juristen, Journalisten kritisieren Saakaschwili scharf. Er lässt gegen Journalisten vorgehen, die über Skandale in seinem Umfeld berichten. Und sein Staatsapparat macht vor der Wahl 2012 Druck. Ganz undemokratisch, ganz im Stil der Vergangenheit, die Georgien unter Saakaschwili schon mal überwunden hatte. Seine Leute versuchen, Wähler zu beeinflussen. Beamte und auch private Unternehmer würden sehr genau beobachten, wer zu den Wahlkampfveranstaltungen der Opposition geht, sagt Tamar Tschugoschwili von der Vereinigung junger Anwälte, einer Organisation, die seit Jahren hochprofessionell Wahlen in Georgien beobachtet. „Beamte fordern ihre Untergebenen auf, Namenslisten mit jeweils zehn Anhängern der Regierungspartei zusammenzustellen. Die Leute bekommen sogar Formulare, in die sie Daten ihrer Verwandten und Freunde eintragen sollen.“ Tschugoschwili sagt, sie wisse von vielen solchen Fällen. „Wir können aber nicht dagegen vorgehen. Niemand ist bereit, diese Einschüchterungsversuche anzuzeigen. Die Kläger müssten dafür ihre Namen preisgeben, davor haben die Menschen Angst.“ So bleiben die Vorwürfe auf der Ebene von Gerüchten. Das heizt das gegenseitige Misstrauen weiter an und vertieft den Spalt zwischen dem Lager von Saakaschwili und dem von Iwanischwili.
Auch das Chaos bei den Meinungsumfragen erhöht das Vertrauen der Bürger in den Staat nicht. „Sobald eine Umfrage herauskommt, folgen auf der Stelle drei oder vier andere, teils im Auftrag der Regierung, teils im Auftrag der Opposition, und alle widersprechen einander“, erläutert Tschugoschwili. „Sie weichen so stark voneinander ab, dass man nicht mal einen Trend ausmachen kann.“ Im August 2012 variiert die Zustimmung zu Iwanischwili zwischen 20 und 70 Prozent, je nachdem, wer die Umfrage zu verantworten hat. Planen kann man damit nicht. Doch die Wechselstimmung ist spürbar.
Noch gut eine Stunde bis zum Wahlkampfauftritt von Iwanischwili. Vor der Bühne schwenkt eine Frau ein georgisches und ein blaues Parteifähnchen. Ihren Namen möchte sie lieber nicht nennen. Warum? „Eine Bekannte von mir arbeitet in der Kühlgasfabrik. Neulich hat sie eine Wahlkampfbroschüre von Iwanischwili mit zur Arbeit gebracht. Ihr Vorgesetzter hat das gesehen und ihr gedroht: Wenn du Iwanischwili wählst, fliegst du. Er hat ihren Namen notiert und zehn Männer verwarnt, die Sympathien für Iwanischwili geäußert haben.“