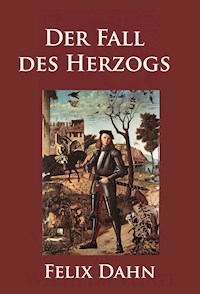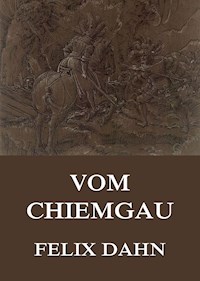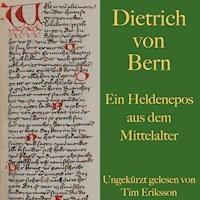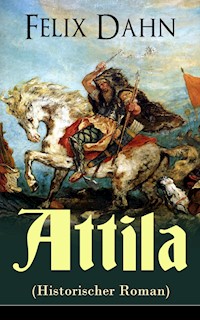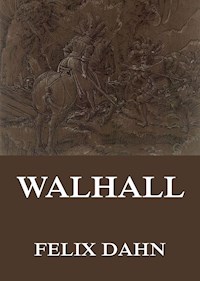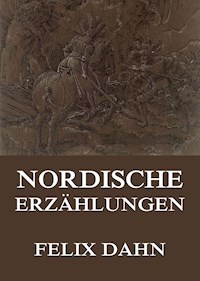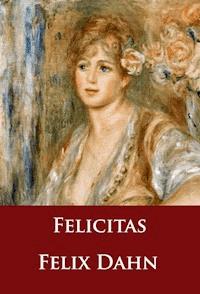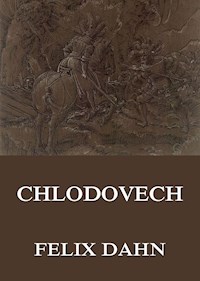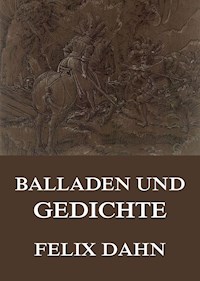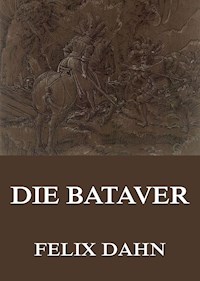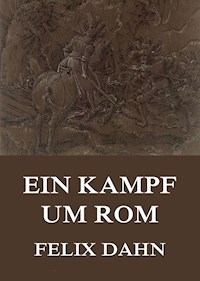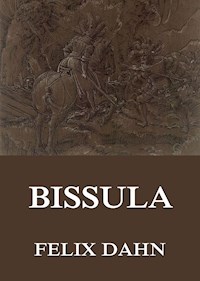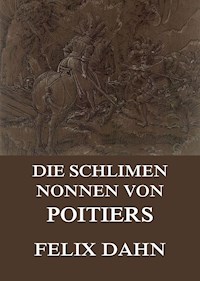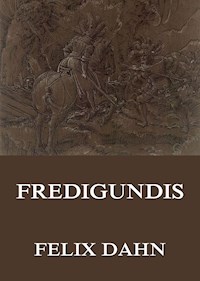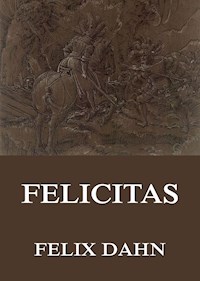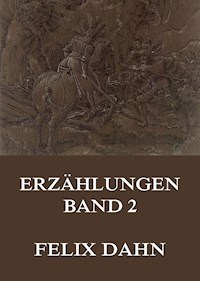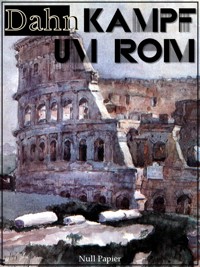
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Komplettveröffentlichung aller sieben Bände. 1876 veröffentlichte der Historiker Felix Dahn sein epochales Werk, das wohl als der erste deutschsprachige Historienroman bezeichnet werden kann und ein großer Erfolg wurde. Es ist die Amtszeit des letzten Römischen Kaisers der Antike Justinian. Das Byzantinische Reich kämpft gegen den Einfall der Goten. Dahn achtete darauf, seine Geschichte so historisch korrekt wie möglich zu schreiben. Um die Fakten spann er einen spannenden Bestseller, der bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ein großer Erfolg war und sich millionenfach verkaufte. Der Roman wurde 1968 von dem Berliner Filmproduzenten Artur Brauner unter der Regie von Robert Siodmak mit Laurence Harvey und Orson Welles verfilmt. »Ein mit Kontrasteffekten glänzend operierendes Riesenfresko, dessen Figuren sich mir, gewiss nicht zufällig, am stärksten eingeprägt haben.« [Marcel Reich-Ranicki] Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1605
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Felix Dahn
Kampf um Rom
Historischer Roman
Felix Dahn
Kampf um Rom
Historischer Roman
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954184-01-9
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Zum Buch
Erstes Buch: Theoderich
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Zweites Buch: Athalarich
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Drittes Buch: Amalaswintha
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Viertes Buch: Theodahad
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünftes Buch: Witichis -- Erste Abteilung
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Fünftes Buch: Witichis -- Zweite Abteilung
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Sechstes Buch: Totila -- Erste Abteilung
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Sechstes Buch: Totila -- Zweite Abteilung
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Sechsunddreißigstes Kapitel
Siebenunddreißigstes Kapitel
Achtunddreißigstes Kapitel
Neununddreißigstes Kapitel
Vierzigstes Kapitel
Siebentes Buch: Teja
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Zum Buch
Komplettveröffentlichung aller sieben Bände.
1876 veröffentlichte der Historiker Felix Dahn sein epochales Werk, das wohl als der erste deutschsprachige Historienroman bezeichnet werden kann und ein großer Erfolg wurde.
Es ist die Amtszeit des letzten Römischen Kaisers der Antike Justinian. Das Byzantinische Reich kämpft gegen den Einfall der Goten.
Dahn achtete darauf, seine Geschichte so historisch korrekt wie möglich zu schreiben. Um die Fakten spann er einen spannenden Bestseller, der bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ein großer Erfolg war und sich millionenfach verkaufte.
Der Roman wurde 1968 von dem Berliner Filmproduzenten Artur Brauner unter der Regie von Robert Siodmak mit Laurence Harvey und Orson Welles verfilmt.
*
»Ein mit Kontrasteffekten glänzend operierendes Riesenfresko, dessen Figuren sich mir, gewiss nicht zufällig, am stärksten eingeprägt haben.« [Marcel Reich-Ranicki]
Erstes Buch: Theoderich
»Dietericus de Berne, de quocantant rustici usque hodie.«
Erstes Kapitel
Es war eine schwüle Sommernacht des Jahres fünfhundertsechsundzwanzig nach Christus.
Schwer lagerte dichtes Gewölk über der dunklen Fläche der Adria, deren Küsten und Gewässer zusammenflossen in unterscheidungslosem Dunkel: nur ferne Blitze warfen hier und da ein zuckendes Licht über das schweigende Ravenna. In ungleichen Pausen fegte der Wind durch die Steineichen und Pinien auf dem Höhenzug, welcher sich eine gute Strecke westlich von der Stadt erhebt, einst gekrönt von einem Tempel des Neptun, der, schon damals halb zerfallen, heute bis auf dürftige Spuren verschwunden ist.
Es war still auf dieser Waldhöhe: nur ein vom Sturm losgerissenes Felsstück polterte manchmal die steinigen Hänge hinunter und schlug zuletzt platschend in das sumpfige Wasser der Kanäle und Gräben, die den ganzen Kreis der Seefestung umgürteten.
Oder in dem alten Tempel löste sich eine verwitterte Platte von dem getäfelten Dach der Decke und fiel zerspringend auf die Marmorstufen, -- Vorboten von dem drohenden Einsturz des ganzen Gebäudes.
Aber dies unheimliche Geräusch schien nicht beachtet zu werden von einem Mann, der unbeweglich auf der zweithöchsten Stufe der Tempeltreppe saß, den Rücken an die höchste Stufe gelehnt, und schweigend und unverwandt in einer Richtung über die Höhe hinab nach der Stadt zu blickte.
Lange saß er so: regungslos, aber sehnsüchtig wartend: er achtete es nicht, daß ihm der Wind die schweren Regentropfen, die einzeln zu fallen begannen, ins Gesicht schlug und ungestüm in dem mächtigen, bis an den ehernen Gurt wallenden Bart wühlte, der fast die ganze breite Brust des alten Mannes mit glänzendem Silberweiß bedeckte.
Endlich stand er auf und schritt einige der Marmorstufen nieder: »Sie kommen«, sagte er.
Es wurde das Licht einer Fackel sichtbar, die sich rasch von der Stadt her dem Tempel näherte: man hörte schnelle, kräftige Schritte, und bald danach stiegen drei Männer die Stufen der Treppe herauf.
»Heil, Meister Hildebrand, Hildungs Sohn!« rief der voranschreitende Fackelträger, der jüngste von ihnen, in gotischer Sprache mit auffallend melodischer Stimme, als er die lückenhafte Säulenreihe des Pronaos, der Vorhalle, erreichte.
Er hob das Windlicht hoch empor -- schöne, korinthische Erzarbeit am Stiel, durchsichtiges Elfenbein bildete den vierseitigen Schirm, und den gewölbten durchbrochenen Deckel -- und steckte es in den Erzring, der die geborstene Mittelsäule zusammenhielt.
Das weiße Licht fiel auf ein apollinisch schönes Antlitz mit lachenden, hellblauen Augen; mitten auf seiner Stirn teilte sich das lichtblonde Haar in zwei lang fließende Lockenwellen, die rechts und links bis auf seine Schultern wallten; Mund und Nase, fein, fast weich geschnitten, waren von vollendeter Form, ein leichter Anflug goldhellen Bartes deckte die freundlichen Lippen und das leicht gespaltene Kinn; er trug nur weiße Kleider; einen Kriegsmantel von feiner Wolle, durch eine goldene Spange in Greifengestalt auf der rechten Schulter festgehalten, und eine römische Tunika von weicher Seide, beide mit einem Goldstreif durchwirkt: weiße Lederriemen befestigten die Sandalen an den Füßen und reichten, kreuzweis geflochten, bis an die Knie; die nackten, glänzendweißen Arme umwirkten zwei breite Goldreife: und wie er, die Rechte um eine hohe Lanze geschlungen, die ihm zugleich als Stab und als Waffe diente, die Linke in die Hüfte gestemmt, ausruhend von dem Gang, zu seinen langsameren Weggenossen hinunterblickte, schien in den grauen Tempel eine jugendliche Göttergestalt aus seinen schönsten Tagen wieder eingekehrt.
Der zweite der Ankömmlinge hatte, trotz einer allgemeinen Familienähnlichkeit, doch einen von dem Fackelträger völlig verschiedenen Ausdruck.
Er war einige Jahre älter, sein Wuchs war derber und breiter -- tief in den mächtigen Stiernacken hinab reichte das dicht und kurz gelockte braune Haar -- und von fast riesenhafter Höhe und Stärke: in seinem Gesicht fehlte jener sonnige Schimmer, jene vertrauende Freude und Lebenshoffnung, welche die Züge des jüngeren Bruders verklärten: statt dessen lag in seiner ganzen Erscheinung der Ausdruck von bärenhafter Kraft und bärenhaftem Mut: er trug eine zottige Wolfsschur, deren Rachen, wie eine Kapuze, sein Haupt umhüllte, ein schlichtes Wollenwams darunter, und auf der rechten Schulter eine kurze, wuchtige Keule aus dem harten Holz einer Eichenwurzel.
Bedächtigen Schrittes folgte der dritte, ein mittelgroßer Mann von gemessen verständigem Ausdruck. Er trug den Stahlhelm, das Schwert und den braunen Kriegsmantel des gotischen Fußvolks. Sein schlichtes, hellbraunes Haar war über der Stirn geradlinig abgeschnitten: eine uralte germanische Haartracht, die schon auf römischen Siegessäulen erscheint und sich bei dem deutschen Bauer bis heute erhalten hat. Aus den regelmäßigen Zügen des offenen Gesichts, aus dem grauen, sichern Auge sprachen besonnene Männlichkeit und nüchterne Ruhe.
Als auch er die Cella des Tempels erreicht und den Alten begrüßt hatte, rief der Fackelträger mit lebhafter Stimme:
»Nun, Meister Hildebrand, ein schönes Abenteuer muß es sein, zu dem du uns in solch unwirtlicher Nacht in diese Wildnis von Natur und Kunst geladen hast! Sprich -- was soll’s geben?«
Statt der Antwort fragte der Alte, sich zu dem Letztgekommenen wendend: »Wo bleibt der Vierte, den ich lud?«
»Er wollte allein gehen. Er wies uns alle ab. Du kennst ja seine Weise.«
»Da kommt er!« rief der schöne Jüngling, nach einer andern Seite des Hügels deutend.
Wirklich nahte dorther ein Mann von höchst eigenartiger Erscheinung.
Das volle Licht der Fackel beleuchtete ein geisterhaft bleiches Antlitz, das fast blutleer schien; lange, glänzend schwarze Locken hingen von dem unbedeckten Haupt wie dunkle Schlangen wirr bis auf die Schultern. Hochgeschweifte, schwarze Brauen und lange Wimpern beschatteten die großen, melancholischen dunklen Augen voll verhaltner Glut, eine Adlernase senkte sich sehr scharfgeschnitten gegen den feinen, glattgeschorenen Mund, den ein Zug resignierten Grames umfurchte.
Gestalt und Haltung waren so jugendlich: aber die Seele schien vor der Zeit vom Schmerz gereift.
Er trug Ringpanzer und Beinschienen von schwarzem Erz, und in seiner Rechten blitzte ein Schlachtbeil an langem, lanzengleichen Schaft. Nur mit dem Haupte nickend, begrüßte er die andern und stellte sich hinter den Alten, der sie nun alle vier dicht an die Säule, welche die Fackel trug, treten hieß und mit gedämpfter Stimme begann:
»Ich habe euch hierher beschieden, weil ernste Worte müssen gesprochen werden, unbelauscht und zu treuen Männern, die da helfen mögen.
Ich sah umher im ganzen Volk, mondenlang: -- euch hab’ ich gewählt, ihr seid die Rechten. Wenn ihr mich angehört habt, so fühlt ihr von selbst, daß ihr schweigen müßt von dieser Nacht.«
Der dritte, der mit dem Stahlhelm, sah den Alten mit ernsten Augen an: »Rede«, sagte er ruhig, »wir hören und schweigen. Wovon willst du zu uns sprechen?«
»Von unserm Volk, von diesem Reich der Goten, das hart am Abgrund steht.«
»Am Abgrund?« rief lebhaft der blonde Jüngling. Sein riesiger Bruder lächelte und erhob aufhorchend das Haupt.
»Ja, am Abgrund«, rief der Alte, »und ihr allein, ihr könnt es halten und retten.«
»Verzeih dir der Himmel deine Worte!« -- fiel der Blonde lebhaft ein -- »haben wir nicht unsern König Theoderich, den seine Feinde selbst den Großen nennen, den herrlichsten Helden, den weisesten Fürsten der Welt? Haben wir nicht dies lachende Land Italia mit all seinen Schätzen? Was gleicht auf Erden dem Reich der Goten?«
Der Alte fuhr fort: »Hört mich an. König Theoderich, mein teurer Herr und mein lieber Sohn, was der wert ist, wie groß er ist -- das weiß am besten Hildebrand, Hildungs Sohn. Ich hab’ ihn vor mehr als fünfzig Jahren auf diesen Armen seinem Vater als ein zappelnd Knäblein gebracht und gesagt: ›Das ist starke Zucht: Du wirst Freude dran haben.‹
Und wie er heranwuchs -- ich habe ihm den ersten Bolz geschnitzt und ihm die erste Wunde gewaschen! Ich habe ihn begleitet nach der goldnen Stadt Byzanz und ihn dort gehütet, Leib und Seele. Und als er dieses schöne Land erkämpfte, bin ich vor ihm hergeritten, Fuß für Fuß, und habe den Schild über ihn gehalten in dreißig Schlachten. Wohl hat er seither gelehrtere Räte und Freunde gefunden als seinen alten Waffenmeister, aber klügere schwerlich und treuere gewiß nicht. Wie stark sein Arm gewesen, wie scharf sein Auge, wie klar sein Kopf, wie schrecklich er war unterm Helm, wie freundlich beim Becher, wie überlegen selbst den Griechlein an Klugheit, das hatte ich hundertmal erfahren, lange ehe dich, du junger Nestfalk, die Sonne beschienen.
Aber der alte Adler ist flügellahm geworden!
Seine Kriegsjahre lasten auf ihm -- denn er und ihr und euer Geschlecht, ihr könnt die Jahre nicht mehr tragen wie ich und meine Spielgenossen: er liegt krank, rätselhaft krank an Seele und Leib in seinem goldnen Saal dort unten in der Rabenstadt. Die Ärzte sagen, wie stark sein Arm noch sei, jeder Schlag des Herzens mag ihn töten wie der Blitz, und auf jeder sinkenden Sonne mag er hinunterfahren zu den Toten. Und wer ist dann sein Erbe, wer stützt dann dieses Reich? Amalaswintha, seine Tochter, und Athalarich, sein Enkel: -- ein Weib und ein Kind.«
»Die Fürstin ist weise«, sprach der dritte mit dem Helm und dem Schwert.
»Ja, sie schreibt griechisch an den Kaiser und redet römisch mit dem frommen Cassiodor. Ich zweifle, ob sie gotisch denkt. Weh uns, wenn sie im Sturm das Steuer halten soll.«
»Ich sehe aber nirgends Sturm, Alter«, lachte der Fackelträger und schüttelte die Locken. »Woher soll er blasen? Der Kaiser ist wieder versöhnt, der Bischof von Rom ist vom König selbst eingesetzt, die Frankenfürsten sind seine Neffen, die Italier haben es unter unsrem Schild besser als je zuvor. Ich sehe keine Gefahr, nirgends.«
»Kaiser Justinus ist nur ein schwacher Greis«, sprach beistimmend der mit dem Schwert, »ich kenne ihn.«
»Aber sein Neffe, bald sein Nachfolger, und jetzt schon sein rechter Arm kennst du auch den? Unergründlich wie die Nacht und falsch wie das Meer ist Justinian: ich kenne ihn und fürchte, was er sinnt. Ich begleitete die letzte Gesandtschaft nach Byzanz: er kam zu unsrem Gelag: er hielt mich für berauscht, der Narr, weiß nicht, was Hildungs Kind zu trinken vermag, und fragte mich genau um alles, was man wissen muß, um -- uns zu verderben. Nun, von mir hat er den rechten Bescheid gekriegt! Aber ich weiß es so gewiß wie meinen Namen: dieser Mann will dies Land, dies Italien wieder haben, und nicht die Fußspur eines Goten wird er darin übriglassen.«
»Wenn er kann«, brummte des Blonden Bruder dazwischen.
»Recht, Freund Hildebad, wenn er kann. Und er kann viel. Byzanz kann viel.«
Jener zuckte die Achseln.
»Weißt du’s, wieviel?« fragte der Alte zornig. »Zwölf Jahre lang hat unser großer König mit Byzanz gerungen und hat nicht obgesiegt. Aber damals warst du noch nicht geboren«, fügte er ruhig hinzu.
»Wohl!« kam jenem der Bruder zu Hilfe. »Aber damals standen die Goten allein im fremden Land. Jetzt haben wie eine ganze zweite Hälfte gewonnen, wir haben eine Heimat, Italien, wir haben Waffenbrüder, die Italier.«
»Italien unsre Heimat!« rief der Alte bitter, »ja, das ist der Wahn. Und die Welschen unsre Helfer gegen Byzanz! Du junger Tor!«
»Das sind unsres Königs eigne Worte«, entgegnete der Gescholtene.
»Ja, ja, ich kenne sie wohl, die Wahnreden, die uns alle verderben werden. Fremd sind wir hier, fremd, heute wie vor vierzig Jahren, da wir von diesen Bergen niederstiegen, und fremd werden wir sein in diesem Lande noch nach tausend Jahren. Wir sind hier ewig die Barbaren!«
»Jawohl, aber warum bleiben wir Barbaren? Wessen Schuld ist das als die unsre? Weshalb lernen wir nicht von ihnen?«
»Schweig still«, schrie der Alte, zuckend vor Grimm, »schweig, Totila, mit solchen Gedanken: sie sind der Fluch meines Hauses geworden.« Sich mühsam beruhigend fuhr er fort: »Unsere Todfeinde sind die Welschen, nicht unsre Brüder. Weh, wenn wir ihnen trauen! Oh, daß der König nach meinem Rat getan und nach seinem Sieg alles erschlagen hätte, das Schwert und Schild führen konnte vom lallenden Knäblein bis zum lallenden Greis! Sie werden uns ewig hassen. Und sie haben recht. Wir aber, wir sind die Toren, sie zu bewundern.«
Eine Pause trat ein: ernst geworden fragte der Jüngling: »Und du hältst keine Freundschaft für möglich zwischen uns und ihnen?«
»Kein Friede zwischen den Söhnen des Gaut und dem Südvolk! Ein Mann tritt in die Goldhöhle des Drachen: er drückt das Haupt des Drachen nieder mit eherner Faust: der bittet um sein Leben: der Mann erbarmt sich seiner schillernden Schuppen und weidet sein Auge an den Schätzen der Höhle. Was wird der Giftwurm tun? Hinterrücks, sobald er kann, wird er ihn stechen, daß der Verschoner stirbt.«
»Wohlan, so laß sie kommen, die Griechlein«, schrie der riesige Hildebad, »und laß dies Natterngezücht gegen uns aufzüngeln. Wir wollen sie niederschlagen -- so!« und er hob die Keule und ließ sie niederfallen, daß die Marmorplatte in Splitter sprang und der alte Tempel in seinen Grundfugen erdröhnte.
»Ja, sie sollen’s versuchen!« rief Totila, und aus seinen Augen leuchtete ein kriegerisches Feuer, das ihn noch schöner machte. »Wenn diese undankbaren Römer uns verraten, wenn die falschen Byzantiner kommen« -- er blickte mit liebevollem Stolz auf seinen starken Bruder -- »sieh, Alter, wir haben Männer wie die Eichen.«
Wohlgefällig nickte der alte Waffenmeister: »Ja, Hildebad ist sehr stark: obwohl nicht ganz so stark wie Winithar und Walamer und die andern waren, die mit mir jung gewesen. Und gegen die Nordmänner ist Stärke gut Ding. Aber dieses Südvolk« -- fuhr er ingrimmig fort -- »kämpft von Türmen und Mauerzinnen herunter. Sie führen den Krieg wie ein Rechenexempel und rechnen dir zuletzt ein Heer von Helden in einen Winkel hinein, daß es sich nicht mehr rühren noch regen kann. Ich kenne einen solchen Rechenmeister in Byzanz, der ist kein Mann und besiegt die Männer. Du kennst ihn auch, Witichis?« -- so fragend wandte er sich an den Mann mit dem Schwert.
»Ich kenne Narses«, sagte dieser, der sehr ernst geworden, nachdenklich. »Was du gesprochen, Hildungs Sohn, ist leider wahr, sehr wahr. Ähnliches ist mir oft schon durch die Seele gegangen, aber unklar, dunkel, mehr ein Grauen als ein Denken. Deine Worte sind unwiderleglich: der König am Tod -- die Fürstin ein halbgriechisch Weib -- Justinian lauernd -- die Welschen schlangenfalsch -- die Feldherrn von Byzanz Zauberer von Kunst, aber« -- hier holte er tief Atem -- »wir stehen nicht allein, wir Goten. Unser weiser König hat sich Freunde, Verbündete geschaffen in Überfluß. Der König der Vandalen ist sein Schwestermann, der König der Westgoten sein Enkel, die Könige der Burgunder, der Heruler, der Thüringer, der Franken sind ihm verschwägert, alle Völker ehren ihn wie ihren Vater, die Sarmaten, die fernen Esthen selbst an der Ostsee senden ihm huldigend Pelzwerk und gelben Bernstein. Ist das alles.«
»Nichts ist das alles, Schmeichelworte sind’s und bunte Lappen! Sollen uns die Esthen helfen mit ihrem Bernstein wider Belisar und Narses? Weh uns, wenn wir nicht allein siegen können. Diese Schwäger und Eidame schmeicheln, so lange sie zittern, und wenn sie nicht mehr zittern, werden sie drohen. Ich kenne die Treue der Könige! Wir haben Feinde ringsum, offene und geheime, und keinen Freund als uns selbst.«
Ein Schweigen trat ein, in welchem alle die Worte des Alten besorgt erwogen: heulend fuhr der Sturm um die verwitterten Säulen und rüttelte an dem morschen Tempelbau.
Da sprach zuerst Witichis, vom Boden aufblickend, sicher und gefaßt: »Groß ist die Gefahr, hoffentlich nicht unabwendbar. Gewiß hast du uns nicht hierher beschieden, daß wir tatlos in die Verzweiflung schauen. Geholfen muß werden: so sprich, wie meinst du, daß zu helfen sei.«
Der Alte trat einen Schritt auf ihn zu und faßte seine Hand: »Wacker, Witichis, Waltaris Sohn. Ich kannte dich wohl und will dir’s treu gedenken, daß vor allen du zuerst ein männlich Wort der Zuversicht gefunden. Ja, ich denke wie du: noch ist Hilfe möglich, und um sie zu finden, habe ich euch hierher gerufen, wo uns kein Welscher hört. Saget nun an und ratet: dann will ich sprechen.«
Da alle schwiegen, wandte er sich zu dem Schwarzgelockten: »Wenn du denkst wie wir, so sprich auch du, Teja. Warum schwiegst du bisher?«
»Ich schweige, weil ich anders denke denn ihr.«
Die andern staunten. Hildebrand sprach: »Wie meinst du das, mein Sohn?«
»Hildebad und Totila sehen nicht die Gefahr, du und Witichis, ihr sehet sie und hoffet, ich aber sah sie längst und hoffe nicht.«
»Du siehst zu schwarz, wer darf verzweifeln vor dem Kampf?« meinte Witichis.
»Sollen wir, das Schwert in der Scheide, ohne Kampf, ohne Ruhm untergehen?« rief Totila.
»Nicht ohne Kampf, mein Totila, und nicht ohne Ruhm, so weiß ich«, antwortete Teja, leise die Streitaxt zuckend. »Kämpfen wollen wir, daß man es nie vergessen soll in allen Tagen: kämpfen mit höchstem Ruhm, aber ohne Sieg. Der Stern der Goten sinkt.«
»Mir deucht, er will erst recht hoch steigen«, rief Totila ungeduldig. »Laßt uns vor den König treten, sprich du, Hildebrand, zu ihm, wie du zu uns gesprochen. Er ist weise: er wird Rat finden.«
Der Alte schüttelte den Kopf: »Zwanzigmal hab’ ich zu ihm gesprochen. Er hört mich nicht mehr. Er ist müde und will sterben, und seine Seele ist verdunkelt, ich weiß nicht, durch welchen Schatten. Was denkst du, Hildebad?«
»Ich denke«, sprach dieser, sich hoch aufrichtend, »sowie der alte Löwe die müden Augen geschlossen, rüsten wir zwei Heere. Das eine führen Witichis und Teja vor Byzanz und brennen es nieder, mit den andern steigen ich und mein Bruder über die Alpen und zerschlagen Paris, das Drachennest der Merowinger, zu einem Steinhaufen für alle Zukunft. Dann wird Ruhe sein, im Osten und im Norden.«
»Wir haben keine Schiffe gegen Byzanz«, sprach Witichis.
»Und die Franken sind sieben wider einen gegen uns«, sagte Hildebrand. »Aber wacker meinst du’s, Hildebad. Sage, was rätst du, Witichis?«
»Ich rate einen Bund, mit Schwüren beschwert, mit Geiseln gesichert, aller Nordstämme gegen die Griechen.«
»Du glaubst an Treue, weil du selber treu. Nein Freund, nur die Goten können den Goten helfen. Man muß sie nur wieder daran erinnern, daß sie Goten sind. Hört mich an. Ihr alle seid jung und liebt allerlei Dinge und habt vielerlei Freuden. Der eine liebt ein Weib, der andere die Waffen, der dritte irgendeine Hoffnung oder auch irgendeinen Gram, der ihm ist wie eine Geliebte. Aber glaubt mir, es kommt eine Zeit -- und die Not kann sie euch noch in jungen Tagen bringen --, da all diese Freuden und selbst Schmerzen wertlos werden wie welke Kränze vom Gelag von gestern.
Da werden denn viele weich und fromm und vergessen des, was auf Erden, und trachten nach dem, was hinter dem Grabe ist. Ich kann’s nicht und ihr, mein’ ich, und viele von uns können’s auch nicht. Die Erde lieb’ ich mit Berg und Wald und Weide und strudelndem Strom und das Leben darauf mit heißem Haß und langer Liebe, mit zähem Zorn und stummem Stolz. Von jenem Luftleben da droben in den Windwolken, wie’s die Christenpriester lehren, weiß ich nichts und will ich nichts wissen, Eins aber bleibt dem Mann, dem rechten, wenn alles andere dahin. Ein Gut, von dem er nimmer läßt. Seht mich an. Ich bin ein entlaubter Stamm, alles hab’ ich verloren, was mein Leben erfreute: mein Weib ist tot seit vielen Jahren, meine Söhne sind tot, meine Enkel sind tot: bis auf einen, der ist schlimmer als tot: der ist ein Welscher geworden. Dahin und lang vermodert sind sie alle, mit denen ich ein kecker Knabe und ein markiger Mann gewesen, und schon steigt meine erste Liebe und mein letzter Stolz, mein großer König, müde in sein Grab. Nun seht, was hält mich noch im Leben? Was gibt mir Mut, Lust, Zwang zu leben? Was treibt mich Alten wie einen Jüngling in dieser Sturmnacht auf die Berge? Was lodert hier unter dem Eisbart heiß in lauter Liebe, in störrigem Stolz und in trotziger Trauer? Was anderes als der Drang, der unaustilgbar in unsrem Blute liegt, der tiefe Drang und Zug zu meinem Volk, die Liebe, die lodernde, die allgewaltige, zu dem Geschlechte, das da Goten heißt, und das die süße, heimliche, herrliche Sprache redet meiner Eltern, der Zug zu denen, die da sprechen, fühlen, leben wie ich. Sie bleibt, sie allein, diese Volksliebe, ein Opferfeuer, in dem Herzen, darinnen alle andre Glut erloschen, sie ist das teure, das mit Schmerzen geliebte Heiligtum, das Höchste in jeder Mannesbrust, die stärkste Macht in seiner Seele, treu bis zum Tod und unbezwingbar.«
Der Alte hatte sich in Begeisterung geredet -- sein Haar flog im Winde -- er stand wie ein alter, hünenhafter Priester unter den jungen Männern, welche die Fäuste an ihren Waffen ballten.
Endlich sprach Teja: »Du hast recht, diese Flamme lodert noch, wo alles sonst erloschen. Aber sie brennt in dir, in uns, vielleicht noch in hundert andern unsrer Brüder. Kann das ein ganzes Volk erretten? Nein! Und kann diese Glut die Masse ergreifen, die Tausende, die Hunderttausende?«
»Sie kann es, mein Sohn, sie kann es. Dank allen Göttern, daß sie’s kann. Höre mich an. Es sind jetzt fünfundvierzig Jahre, da waren wir Goten, viele Hunderttausende, mit Weibern und Kindern, in den Schluchten der Hämus-Berge eingeschlossen.
Wir lagen in höchster Not. Des Königs Bruder war von den Griechen in treulosem Überfall geschlagen und getötet, und aller Mundvorrat, den er uns zuführen sollte, verloren: wir saßen in den Felsschluchten und litten so bittern Hunger, daß wir Gras und Leder kochten. Hinter uns die unersteiglichen Felsen, vor uns und zur Linken das Meer, rechts in einem Engpaß die Feinde in dreifacher Überzahl. Viele Tausende von uns waren dem Hunger, dem Winter erlegen; zwanzigmal hatten wir vergebens versucht, jenen Paß zu durchbrechen. Wir wollten verzweifeln. Da kam ein Gesandter des Kaisers und bot uns Leben, Freiheit, Wein, Brot, Fleisch unter einer einzigen Bedingung: wir sollten getrennt voneinander, zu vier und vier, über das ganze Weltreich Roms zerstreut werden, keiner von uns mehr ein gotisch Weib freien, keiner sein Kind mehr unsre Sprache und Sitte lehren dürfen, Name und Wesen der Goten sollten verschwinden, Römer sollten wir werden. Da sprang der König auf, rief uns zusammen und trug’s uns vor in flammender Rede und fragte zuletzt, ob wir lieber aufgeben wollten Sprache, Sitte, Leben unsres Volkes oder lieber mit ihm sterben? Da fuhr sein Wort in die Hunderte, die Tausende, die Hunderttausende wie der Waldbrand in die dürren Stämme, aufschrien sie, die wackern Männer, wie ein tausendstimmiges, brüllendes Meer, die Schwerter schwangen sie, auf den Engpaß stürzten sie, und weggefegt waren die Griechen, als hätten sie nie gestanden, und wir waren Sieger und frei.«
Sein Auge glänzte in stolzer Erinnerung, nach einer Pause fuhr er fort: »Dies allein ist, was uns heute retten kann wie dazumal: fühlen erst die Goten, daß sie für jenes Höchste fechten, für den Schutz jenes geheimnisvollen Kleinods, das in Sprache und Sitte eines Volkes liegt wie ein Wunderborn, dann können sie lachen zu dem Haß der Griechen, zu der Tücke der Welschen. Und das vor allem wollt’ ich euch fragen, fest und feierlich: fühlt ihr es wie ich so klar, so ganz, so mächtig, daß diese Liebe zu unsrem Volk unser Höchstes ist, unser schönster Schatz, unser stärkster Schild? Könnt ihr sprechen wie ich: mein Volk ist mir das Höchste, und alle, alles andre dagegen nichts, ihm will ich opfern, was ich bin und habe, wollt ihr das, könnt ihr das!«
»Ja, das will ich, ja, das kann ich!« sprachen die vier Männer.
»Wohl«, fuhr der Alte fort, »das ist gut. Aber Teja hat recht: nicht alle Goten fühlen das jetzt, heute schon, wie wir, und doch müssen es alle fühlen, wenn es helfen soll. Darum gelobet mir, von heut an unablässig euch selbst und alle unsres Volkes, mit denen ihr lebt und handelt, zu erfüllen mit dem Hauch dieser Stunde. Vielen, vielen hat der fremde Glanz die Augen geblendet: viele haben griechische Kleider angetan und römische Gedanken: sie schämen sich, Barbaren zu heißen: sie wollen vergessen und vergessen machen, daß sie Goten sind -- wehe über die Toren!
Sie haben das Herz aus ihrer Brust gerissen und wollen leben, sie sind wie Blätter, die sich stolz vom Stamme gelöst, und der Wind wird kommen und wird sie verwehen in Schlamm und Pfützen, daß sie verfaulen: aber der Stamm wird stehen mitten im Sturm und wird lebendig erhalten, was treu an ihm haftet. Darum sollt ihr euer Volk wecken und mahnen überall und immer. Den Knaben erzählt die Sagen der Väter, von den Hunnenschlachten, von den Römersiegen: den Männern zeigt die drohende Gefahr und wie nur das Volkstum unser Schild: eure Schwestern ermahnt, daß sie keinen Römer umarmen und keinen Römling: eure Bräute, eure Weiber lehrt, daß sie alles, sich selbst und euch opfern dem Glück der guten Goten, auf daß, wenn die Feinde kommen, sie finden ein starkes Volk, stolz, einig, fest, daran sie zerschellen sollen wie die Wogen am Fels. Wollt ihr mir dazu helfen?«
»Ja«, sprachen sie, »das wollen wir.«
»Ich glaube euch«, fuhr der Alte fort, »glaube eurem bloßen Wort. Nicht um euch fester zu binden -- denn was bände den Falschen? --, sondern weil ich treu hänge an altem Brauch und weil besser gedeiht, was geschieht nach Sitte der Väter -- folget mir.«
Zweites Kapitel
Mit diesen Worten nahm er die Fackel von der Säule und schritt quer durch den Innenraum, die Cella des Tempels, vorüber an dem zerfallenen Hauptaltar, vorbei an den Postamenten der lang herabgestürzten Götterbilder nach der Hinterseite des Gebäudes, dem Posticum. Schweigend folgten die Geladenen dem Alten, der sie über die Stufen hinunter ins Freie führte.
Nach einigen Schritten standen sie unter einer uralten Steineiche, deren mächtiges Geäst wie ein Dach Sturm und Regen abhielt. Unter diesem Baum bot sich ihnen ein seltsamer Anblick, der aber die gotischen Männer sofort an eine alte Sitte aus dem grauen Heidentum, aus der fernen nordischen Heimat gemahnte. Unter der Eiche war ein Streifen des dichten Rasens aufgeschlitzt, nur einen Fuß breit, aber mehrere Ellen lang, die beiden Enden des Streifens hafteten noch locker am Grunde: in der Mitte war der Rasengürtel auf drei ungleich in die Erde gerammte hohe Speere emporgespreizt, in der Mitte von dem längsten Speer gestützt, so daß die Vorrichtung ein Dreieck bildete, unter dessen Dach zwischen den Speersäulen mehrere Männer bequem stehen konnten. In der so gewonnenen Erdritze stand ein eherner Kessel, mit Wasser gefüllt, daneben lag ein spitzes und scharfes Schlachtmesser, uralt: das Heft vom Horn des Auerstiers, die Klinge von Feuerstein. Der Greis trat nun heran, stieß die Fackel dicht neben dem Kessel in die Erde, stieg dann, mit dem rechten Fuß voraus, in die Grube, wandte sich gegen Osten und neigte das Haupt: dann winkte er die Freunde zu sich, mit dem Finger am Mund ihnen Schweigen bedeutend. Lautlos traten die Männer in die Rinne und stellten sich, Witichis und Teja zu seiner Linken, die beiden Brüder zu seiner Rechten, und alle fünf reichten sich die Hände zu einer feierlichen Kette. Dann ließ der Alte Witichis und Hildebad, die ihm zunächst standen, los und kniete nieder. Zuerst raffte er eine Handvoll der schwarzen Walderde auf und warf sie über die linke Schulter. Dann griff er mit der andern Hand in den Kessel und sprengte das Wasser rechts hinter sich. Darauf blies er in die wehende Nachtluft, die sausend in seinen langen Bart wehte. Endlich schwang er die Fackel von der Rechten zur Linken über sein Haupt. Dann steckte er sie wieder in die Erde und sprach murmelnd vor sich hin:
»Höre mich an, alte Erde, wallendes Wasser, leichte Luft, flackernde Flamme! Höret mich wohl und bewahret mein Wort: Hier stehen fünf Männer vom Geschlechte des Gaut, Teja und Totila, Hildebad und Hildebrand und Witichis, Waltaris Sohn.
Wir stehen hier in stiller Stunde, Zu binden einen Bund von Blutsbrüdern, Für immer und ewig und alle Tage. Wir sollen uns sein wie Sippegesellen In Frieden und Fehde, in Rache und Recht. Ein Hoffen, ein Hassen, ein Lieben, ein Leiden, Wie wir träufen zu einem Tropfen Unser Blut als Blutsbrüder.«
Bei diesen Worten entblößte er den linken Arm, die andern taten desgleichen, eng aneinander streckten sich die fünf Arme über den Kessel, der Alte hob das scharfe Steinmesser und ritzte mit einem Schnitt sich und den vier anderen die Haut des Vorderarmes, daß das Blut aller in roten Tropfen in den ehernen Kessel floß.
Dann nahmen sie wieder die frühere Stellung ein, und murmelnd fuhr der Alte fort:
»Und wir schwören den schweren Schwur, Zu opfern all unser Eigen, Haus, Hof und Habe, Roß, Rüstung und Rind, Sohn, Sippe und Gesinde, Weib und Waffen und Leib und Leben Dem Glanz und Glück des Geschlechtes von Gaut, Den guten Goten. Und wer von uns sich wollte weigern, Den Eid zu ehren mit allen Opfern« --
Hier traten er, und auf seinen Wink auch die andern, aus der Grube und unter dem Rasenstreifen hervor:
»Des rotes Blut soll rinnen ungerächet Wie dies Wasser unterm Waldrasen« --
Er erhob den Kessel, goß sein blutiges Wasser in die Grube und nahm ihn wie das andere Gerät heraus:
»Auf des Haupt sollen des Himmels Hallen Dumpf niederdonnern und ihn erdrücken, Wuchtig so wie dieser Rasen.«
Er schlug mit einem Streich die drei spannenden Lanzenschäfte nieder, und dumpf fiel die schwere Rasendecke nieder in die Rinne. Die fünf Männer stellten sich nun mit verschlungenen Händen auf die wieder vom Rasen gedeckte Stelle, und in rascherem Ton fuhr der Alte fort: »Und wer von uns nicht achtet dieses Eides und dieses Bundes und wer nicht die Blutsbrüder als echte Brüder schützt im Leben und rächt im Tode, und wer sich weigert, sein Alles zu opfern dem Volk der Goten, wann die Not es begehrt und ein Bruder ihn mahnt, der soll verfallen sein auf immer den untern, den ewigen, den wüsten Gewalten, die da hausen unter dem grünen Gras des Erdgrundes: gute Menschen sollen mit Füßen schreiten über des Neidings Haupt, und sein Name soll ehrlos sein soweit Christenleute Glocken läuten und Heidenleute Opfer schlachten, soweit Mutter Kind koset und der Wind weht über die weite Welt. Sagt an, ihr Gesellen, soll’s ihm also geschehen, dem niedrigen Neiding?«
»So soll ihm geschehen«, sprachen die vier Männer ihm nach.
Nach einer ernsten Pause löste Hildebrand die Kette der Hände und sprach: »Und auf daß ihr’s wißt, welche Weihe diese Stätte hat für mich -- jetzt auch für euch --, warum ich euch zu solchem Tun gerade hierher beschieden und zu dieser Nacht -- kommt und sehet.« Und also sprechend erhob er die Fackel und schritt voran hinter den mächtigen Stamm der Eiche, vor der sie geschworen. Schweigend folgten die Freunde, bis sie an der Kehrseite des alten Baumes hielten und hier mit Staunen gerade gegenüber der Rasengrube, in welcher sie gestanden, ein breites offenes Grab gähnen sahen, von welchem die deckende Felsplatte hinweggewälzt war: da ruhten in der Tiefe, im Licht der Fackel geisterhaft erglänzend, drei weiße, lange Skelette, einzelne verrostete Waffenstücke, Lanzenspitzen, Schildbuckel lagen daneben. Die Männer blickten überrascht bald in die Grube, bald auf den Greis. Dieser leuchtete lange schweigend in die Tiefe. Endlich sagte er ruhig: »Meine drei Söhne. Sie liegen hier über dreißig Jahre. Sie fielen auf diesem Berg, in dem letzten Kampf um die Stadt Ravenna. Sie fielen in einer Stunde, heute ist der Tag. Sie sprangen jubelnd in die Speere für ihr Volk.«
Er hielt inne. Mit Rührung sahen die Männer vor sich hin. Endlich richtete sich der Alte hoch auf und sah gegen den Himmel. »Es ist genug«, sagte er, »die Sterne bleichen. Mitternacht ist längst vorüber. Geht, ihr andern, in die Stadt zurück. Du, Teja, bleibst wohl bei mir: -- dir ist ja vor andern, wie des Liedes, der Trauer Gabe gegeben -- und hältst mit mir die Ehrenwacht bei diesen Toten.«
Teja nickte und setzte sich, ohne eine Wort, zu Füßen des Grabes, wo er stand, nieder. Der Alte reichte Totila die Fackel und lehnte sich Teja gegenüber auf die Felsplatte. Die andern drei winkten ihm scheidend zu. Und ernst und in schweigende Gedanken versunken stiegen sie hinunter zur Stadt.
Drittes Kapitel
Wenige Wochen nach jener nächtlichen Zusammenkunft bei Ravenna fand zu Rom eine Vereinigung statt, ebenfalls heimlich, ebenfalls unter dem Schutze der Nacht, aber von ganz anderen Männern zu ganz anderen Zwecken.
Das geschah in der Appischen Straße nahe dem Gömeterium des heiligen Kalixtus in einem halbverschütteten Gang der Katakomben, jener rätselhaften unterirdischen Wege, die unter den Straßen und Plätzen Roms fast eine zweite Stadt bildeten. Es sind diese geheimnisvollen Räume -- ursprünglich alte Begräbnisplätze, oft die Zuflucht der jungen Christengemeinde -- so vielfach verschlungen und ihre Kreuzungen, Endpunkte, Aus- und Eingänge so schwierig zu finden, daß nur unter ortvertrautester Führung ihre inneren Tiefen betreten werden können. Aber die Männer, deren geheimen Verkehr wir diesmal belauschen, fürchteten keine Gefahr. Sie waren gut geführt. Denn es was Silverius, der katholische Archidiakonus der alten Kirche des heiligen Sebastian, der unmittelbar von der Krypta seiner Basilika aus die Freunde auf steilen Stufen in diesen Zweigarm der Gewölbe geführt hatte; und die römischen Priester standen in dem Rufe, seit den Tagen der ersten Christen Kenntnis jener Labyrinthe fortgepflanzt zu haben. Die Versammelten schienen sich auch hier nicht zum erstenmal einzufinden: die Schauer des Ortes machten wenig Eindruck auf sie. Gleichgültig lehnten sie an den Wänden des unheimlichen Halbrunds, das, von einer bronzenen Hängelampe spärlich beleuchtet, den Schluß des niedrigen Ganges bildete, gleichgültig hörten sie die feuchten Tropfen von der Decke zur Erde fallen, und wenn ihr Fuß hier und da an weiße, halbvermoderte Knochen stieß, schoben sie auch diese gleichgültig auf die Seite.
Es waren außer Silverius noch einige andere rechtgläubige Priester und eine Mehrzahl vornehmer Römer aus den Adelsgeschlechtern des westlichen Kaiserreichs anwesend, die seit Jahrhunderten in fast erblichem Besitz der höheren Würden des Staates und der Stadt geblieben.
Schweigend und aufmerksam beobachteten sie die Bewegungen des Archidiakons, der sich, nachdem er die Erschienenen gemustert und in einige der einmündenden Gänge, in deren Dunkel man junge Leute in priesterlichen Kleidern Wache halten sah, prüfende Blicke geworfen hatte, jetzt offenbar anschickte, die Versammlung in aller Form zu eröffnen.
Noch einmal trat er auf einen hochgewachsenen Mann zu, der ihm gegenüber regungslos an der Mauer lehnte, und mit dem er wiederholt Blicke getauscht hatte: und nachdem dieser auf eine fragende Miene schweigend genickt, wandte er sich gegen die übrigen und sprach:
»Geliebte im Namen des dreieinigen Gottes! Wieder einmal sind wir hier versammelt zu heiligem Werk.
Das Schwert von Edom ist gezückt ob unsrem Haupt, und König Pharao lechzt nach dem Blut der Kinder Israel. Wir aber fürchten nicht jene, die den Leib töten und der Seele nichts anhaben können, wir fürchten vielmehr jenen, der da Leib und Seele verderben mag mit ewigem Feuer. Wir vertrauen im Schauer der Nacht auf die Hilfe dessen, der sein Volk durch die Wüste geführt hat, bei Tag in der Rauchwolke, bei Nacht in der Feuerwolke. Und daran wollen wir halten und wollen es nie vergessen: was wir leiden, wir leiden es um Gottes willen, was wir tun, wir tun’s zu seines Namens Ehre. Dank ihm, denn er hat gesegnet unsern Eifer. Klein, wie des Evangeliums, waren unsere Anfänge, aber schon sind wir gewachsen wie ein Baum an frischen Wasserbächen. Mit Furcht und Zagen kamen wir anfangs hier zusammen: groß war die Gefahr, schwach die Hoffnung: edles Blut der Besten war geflossen: -- heute, wenn wir fest bleiben im Glauben, dürfen wir es kühnlich sagen: der Thron des Königs Pharao steht auf Füßen von Schilf, und die Tage der Ketzer sind gezählt in diesem Lande.«
»Zur Sache!« rief ein junger Römer dazwischen, mit kurzkrausem, schwarzem Haar und blitzenden, schwarzen Augen; ungeduldig warf er das Sagum von der linken Hüfte über die rechte Schulter zurück, daß das kurze Schwert sichtbar wurde. »Zur Sache, Priester! Was soll heut’ geschehn?«
Silverius warf auf den Jüngling einen Blick, der lebhaften Unwillen über solch kecke Selbständigkeit nicht ganz mit salbungsvoller Ruhe zu verdecken vermochte. Scharfen Tones fuhr er fort: »Auch die an die Heiligkeit unsres Zweckes nicht zu glauben scheinen, sollten doch den Glauben an diese Heiligkeit bei andern nicht stören, um ihrer eignen weltlichen Ziele willen nicht. Heute aber, Licinius, mein rascher Freund, soll ein neues hochwillkommenes Glied unsrem Bunde eingefügt werden: sein Beitritt ist ein sichtbares Zeichen der Gnade Gottes.«
»Wen willst du einführen? Sind die Vorbedingungen erfüllt? Haftest du für ihn unbedingt? Oder stellst du andre Bürgschaft?« so fragte ein andrer der Versammelten, ein Mann in reifen Jahren, mit gleichmäßigen Zügen, der, einen Stab zwischen den Füßen, ruhig auf einem Vorsprung der Mauer saß. -- »Ich hafte, mein Scävola; übrigens genügt seine Person.«
»Nichts dergleichen. Die Satzung unsres Bundes verlangt Verbürgung, und ich bestehe darauf«, sagte Scävola ruhig. -- »Nun gut, gut, ich bürge, zähester aller Juristen!« wiederholte der Priester mit Lächeln. Er winkte in einen der Gänge zur Linken.
Zwei junge Ostiarii führten von da in die Mitte des Gewölbes einen Mann, auf dessen verhülltes Haupt aller Augen gerichtet waren. Nach einer Pause hob Silverius den Überwurf von Kopf und Schultern des Ankömmlings.
»Albinus!« riefen die andern in Überraschung, Entrüstung, Zorn.
Der junge Licinius fuhr ans Schwert, Scävola stand langsam auf, wild durcheinander scholl es: »Wie? Albinus? Der Verräter?« Scheuen Blickes sah der Gescholtene um sich, seine schlaffen Züge bekundeten angeborene Feigheit: wie Hilfe flehend haftete sein Auge auf dem Priester. »Ja, Albinus!« sagte dieser ruhig. »Will einer der Verbündeten wider ihn sprechen? Er rede.« -- »Bei meinem Genius«, rief Licinius rasch vor allen, »braucht es da der Rede? Wir wissen alle, wer Albinus ist, was er ist. Ein feiger, schändlicher Verräter!« -- Der Zorn erstickte seine Stimme. »Schmähungen sind keine Beweise«, nahm Scävola das Wort. »Aber ich frage ihn selbst, er soll hier vor allen bekennen. Albinus, bist du es, oder bist du es nicht, der, als die Anfänge des Bundes dem Tyrannen verraten waren, als du noch allein von uns allen verklagt warst, es mit ansahst, daß die edlen Männer, Boëthius und Symmachus, unsre Mitverbündeten, weil sie dich mutig vor dem Wüterich verteidigten, verfolgt, gefangen, ihres Vermögens beraubt, hingerichtet wurden, während du, der eigentliche Angeklagte, durch einen schmählichen Eid, dich nie mehr um den Staat kümmern zu wollen, und durch urplötzliches Verschwinden dich gerettet hast? Sprich, bist du es, um dessen Feigheit willen die Zierden des Vaterlandes gefallen?«
Ein Murren des Unwillens ging durch die Versammlung. Der Angeschuldigte blieb stumm und bebte, selbst Silverius verlor einen Augenblick die Haltung. Da richtete sich jener Mann, der ihm gegenüber an der Felswand lehnte, auf und trat einen Schritt herzu; seine Nähe schien den Priester zu erkräftigen, und er begann wieder: »Ihr Freunde, es ist geschehen, was ihr sagt, nicht wie ihr’s sagt. Vor allem wisset: Albinus ist an allem am wenigsten schuldig. Was er getan, er tat’s auf meinen Rat.« -- »Auf deinen Rat?« -- »Das wagst du zu bekennen?« -- »Albinus war verklagt durch den Verrat eines Sklaven, der die Geheimschrift in den Briefen nach Byzanz entziffert hatte. Der ganze Argwohn des Tyrannen war geweckt: jeder Schein von Widerstand, von Zusammenhang mußte die Gefahr vermehren. Der Ungestüm von Boëthius und Symmachus, die ihn mutig verteidigten war edel, aber töricht. Denn er zeigte den Barbaren die Gesinnung des ganzen Adels von Rom, zeigte, daß Albinus nicht allein stehe. Sie handelten gegen meinen Rat, leider haben sie es im Tode gebüßt. Aber ihr Eifer war auch überflüssig: denn den verräterischen Sklaven raffte plötzlich vor weitern Aussagen die Hand des Herrn hinweg, und es war gelungen, die Geheimbriefe des Albinus vor dessen Verhaftung zu vernichten. Jedoch glaubt ihr, Albinus würde auf der Folter, würde unter Todesdrohungen geschwiegen haben, geschwiegen, wenn ihn die Nennung der Mitverschworenen retten konnte? Das glaubt ihr nicht, das glaubte Albinus selbst nicht. Deshalb mußte vor allem Zeit gewonnen, die Folter abgewendet werden. Dies gelang durch jenen Eid. Unterdessen freilich bluteten Boëthius und Symmachus: sie waren nicht zu retten, doch ihres Schweigens, auch unter der Folter, waren wir sicher. Albinus aber ward durch ein Wunder aus seinem Kerker befreit wie Sankt Paulus zu Philippi. Es hieß, er sei nach Athen entflohen, und der Tyrann begnügte sich, ihm die Rückkehr zu verbieten. Allein der dreieinige Gott hat ihm hier in seinem Tempel eine Zufluchtsstätte bereitet, bis daß die Stunde der Freiheit naht. In der Einsamkeit seines heiligen Asyles nun hat der Herr das Herz des Mannes wunderbar gerührt, und ungeschreckt von der Todesgefahr, die schon einmal seine Locke gestreift hat, tritt er wieder in unsern Kreis und bietet dem Dienste Gottes und des Vaterlandes sein ganzes unermeßliches Vermögen. Vernehmt: er hat all sein Gut der Kirche Sanktä Mariä Majoris zu Bundeszwecken vermacht. Wollt ihr ihn und seine Millionen verschmähen?«
Eine Pause des Staunens trat ein: endlich rief Licinius: »Priester, du bist klug wie -- ein Priester. Aber mir gefällt solche Klugheit nicht.« -- »Silverius«, sprach der Jurist, »du magst die Millionen nehmen. Das steht dir an. Aber ich war der Freund des Boëthius: mir steht nicht an, mit jenem Feigen Gemeinschaft zu halten. Ich kann ihm nicht vergeben. Hinweg mit ihm!« -- »Hinweg mit ihm!« scholl es von allen Seiten. Scävola hatte der Empfindung aller das Wort geliehen. Albinus erblaßte, selbst Silverius zuckte unter dieser allgemeinen Entrüstung. »Cethegus!« flüsterte er leise, Beistand heischend.
Da trat der Mann in die Mitte, der bisher immer geschwiegen und nur mit kühler Überlegenheit die Sprechenden gemustert hatte. Er war groß und hager, aber kräftig, von breiter Brust und seine Muskeln von eitel Stahl. Ein Purpursaum an der Toga und zierliche Sandalen verrieten Reichtum, Rang, und Geschmack, aber sonst verhüllte ein langer, brauner Soldatenmantel die ganze Unterkleidung der Gestalt. Sein Kopf war von denen, die man, einmal gesehen, nie mehr vergißt.
Das dichte, noch glänzend schwarze Haar war nach Römerart kurz und rund um die gewölbte, etwas zu große Stirn und die edel geformte Schläfe geschoren, tief unter den fein geschweiften Brauen waren die schmalen Augen geborgen, in deren unbestimmtem Dunkelgrau ein ganzes Meer versunkener Leidenschaften, aber noch bestimmter der Ausdruck kältester Selbstbeherrschung lag. Um die scharf geschnittenen, bartlosen Lippen spielte ein Zug stolzer Verachtung gegen Gott und seine ganze Welt. Wie er vortrat und mit ruhiger Vornehmheit den Blick über die Erregten streifen ließ, wie seine nicht einschmeichelnde, aber beherrschende Redeweise anhob, empfand jeder in der Versammlung den Eindruck bewußter Überlegenheit, und wenige Menschen mochten diese Nähe ohne das Gefühl der Unterordnung tragen.
»Was hadert ihr«, sagte er kalt, »über Dinge, die geschehen müssen? Wer den Zweck will, muß die Mittel wollen. Ihr wollt nicht vergeben? Immerhin! Daran liegt nichts. Aber vergessen müßt ihr. Und das könnt ihr. Auch ich war ein Freund der Verstorbenen, vielleicht ihr nächster. Und doch -- ich will vergessen. Ich tu’ es, eben weil ich ihr Freund war. Der liebt sie, Scävola, der allein, der sie rächt. Um der Rache willen Albinus, deine Hand.« -- Alle schwiegen, bewältigt mehr von der Persönlichkeit als von den Gründen des Redners. Nur der Jurist bemerkte noch:
»Rusticiana, des Boëthius Witwe und des Symmachus Tochter, die einflußreiche Frau, ist unserm Bunde hold. Wird sie das bleiben, wenn dieser eintritt? Kann sie je vergeben und vergessen? Niemals!«
»Sie kann es. Glaubt nicht mir, glaubt euren Augen.« Mit diesen Worten wandte sich rasch Cethegus und schritt in einen der Seitengänge, dessen Mündung bisher sein Rücken verdeckt hatte. -- Hart am Eingang stand lauschend eine verschleierte Gestalt: er ergriff ihre Hand: »Komm«, flüsterte er, »jetzt komm.« -- »Ich kann nicht! Ich will nicht!« war die leise Antwort der Widerstrebenden. »Ich verfluche ihn. Ich kann ihn nicht sehen, den Elenden!« -- »Es muß sein. Komm, du kannst und du willst es: denn ich will es.« Er schlug ihren Schleier zurück: noch ein Blick, und sie folgte wie willenlos.
Sie bogen um die Ecke des Eingangs: »Rusticiana!« riefen alle. -- »Ein Weib in unserer Versammlung!« spräch der Jurist. »Das ist gegen die Satzungen, die Gesetze.«
»Ja, Scävola, aber die Gesetze sind um des Bundes willen, nicht der Bund um der Gesetze willen. Und geglaubt hättet ihr mir nie, was ihr hier sehet mit Augen.«
Er legte die Hand der Witwe in die zitternde Rechte des Albinus.
»Seht, Rusticiana verzeiht: wer will jetzt noch widerstreben?« -- Überwunden und überwältigt verstummten alle. Für Cethegus schien das Weitere jedes Interesse verloren zu haben. Er trat mit der Frau an die Wand im Hintergrund zurück. Der Priester aber sprach: »Albinus ist Glied des Bundes.« -- »Und sein Eid, den er dem Tyrannen geschworen?« fragte schüchtern Scävola. -- »War erzwungen und ist ihm gelöst von der heiligen Kirche. Aber nun ist es Zeit, zu scheiden. Nur noch die eilendsten Geschäfte, die neuesten Botschaften. Hier, Licinius, der Festungsplan von Neapolis: du mußt ihn bis morgen nachgezeichnet haben, er geht an Belisar. Hier, Scävola, Briefe aus Byzanz, von Theodora, der frommen Gattin Justinians: du mußt sie beantworten. Da, Calpurnius, eine Anweisung auf eine halbe Million Solidi von Albinus: du sendest sie an den fränkischen Majordomus, er wirkt bei seinem König gegen die Goten. Hier, Pomponius, eine Liste der Patrioten in Dalmatien: du kennst die Dinge dort und die Menschen: sieh zu, ob bedeutende Namen fehlen. Euch allen aber sei gesagt, daß, nach heute erhaltenen Briefen von Ravenna, die Hand des Herrn schwer auf dem Tyrannen liegt; tiefe Schwermut, zu späte Reue über all seine Sünden soll seine Seele niederdrücken, und der Trost der wahren Kirche bleibt ihm fern. Harret aus noch eine kleine Weile, bald wird ihn die zornige Stimme des Richters abrufen: dann kommt der Tag der Freiheit. An den nächsten Iden, zur selben Stunde, treffen wir uns wieder. Der Segen des Herrn sei mit euch.« Eine Handbewegung des Diakons verabschiedete die Versammelten: die jungen Priester traten mit den Fackeln aus den Seitengängen und geleiteten die einzelnen in verschiedenen Richtungen nach den nur ihnen bekannten Ausgängen der Katakomben.
Viertes Kapitel
Silverius, Cethegus und Rusticiana stiegen miteinander die Stufen hinauf, welche in die Krypta der Basilika des heiligen Sebastian führten. Von da gingen sie durch die Kirche in das unmittelbar darangebaute Haus des Diakonus. Dort angelangt, überzeugte sich dieser, daß alle Hausgenossen schliefen bis auf einen alten Sklaven, der im Atrium bei einer halb herabgebrannten Ampel wachte. Auf den Wink seines Herrn zündete er die neben ihm stehende silberfüßige Lampe an und drückte auf eine Fuge im Marmorgetäfel. Die Marmorplatten drehten sich um ihre Achse und ließen den Priester, der die Leuchte ergiffen, mit den beiden andern in ein kleines, niederes Gemach treten, dessen Öffnung sich hinter ihnen rasch und geräuschlos wieder schloß. Keine Ritze verriet nun wieder, daß hier eine Tür.
Der kleine Raum, jetzt mit einem hohen Kreuz aus Holz, einem Betschemel und einigen christlichen Symbolen auf Goldgrund einfach ausgestattet, hatte in heidnischen Tagen offenbar, wie die an den Wänden hinlaufenden Polstersimse bezeugten, dem Zweck jener kleinen Gelage von zwei oder drei Gästen gedient, deren zwanglose Gemütlichkeit Horatius feiert. Zur Zeit war hier das Asyl für die geheimsten geistlichen -- oder weltlichen -- Gedanken des Diakonus. Schweigend setzte sich Cethegus, auf ein gegenüber in die Wand eingelegtes Mosaikgemälde den flüchtigen Blick des verwöhnten Kunstkenners werfend, auf den niederen Lectus. Während der Priester beschäftigt war, aus einem Mischkrug mit hochgeschweiften Henkeln Wein in die bereitstehenden Becher zu gießen und eine eherne Schale mit Früchten auf den dreifüßigen Bronzetisch zu stellen, stand Rusticiana Cethegus gegenüber, ihn mit unwillig staunenden Blicken messend. Kaum vierzig Jahre alt, zeigte das Weib Spuren einer seltenen, etwas männlichen Schönheit, die weniger durch das Alter als durch heftige Leidenschaften gelitten hatte; schon war hier und da nicht graues, sondern weißes Haar in ihre rabenschwarzen Flechten gemischt, das Auge hatte einen unsteten Blick, und starke Falten zogen sich gegen die immer bewegten Mundwinkel. Sie stützte die Linke auf den Erztisch und strich mit der Rechten wie nachsinnend über die Stirn, dabei fortwährend Cethegus anstarrend. Endlich sprach sie: »Mensch, sage, sage, Mann, welche Gewalt du über mich hast? Ich liebe dich nicht mehr. Ich sollte dich hassen. Ich hasse dich auch. Und doch muß ich dir folgen willenlos. Wie der Vogel dem Auge der Schlange. Und du legst meine Hand, diese Hand, in die Hand jenes Schurken. Sage, du Frevler, welches ist diese Macht?«
Cethegus schwieg unaufmerksam. Endlich sagte er, sich zurücklehnend: »Gewohnheit, Rusticiana, Gewohnheit.«
»Jawohl, Gewohnheit! Gewohnheit einer Sklaverei, die besteht, seit ich denken kann. Daß ich als Mädchen den schönen Nachbarssohn bewunderte, war natürlich; daß ich glaubte, du liebtest mich, war verzeihlich: du küßtest mich ja. Und wer konnte -- damals! -- wissen, daß du nicht lieben kannst. Nichts: kaum dich selbst. Daß die Gattin des Boëthius diese wahnsinnige Liebe nicht erstickte, die du wie spielend wieder anfachtest, war eine Sünde, aber Gott und die Kirche haben sie mir verziehen. Doch, daß ich jetzt noch, nachdem ich jahrzehntelang deine herzlose Tücke kenne, nachdem die Glut der Leidenschaft erloschen in diesen Adern, daß ich jetzt noch blindlings deinem dämonischen Willen folgen muß -- das ist eine Torheit zum Lautauflachen.«
Und sie lachte hell und fuhr mit der Rechten über die Stirn. Der Priester hielt in seiner wirtlichen Beschäftigung inne und sah verstohlen auf Cethegus; er war gespannt. Cethegus lehnte das Haupt rückwärts an den Marmorsims und umfaßte mit der Rechten den Pokal, der vor ihm stand:
»Du bist ungerecht, Rusticiana«, sagte er ruhig. »Und unklar. Du mischest die Spiele des Eros in die Werke der Eris und der Erinnyen. Du weißt es, daß ich der Freund des Boëthius war. Obwohl ich sein Weib küßte. Vielleicht ebendeshalb. Ich sehe darin nichts Besonderes, und du -- nun, dir haben es ja Silverius und die Heiligen vergeben. Du weißt ferner, daß ich diese Goten hasse, wirklich hasse, daß ich den Willen und -- vor andern -- die Fähigkeit habe, durchzusetzen, was dich jetzt ganz erfüllt: deinen Vater, den du geliebt, deinen Gatten, den du geehrt hast, an diesen Barbaren zu rächen. Du gehorchst daher meinen Winken. Und du tust daran sehr klug. Denn du hast zwar ein sehr bedeutendes Talent, Ränke zu schmieden. Aber deine Heftigkeit trübt oft deinen Blick. Sie verdirbt deine feinsten Pläne. Also tust du wohl, kühlerer Leitung zu folgen. Das ist alles. -- Aber jetzt geh. Deine Sklavin kauert schlaftrunken im Vestibulum. Sie glaubt dich in der Beichte, bei Freund Silverius. Die Beichte darf nicht gar zu lange währen. Auch haben wir noch Geschäfte. Grüße mir Kamilla, dein schönes Kind, und lebe wohl.« Er stand auf, ergriff ihre Hand und führte sie sanft zur Türe. Sie folgte widerstrebend, nickte dem Priester zum Abschied zu, sah nochmal auf Cethegus, der ihre innere Bewegung nicht zu sehen schien, und ging mit leisem Kopfschütteln hinaus.
Cethegus setzte sich wieder und trank den Pokal aus.
»Sonderbarer Kampf mit diesem Weibe«, sagte Silverius und setzte sich mit Griffel, Wachstafeln, Briefen und Dokumenten zu ihm. »Nicht sonderbar. Sie will ihr Unrecht gegen ihren Gatten gutmachen, indem sie ihn rächt. Und daß sie diese Rache gerade durch ihren ehemaligen Geliebten findet, macht die heilige Pflicht besonders süß. Freilich ist ihr dies alles unbewußt. -- Aber, was gibt’s zu tun?« Und nun begannen die beiden Männer ihre Arbeit, solche Punkte der Verschwörung zu erledigen, die allen Gliedern des Bundes mitzuteilen sie nicht für ratsam hielten. »Diesmal«, hob der Diakonus an, »gilt es vor allem, das Vermögen des Albinus festzustellen und dessen nächste Verwendung zu beraten. Wir brauchen ganz unabweislich Geld, viel Geld.« -- »Geldsachen sind dein Gebiet«, sagte Cethegus trinkend. »Ich verstehe sie wohl, aber sie langweilen mich.«
»Ferner müssen die einflußreichen Männer auf Sizilien, in Neapolis und Apulien gewonnen werden. Hier ist die Liste derselben mit Notizen über die einzelnen. Es sind Menschen darunter, bei denen die gewöhnlichen Mittel nicht verfangen.« »Gib her«, sagte Cethegus, »das will ich machen«, und zerlegte einen persischen Apfel. --
Nach einer Stunde angestrengter Arbeit waren die dringendsten Geschäfte bereinigt, und der Hausherr legte die Dokumente wieder in ihr Geheimfach hinter dem großen Kreuz in der Mauer. Der Priester war ermüdet und sah mit Neid auf den Genossen, dessen stählernen Körper und unangreifbaren Geist keine späte Stunde, keine Anspannung ermatten zu können schien. Er äußerte etwas dergleichen, als sich Cethegus den silbernen Becher wieder füllte.
»Übung, Freund, starke Nerven und« setzte er lächelnd hinzu, »ein gutes Gewissen: das ist das ganze Rätsel.«
»Nein, im Ernst, Cethegus, du bist mir auch sonst ein Rätsel.« -- »Das will ich hoffen.« -- »Nun, hältst du dich für ein mir so unerreichbar überlegenes Wesen?« -- »Ganz und gar nicht. Aber doch für gerade hinreichend tief, um andern nicht minder ein Rätsel zu sein als -- mir selbst. Dein Stolz auf Menschenkenntnis mag sich beruhigen. Es geht mir selbst mit mir nicht besser als dir. Nur die Tropfen sind durchsichtig.« -- »In der Tat«, fuhr der Priester ausholend fort, »der Schlüssel zu deinem Wesen muß sehr tief liegen. Sieh zum Beispiel die Genossen unsres Bundes. Von jedem läßt sich sagen, welcher Grund ihn dazu geführt hat. Der hitzige Jugendmut einen Licinius, der verrannte, aber ehrliche Rechtssinn einen Scävola, mich und die andern Priester -- der Eifer für die Ehre Gottes.«
»Natürlich«, sagte Cethegus trinkend.
»Andere treibt der Ehrgeiz oder die Hoffnung, bei einem Bürgerkrieg ihren Gläubigern die Hälse abzuschneiden, oder auch die Langeweile über den geordneten Zustand dieses Landes unter den Goten oder eine Beleidigung durch einen der Fremden, die allermeisten der natürliche Widerwille gegen die Barbaren und die Gewöhnung, nur im Kaiser den Herrn Italiens zu sehen. Bei dir aber schlägt keiner dieser Beweggründe an und« --
»Und das ist sehr unbequem, nicht wahr? Denn mittels Kenntnis ihrer Beweggründe beherrscht man die Menschen? Ja, ehrwürdiger Gottesfreund, ich kann dir nicht helfen. Ich weiß es wirklich selbst nicht, was mein Beweggrund ist. Ich bin selbst so neugierig darauf, daß ich es dir herzlich gern sagen und mich -- beherrschen lassen wollte, wenn ich es nur entdecken könnte. Nur das eine fühl’ ich: diese Goten sind mir zuwider. Ich hasse diese vollblütigen Gesellen mit ihren breiten Flachsbärten. Unausstehlich ist mir das Glück dieser brutalen Gutmütigkeit, dieser naiven Jugendlichkeit, dieses alberne Heldentum, diese ungebrochnen Naturen. Es ist eine Unverschämtheit des Zufalls, der die Welt regiert, dieses Land -- nach einer solchen Geschichte -- mit Männern wie -- wie du und ich -- von diesen Nordbären beherrschen zu lassen.« Unwillig warf er das Haupt zurück, drückte die Augen zu und schlürfte einen kleinen Trunk Weines. »Daß die Barbaren fort müssen«, sprach der andere, »darüber sind wir einig. Und für mich ist damit alles erreicht. Denn ich will ja nur die Befreiung der Kirche von diesen irrgläubigen Barbaren, welche die Göttlichkeit Christi leugnen und nur einen Halbgott aus ihm machen. Ich hoffe, daß alsdann der römischen Kirche der Primat im ganzen Gebiet der Christenheit, der ihr gebührt, unbestritten zufallen wird. Aber so lange Rom in der Hand der Ketzer liegt, während der Bischof von Byzanz von dem allein rechtgläubigen und rechtmäßigen Kaiser gestützt wird«
»So lange ist der Bischof von Rom nicht der oberste Bischof der Christenheit, solange nicht Herr Italiens, und deshalb der römische Stuhl, selbst wenn ein Silverius ihn einnehmen wird, nicht das, was er werden soll: das Höchste. Und das will doch Silverius.«
Überrascht sah der Priester auf.
»Beunruhige dich nicht, Freund Gottes. Ich weiß das längst und habe dein Geheimnis bewahrt, obwohl du es mir nicht vertraut hast. Allein weiter.« Er schenkte sich aufs neue ein: »Dein Falerner ist gut abgelagert, aber er hat zu viel Süße. Du kannst eigentlich nur wünschen, daß diese Goten den Thron der Cäsaren räumen, nicht, daß die Byzantiner an ihre Stelle treten: denn sonst hat der Bischof von Rom wieder zu Byzanz seinen Oberbischof und einen Kaiser. Du mußt also an der Goten Stelle wünschen -- nicht einen Kaiser -- Justinian, sondern -- etwa was?« »Entweder« -- fiel Silverius eifrig ein -- »einen eignen Kaiser des Westreichs« -- »Der aber«, vollendete Cethegus seinen Satz, »nur eine Puppe ist in der Hand des heiligen Petrus --« -- »Oder eine römische Republik, einen Staat der Kirche --« -- »In welchem der Bischof von Rom der Herr, Italien das Hauptland und die Barbarenkönige in Gallien, Germanien, Spanien die gehorsamen Söhne der Kirche sind. Schön, mein Freund. Nur müssen erst die Feinde vernichtet sein, deren Spolien du bereits verteilst. Deshalb ein altrömischer Trinkspruch: wehe den Barbaren!«
Er stand auf und trank dem Priester zu. »Aber die letzte Nachtwache schleicht vorüber und meine Sklaven müssen mich am Morgen in meinem Schlafgemach finden. Leb’ wohl.« Damit zog er den Cucullus des Mantels über das Haupt und ging.
Der Wirt sah ihm nach: »Ein höchst bedeutendes Werkzeug!« sagte er zu sich. »Gut, daß er nur ein Werkzeug ist. Möge er es immer bleiben.«
Cethegus aber schritt von der Via appia her, wo die Kirche des heiligen Sebastian den Eingang in die Katakomben bedeckt, nach Nordwesten dem Kapitole zu, an dessen Fuß am Nordende der Via sacra sein Haus gelegen war, nordöstlich vom Forum Romanum.
Die kühle Morgenluft strich belebend um sein Haupt.