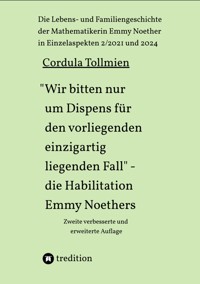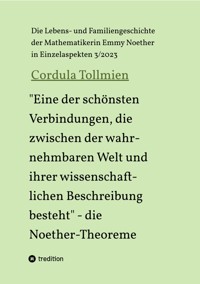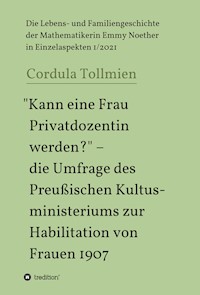
"Kann eine Frau Privatdozentin werden?" - die Umfrage des Preußischen Kultusministeriums zur Habilitation von Frauen 1907 E-Book
Cordula Tollmien
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
* Die Autorin legt mit diesem Band die erste Veröffentlichung einer Reihe vor, in der in loser Folge Ergebnisse ihrer biografischen Forschungen zu der Mathematikerin Emmy Noether publiziert werden sollen. Dabei ist das aus ihrer inzwischen fast dreißigjährigen Beschäftigung mit Emmy Noether hervorgegangene Projekt "Lebens- und Familiengeschichte Emmy Noethers" nicht linear, auf Noethers Lebensweg fokussiert angelegt, sondern mehrdimensional unter Einbeziehung des gesamten familiären und sozialgesellschaftlichen Beziehungsgefüges. Über die engere Familiengeschichte hinaus wird, soweit dies für Emmy Noethers Biografie von Bedeutung ist, auch das allgemeinhistorische Umfeld in den Blick genommen, wenn dies geboten erscheint auch einmal - wie in dem hier vorliegenden Band 1 - als umfangreiche Einzelveröffentlichung. "Ihre Erzählung von Frl. Noethers Habilitationshindernissen hat uns sehr amüsiert. Gott, Gott, wie dumm die gescheiten Männer sind! " - Das schrieb am 2. März 1916 Hedwig Pringsheim, die Tochter der Frauenrechtlerin Hedwig Dohm, an David Hilbert, der ihr über seine erfolglosen Versuche, Emmy Noether in Göttingen zu habilitieren, berichtet hatte, was Thema von Band 2 der hier vorgelegten Reihe sein wird. Doch lässt sich an den in Band 1 in extenso wiedergegebenen Argumenten der Gegner der Habilitation von Frauen, die sich bis zur Lächerlichkeit bar jeder Logik und fern aller Wissenschaftlichkeit entblößten, sehr eindrucksvoll studieren, wie "dumm die gescheiten Männer" tatsächlich waren, und es wird darüber hinaus schmerzhaft deutlich, welcher Ignoranz und Herabsetzung, häufig auch stark sexualisierter Art, die Frauen ausgesetzt waren, die doch nichts anderes wollten, als Wissenschaft betreiben. Doch die klarblickenden Männer, die die Frauen unterstützten und sich mit ihnen gemeinsam gegen den eisigen Wind der ihnen entgegenschlagenden Vorurteile stemmten, erhellen eindrucksvoll das ansonsten düstere Bild. Der Band enthält 52 SW-Abbildungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Zitat im Titel stammt von Adeline Rittershaus-Bjanarson, der ersten Frau, die in Preußen einen Antrag auf Habilitation stellte. Sie veröffentlichte 1902 einen Artikel in der Zeitschrift Frauencorrespondenz mit dem Titel „Kann eine Frau in Deutschland Privatdozentin werden?“
Cordula Tollmien, geb. 1951, studierte Mathematik, Physik und Geschichte an der Universität Göttingen. Seit 1987 arbeitet sie als freiberufliche Historikerin und Schriftstellerin und veröffentlichte u. a. auch eine Reihe von Kinderbüchern. Sie war an dem 1987 publizierten Projekt zur Geschichte der Universität Göttingen im Nationalsozialismus beteiligt, arbeitete von 1991 bis 1993 als wissenschaftliche Lektorin bei der Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte und trug Grundlegendes zum dritten Band der Göttinger Stadtgeschichte bei, der die Jahre 1866 bis 1989 behandelt. In den Jahren 2000 bis 2011 hatte sie einen Forschungsauftrag der Stadt Göttingen zur NS-Zwangsarbeit (www.zwangsarbeit-in-goettingen.de), und 2014 erschien ihr Buch über die Geschichte der jüdischen Göttinger Familie Hahn. Mit der Entwicklung der akademischen Frauenbildung und insbesondere mit den Biografien von Mathematikerinnen beschäftigt sie sich seit 1990 – dem Jahr, in dem ihre Arbeit erschien, in der erstmals die Geschichte der Habilitation Emmy Noethers im Detail nachgezeichnet wurde. 1995 publizierte sie eine Biografie der russischen Mathematikerin Sofja Kowalewskaja.
URL: www.tollmien.com
Die Lebens- und Familiengeschichte der Mathematikerin Emmy Noether in Einzelaspekten 1/2021
Cordula Tollmien
„Kann eine Frau Privatdozentin werden?“ – die Umfrage des Preußischen Kultusministeriums zur Habilitation von Frauen 1907
© 2021 Cordula Tollmien
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback: 978-3-347-05156-0
Hardcover: 978-3-347-05157-7
e-Book: 978-3-347-05158-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Sollten wir Männer denn nicht endlich einmal uns bewußt werden, daß wir doch eigentlich kein Recht haben, immer von unserer Seite zu bestimmen, was den Frauen zu gestatten sei; woher nehmen wir dieses Recht? Aus roheren Zeiten stammt es; ist es richtig, daß noch immer daran festgehalten wird?
Wie kommen wir dazu, sie für weniger befähigt zu halten? Wir zwingen sie, mit einer niedrigeren Bildung sich zu begnügen, als wir sie empfangen; natürlich wissen sie dann weniger, aber das gestattet doch nicht den Schluß, dass sie weniger befähigt sind.
Rudolf Sturm (Breslau) 1897,
stellvertretend für alle, die sich dem damals herrschenden frauenherabsetzenden Zeitgeist entgegenstellten
Danksagung
Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der von mir genutzten Archive und Bibliotheken, insbesondere seien hier genannt Uta Grünert vom Herbarium, Alfons Renz vom Institut für Evolution und Ökologie, Ernst Seidl vom Museum und Susanne Rieß-Stumm vom Archiv der Universität Tübingen; außerdem Katrin Bäumler vom Archiv der Technischen Universität München, Thomas Becker und Linda Mosig vom Universitätsarchiv Bonn, Bärbel Mund von der Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek Göttingen, Thomas Schuld vom Edith-Stein-Archiv Köln und Stefanie Bellach vom Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin, aus dem die Akte stammt, die über weite Strecken die Grundlage der hier vorgelegten Veröffentlichung bildet. Mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat mir in besonderer Weise Angelika Deese.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Das Habilitationsgesuch Maria von Lindens an der Universität Bonn
Der Werdegang der ersten Tübinger Studentin Maria von Linden
Die Diskussion in der Bonner Philosophischen Fakultät
2. „Auch Frauen werden zur akademischen Laufbahn zugelassen“ – die Stellungnahmen an den Universitäten Bonn und Göttingen
Die Universität Bonn – „der Nutzen solcher Ausnahmewesen wäre mit zu vielen Nachteilen erkauft“
Die Universität Göttingen – „doch dann würden andere Bedenken in Wirksamkeit treten“
Das Göttinger Separatvotum für die Zulassung von Frauen
3. Eine Umfrage zur Festschreibung der „Ungleichheit der Geschlechter“
„Das Weib liesse sich nicht gegenüber dem Gelehrten vergessen“ – die Argumente gegen die Habilitation von Frauen
Dürfen Juden Privatdozenten werden? – die Umfrage des Preußischen Kultusministeriums im Jahr 1847 – ein Vergleich
„Die Frage der Habilitationsfähigkeit betrifft die ganze Laufbahn des akademischen Lehrers“ – Die Argumente für die Habilitation von Frauen (und von Juden)
4. Das Ergebnis der Umfrage von 1907
5. Was wurde aus Maria von Linden?
Abkürzungsverzeichnis
Literatur- und Quellenverzeichnisse
Verzeichnis der Literatur und gedruckten Quellen
Verzeichnis der ungedruckten Quellen
Personenregister
Register der Universitäten
Vorankündigungen
Vorwort
Die Autorin legt mit diesem Band die erste Veröffentlichung einer Reihe vor, in der in loser Folge Ergebnisse ihrer biografischen Forschungen zu der Mathematikerin Emmy Noether publiziert werden sollen. Dabei geht das aus ihrer inzwischen fast dreißigjährigen Beschäftigung mit Emmy Noether hervorgegangene Projekt „Lebens- und Familiengeschichte Emmy Noethers“ nicht linear, nur auf Noethers Lebensweg fokussiert, vor, sondern ist mehrdimensional angelegt unter Einbeziehung ihres gesamten familiären und sozialgesellschaftlichen Beziehungsgefüges. So ist unter anderem eine Veröffentlichung zur Lebensgeschichte ihres Vaters geplant, und ihre Brüder und (bisher immer vernachlässigt) ihre Mutter werden ebenfalls prominent gewürdigt. Auch der Geschichte der weiter zurückliegenden Generationen, der mütterlichen wie väterlichen Groß- und Urgroßeltern Emmy Noethers, wird auf der Suche nach ihren jüdischen Wurzeln nachgegangen werden. Über die engere Familiengeschichte hinaus wird, soweit dies für Emmy Noethers Biografie von Bedeutung ist, auch das allgemeinhistorische Umfeld in den Blick genommen, wenn dies geboten erscheint auch einmal – wie in dem hier vorliegenden Band 1 – als umfangreiche Einzelveröffentlichung.
Die Frage, ob und ab wann Frauen an preußischen Universitäten Privatdozentinnen werden durften, ist für Emmy Noethers wissenschaftlichen Werdegang von so großem Gewicht, für ihre eigene Habilitationsgeschichte so bedeutsam, dass die Diskussion über die Habilitation von Frauen, die das Preußische Kultusministerium Anfang 1907 als Umfrage unter allen preußischen Universitäten initiiert hatte, nur scheinbar nichts direkt mit Emmy Noether zu tun hat. Denn das Ergebnis dieser Umfrage war ein ministerieller Erlass vom 29. Mai 1908, der dafür verantwortlich war, dass es trotz der vorbehaltlosen Unterstützung der Göttinger Mathematiker dreier Anläufe und eines politischen Systemwechsels bedurfte, bis der am 20. Juli 1915 erstmals gestellte Antrag Emmy Noethers auf Habilitation schließlich im Mai 1919 positiv entschieden wurde und sie am 4. Juni 1919 ihre Probevorlesung halten konnte.
Band 2 der hier gestarteten Reihe wird sich dann unter dem Titel „Wir bitten nur um Dispens für den vorliegenden einzigartig liegenden Fall“ mit der Habilitationsgeschichte Emmy Noethers im engeren Sinne beschäftigen und Band 3 die Entstehungsgeschichte ihrer Habilitationsarbeit schildern, wobei speziell in diesem Zusammenhang betont werden soll, dass der Ansatz für die gesamte Reihe ein rein biografischer und kein mathematikhistorischer (oder bezogen auf ihre Habilitationsarbeit auch kein physikhistorischer) ist. Mathematische (oder physikalische) Zusammenhänge werden daher, wie dies bei der Biografie einer Mathematikerin nicht anders möglich ist, zwar erwähnt, aber immer nur sehr kursorisch, manchmal auch nur stichwortartig behandelt. Ausführliche Darstellungen findet man in der inzwischen sehr zahlreichen Fachliteratur zu Emmy Noethers mathematischen Ideen.
Dass die „Lebens- und Familiengeschichte Emmy Noethers“ hier mit deren Habilitation und den in deren Zusammenhang geführten Diskussionen begonnen wird, hat einen in der Biografie der Autorin liegenden Grund. Denn ihr 1990 erschienener Artikel mit dem sprechenden Titel
"Sind wir doch der Meinung, daß ein weiblicher Kopf nur ganz ausnahmsweise in der Mathematik schöpferisch tätig sein kann…" – eine Biographie der Mathematikerin Emmy Noether (1882-1935) und zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Habilitation von Frauen an der Universität Göttingen, in: Göttinger Jahrbuch 38 (1990), S. 153-219,
der wesentlich auf seinerzeit von ihr in Göttinger Archiven entdeckten, bis dato völlig unbekannten Dokumenten zur Habilitationsgeschichte Emmy Noethers beruhte, markiert nicht nur den Beginn der Noetherforschungen der Autorin, sondern hat – wie dies Mechthild Koreuber in ihrer Dissertation über die Noether-Schule formuliert hat – für die biographische Auseinandersetzung mit Emmy Noether Maßstäbe gesetzt (Koreuber 2015, S.154). Seitdem sind neue Erkenntnisse zur Habilitationsgeschichte Emmy Noethers nicht veröffentlicht worden. Hinzu kommt, dass Anfang Juni 2019 unter der Leitung von Koreuber in Berlin eine interdisziplinäre Fachkonferenz aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der Habilitation Emmy Noethers stattfand, auf der auch die Autorin vortrug, was Anlass und Anregung für eine erneute Beschäftigung mit der Habilitationsgeschichte Emmy Noethers war.
In der 1990 erschienenen Publikation habe ich die Geschichte des Erlasses vom 29. Mai 1908, der für über zehn Jahre ein faktisches Verbot jeder Habilitation einer Frau an einer preußischen Universität bedeutete, nur als Exkurs und nur gestützt auf Göttinger Dokumente behandelt. Dass ich mich hier für eine eigenständige Veröffentlichung entschieden habe, hat seinen Grund darin, dass mir inzwischen wichtige Quellen zugänglich waren, die neue Erkenntnisse möglich machten. Zwar hat bereits Eva Brinkschulte eine erste, sehr verdienstvolle und sehr aufschlussreiche Interpretation der entsprechenden Akte des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz, in der die Antworten der oben genannten Umfrage vom Januar 1907 enthalten sind, vorgenommen (Brinkschulte 2000). Doch geschah dies auf relativ begrenztem Raum, so dass Brinkschulte zwar einige instruktive Belegstellen aus dieser Akte zitieren konnte, im Wesentlichen aber zusammenfassend vorgehen musste. Da die Antworten auf diese für die Geschichte der Habilitation von Frauen so entscheidenden Umfrage auch zeitgenössisch nicht veröffentlicht wurden (man könnte auch vermuten, vom Ministerium unter Verschluss gehalten wurden), scheint eine mit ausführlichen Zitaten belegte Auseinandersetzung mit den Umfrageergebnissen, die keineswegs so einheitlich und eindeutig waren, wie dies das Ministerium in seiner in einen Erlass gegossenen Zusammenfassung glauben machen wollte, nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar geboten. Erst durch die genaue Analyse jeder einzelnen Aussage unter Rückbezug auf deren Autor und auf die Situation an der jeweiligen Universität ergibt sich ein schlüssiges Gesamtbild. Das erklärt den Umfang der hier vorgelegten Publikation, die darüber hinaus auch das Zustandekommen des Erlasses vom 29. Mai 1908 innerhalb des Ministeriums beleuchtet und hier erstmals nachweisen konnte, dass nicht der „heimliche preußische Kultusminister“ Ministerialdirektor Friedrich Althoff, sondern der seit 1897 als dessen Nachfolger im Amt des Universitätsreferenten wirkende Ludwig Elster die genannte Umfrage initiiert und auch den fraglichen Erlass zu verantworten hatte. Damit ergibt sich insgesamt ein Blick auf das durch einzelne Menschen geprägte, äußerst disparate „Innenleben“ der Entstehungsgeschichte dieses Erlasses, der für die Frauen und deren Unterstützer bis zum Ende des Ersten Weltkriegs ein unüberwindliches Hindernis darstellte. Und es wird auch deutlich, dass dieser Erlass keineswegs umstandslos aus der Abwehr der Universitäten gegen alles Weibliche abgeleitet werden kann, wie dies der Erlass selbst behauptete und wie dies seitdem ohne weitere kritische Nachfrage ständig wiederholt wurde (und wird).
Schon Brinkschulte hat darauf hingewiesen, dass ein Vergleich der Umfrage von 1907 mit dem ziemlich genau 60 Jahre zuvor, im Juli 1847, erhobenen Meinungsbild unter den preußischen Universitäten über die Zulassung von Juden zum akademischen Lehramt lohnend sein könnte. Auch andere Autoren haben verschiedentlich die Gemeinsamkeiten von Antifeminismus und Antisemitismus erwähnt. Doch ein Vergleich dieser beiden bis in die Formulierungen hinein übereinstimmenden Umfragen von 1907 und 1847 ist bisher nirgends erfolgt. Dies geschieht nun ebenfalls in dem hier vorliegenden Text, mit dem überraschend eindeutigen Ergebnis, dass – ersetzt man Religion durch Geschlecht und das Gegensatzpaar christlich-jüdisch durch männlich-weiblich – sich die vorgebrachten Einwände gegen die Habilitation von Juden und Frauen, trotz der unterschiedlichen historischen Gegebenheiten, oft frappierend ähneln. Daran wird deutlich, dass das beiden Fällen gemeinsame Element die Ausgrenzung des jeweils Anderen war, es sich also nicht (oder zumindest nicht nur) um eine speziell gegen Frauen gerichtete Haltung, sondern vielmehr um ein Abwehrverhalten allem Fremden und allen Veränderungen gegenüber handelte, das dem inhärenten Beharrungsvermögen jeder Institution geschuldet ist. Es sei jedoch zugegeben, dass dem Ausschluss beziehungsweise der Marginalisierung von Frauen innerhalb der deutschen Universitäten ein besonders großes, bis heute wirksames Trägheitsmoment innewohnt.
In Emmy Noethers Person sind übrigens beide Diskriminierungen in fast tragischer Weise miteinander verbunden: Am Anfang ihres wissenschaftlichen oder besser gesagt ihres akademischen Lebens erfuhr Emmy Noether Diskriminierung in erster Linie, wenn nicht sogar ausschließlich als Frau. Ab 1933 aber gehörte sie zu den ersten WissenschaftlerInnen, die von den Nationalsozialisten aus Deutschland vertrieben wurden, weil sie eine (politisch aktive) Jüdin war. Davon wird in späteren Bänden dieser Reihe noch ausführlich die Rede sein.
Anlass für die Umfrage vom Januar 1907 war ein Habilitationsgesuch, das die Zoologin Maria von Linden im Sommer 1906 an der Universität Bonn gestellt hatte. Nach einem kurzen Vorspann zur Einordnung dieser Umfrage in die Habilitationsgeschichte Emmy Noethers beginnt daher die hier vorliegende Abhandlung über die Frage „Kann eine Frau Privatdozentin werden?“ mit einer Einführung in den biografischen Werdegang Maria von Lindens und der Geschichte ihres Habilitationsgesuchs.
ΩΩΩ
Der Erlass vom 29. Mai 1908 ursprünglich an den Kurator der Universität Bonn gerichtet, am 9. Juni 1908 vom Kurator der Universität Göttingen an die Göttinger Philosophische Fakultät weitergeleitet, Transkription nächste Seite (UniA GÖ Phil. Fak. 411, o. P.)
Der Königliche Kurator
der
Göttingen, den 9. Juni 1908
Georg-August-Universität
M. 2547
Der Minister
der geistlichen, Unterrichts- und Medi-
Berlin W 64, den 29. Mai
zinal-
1908
Angelegenheiten
UI. N: 743
E[uer] Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, der dortigen Philosophischen Fakultät auf ihre Eingabe vom 11. August 1906 zu eröffnen, daß die Habilitation des Fräulein N. N. [= Maria von Linden]* als Privatdozentin bei der genannten Fakultät nicht zulässig ist, und daß ich aus grundsätzlichen Bedenken auch zur Zeit nicht in der Lage bin, eine Abänderung der Habilitationsbestimmungen herbeizuführen. Die von mir zur Sache gehörten Akademischen Senate und Fakultäten aller diesseitigen Universitäten haben sich in ihren zum Teil sehr eingehenden gutachtlichen Äußerungen mit ganz überwiegender Mehrheit dahin ausgesprochen, daß die Zulassung von Frauen zur akademischen Laufbahn weder mit der gegenwärtigen Verfassung noch mit den Interessen der Universitäten vereinbar sei. Dieser Auffassung trete ich bei.
(: Unterschrift:)
An den Herrn Universitäts-Kurator in Bonn
* Eckige Klammern in einem zitierten Originaltext markieren künftig immer Einfügungen oder Erläuterungen der Autorin.
Am 26. November 1915 stellte die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Abteilung der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen beim Preußischen Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten einen Antrag auf Habilitation von Emmy Noether, der folgendermaßen begann:
Eure Exzellenz
bittet die mathematisch-naturwissenschaftliche Abteilung der philosophischen Fakultät der Göttinger Universität ehrerbietigst, ihr im Falle des Habilitationsgesuches von Fräulein Dr. Emmy Noether (für Mathematik) Dispens von dem Erlass des 29. Mai 1908 gewähren zu wollen, nach welchem die Habilitation von Frauen unzulässig ist.
Zur Zeit dieses Erlasses war die Immatrikulation von Frauen noch nicht gestattet; sie erfolgte bald darauf. Wir glauben aber die Rechtslage doch so auffassen zu müssen, dass die Habilitation von Frauen ohne generelle oder spezielle Erlaubnis Eurer Exzellenz auch heute noch unzulässig ist.1
Auf diesen Runderlass hatte erstmals Felix Klein (1849-1925) hingewiesen, der als Mathematiker Mitglied der Habilitationskommission Emmy Noethers war. In seinem Gutachten für Emmy Noethers Habilitationsgesuch vom 20. Juli 1915 vertrat er die Auffassung, dass man um Dispens von diesem Erlass nachsuchen müsse, der seinerzeit die Habilitation von Frauen an preußischen Universitäten, wie Klein schrieb, „untersagt“ hatte.2
Bemerkenswert an diesem Erlass, den das Ministerium dann auch tatsächlich bei der endgültigen Ablehnung des Habilitationsgesuchs Emmy Noethers im November 1917 zur Grundlage seiner Entscheidung machen sollte, ist zum einen, dass er eine Reaktion auf den von der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn ausgehenden Versuch war, in Preußen erstmals eine Frau zu habilitieren, und zum anderen, dass das Ministerium auf die entsprechende Anfrage aus Bonn im Januar 1907 eine Umfrage unter allen preußischen Universitäten veranlasste und um eine „gutachterliche Äußerung“ zu der Frage bat, „ob es mit der gegenwärtigen Verfassung und den Interessen der Universitäten vereinbar ist, Frauen zur akademischen Laufbahn zuzulassen.“3
Die Antworten auf diese Umfrage und auch die dieser vorangehende Diskussion in der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn erlauben aufschlussreiche Einblicke sowohl in die Argumentationsmuster, mit der sich die Mehrheit der preußischen Professoren des Eindringens von Frauen in den akademischen Lehrkörper erwehrte, als auch in das durchaus beeindruckende Engagement der unterlegenen Befürworter von Frauenhabilitationen. Zu diesen gehörte insbesondere die Mehrheit der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn, die sich klar für die Habilitation der antragstellenden Maria Gräfin von Linden (1869-1936) ausgesprochen hatte. Doch ihre fakultätsinternen Gegner stritten unter der Führung des Zoologen Hubert Ludwig (1852-1913) so erbittert um die Revision dieser Entscheidung, dass ihnen das entscheidende „Verdienst“ zukommt, dass es überhaupt zu der genannten Umfrage kam.
Der Minister
der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten
Berlin, den 19. Januar 1907
~
UI. 18293.
Neuerdings hat an einer Preußischen Universität eine Dame ihre Zulassung zur Habilitation nachgesucht. Bei der allgemeinen Bedeutung dieses Einzelfalles für unsere Universitäten entsteht zunächst die grundsätzliche Frage, ob es mit der gegenwärtigen Verfassung und den Interessen der Universität überhaupt vereinbar ist, Frauen zur akademischen Laufbahn zuzulassen.
1 Schreiben der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Abteilung der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen an den preußischen Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten vom 26.11.1915, Universitätsarchiv Göttingen (UniA GÖ) Kur., 4134: „Frauenpromotionen pp.“, o. P.; auch vorhanden in: ebenda Math.-Nat. Pers., in 17: Personalakte Prof. Noether, 19151928 (1967), o. P., und in Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStAPK) I. HA Rep. 76 Va, Sekt. 1, Tit. VIII, Nr. 8, Adh. III, Bl. 146 f.
2 Gutachten Kleins vom 28.7.1915 auf fortlaufenden Blättern im Anschluss an das Rundschreiben des Abteilungsvorstehers Edmund Landau (1877-1938) vom 20.7.2015, Antwort des Kurators auf die Anfrage Landaus nach dem genauen Wortlaut des Erlasses vom 29.5.1908 mit Abschrift des Erlasses 24.7.1915, Math.-Nat. Pers., in 17: Personalakte Prof. Noether, 1915-1928 (1967), o. P. Zur Entstehungsgeschichte des Dispensantrages und zu der ihm folgenden weiteren Entwicklung siehe Cordula Tollmien, Die Lebens- und Familiengeschichte der Mathematikerin Emmy Noether in Einzelaspekten 2/2021: „Wir bitten nur um Dispens für den vorliegenden einzigartig liegenden Fall“ – die Habilitation Emmy Noethers, tredition Hamburg 2021.
3 Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten (künftig in der Regel einfach Kultusminister oder Kultusministerium) Rundschreiben vom 19.1.1907, GStAPK I. HA Rep. 76 Va, Sekt. 1, Tit. VIII, Nr. 8, Adh. III, Bl. 4. Auch in: UniA GÖ Kur., 4134, o. P., Abschrift ebenda in den Fakultätsakten Phil. Fak. 411: „Das Frauenstudium 1905-1920“, o. P., und in den Rektoratsakten Sek., 555.c: „Das Frauenstudium Generalia“, o. P.
1. Das Habilitationsgesuch Maria von Lindens an der Universität Bonn
Schon im Jahre 1901 hatte erstmals eine Frau, nämlich die 1898 an der Universität Zürich in Germanistik promovierte Adeline Rittershaus-Bjarnason (1867-1924), eine Anfrage wegen einer möglichen Habilitation an die Universität Bonn gestellt. Vom Rektor der Universität an den Kurator und von diesem an das Preußische Kultusministerium in Berlin verwiesen, erhielt sie nach Monaten des Wartens die Antwort, dass das Ministerium über die Frage der Habilitation einer Frau nicht entscheiden könne. Es sei ihr jedoch freigestellt, sich mit ihrem Habilitationsgesuch an irgendeine Philosophische Fakultät in Preußen zu wenden. So stellte sie im Juni 1901 bei der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn einen entsprechenden offiziellen Antrag. Dort prüfte man jedoch gar nicht erst ihre Qualifikation, sondern stellte nur die allgemeine Frage, „ob die Herren der Fakultät mit einer Dame zusammenarbeiten wollten“ – so jedenfalls berichtete dies Adeline Rittershaus-Bjarnason selbst ein Jahr später in der Zeitschrift Frauencorrespondenz, in der sie ihre Erfahrungen mit der Bonner Universität schilderte.4 Dennoch sprachen sich immerhin 14 der Bonner Professoren für die Zulassung von Rittershaus-Bjarnason zur Habilitation aus, „falls die Arbeit den wissenschaftlichen Anforderungen entspreche“. Lediglich der Botaniker Eduard Strasburger (1844-1912) bestand darauf, dass die Arbeit „hervorragend“ sein müsse.5 Doch da eine knappe Mehrheit von 16 Professoren „aus prinzipiellen Gründen“ gegen die Habilitation einer Frau votierte, wurde ihr Gesuch dennoch abgelehnt. Explizit genannt wurden diese „prinzipiellen Gründe“ übrigens in der lediglich schriftlichen, also ohne Diskussion erfolgten Abstimmung nicht, nur der Historiker Moritz Ritter (1840-1923) verwies darauf, dass er einen Präzedenzfall befürchte, da „ein bejahender Beschluß unter allen Umständen weiterwirken würde und zwar im Sinne einer Umwälzung unserer Universitätsverfassung“.6 Das Ergebnis dieser Abstimmung erfuhr Ritterhaus-Bjarnason zunächst nur „privatim“ vom Dekan der Fakultät. Erst nachdem sie gegen das Vorgehen der Universität protestiert hatte, die einer Frau „so engherzig noch Hindernisse in den Weg lege und ihre wissenschaftliche Karriere um ein ganzes Jahr verzögere“, was „jeder rechtlich denkende Mensch“ verurteilen müsse, erhielt sie mit der von ihr angemahnten Rücksendung ihrer Unterlagen endlich auch eine offizielle Ablehnung ihres Habilitationsantrages, „selbstverständlich ohne Angabe des Grundes.“7
Klugerweise hatte sich Rittershaus-Bjarnason im Sommer 1901 nicht nur in Bonn, sondern auch an der Universität Zürich, an der sie drei Jahre zuvor promoviert worden war, um die Habilitation beworben. Da auch die Philosophische Fakultät in Zürich zunächst dazu tendierte, das Unterrichtsgesetz, das nur Männer als Privatdozenten vorsah, wörtlich auszulegen, dauerte das Habilitationsverfahren länger als damals üblich. Nachdem aber ihr Doktorvater Albert Bachmann (18631934) sich für Rittershaus-Bjarnason eingesetzt und sich auch die Erziehungsdirektion für Frauenhabilitationen ausgesprochen hatte, bekam sie schließlich am 20. Januar 1902 die Venia legendi für alt- und neuisländische Sprache und Literatur. Eine Woche später hielt sie als erste Züricher Privatdozentin nach der Juristin Emilie Kempin-Spyri (1853-1901) – der man allerdings die Habilitation 1891 noch verweigert und die Venia legendi nur als Ausnahme direkt durch das Erziehungsministerium zugesprochen hatte – vor mehreren hundert Zuhörern ihre Antrittsvorlesung. Der Züricher Tages-Anzeiger berichtete danach, dass ihre „gediegenen und interessanten Ausführungen, die von grosser Sachkenntnis und fleissigen Quellenstudien Zeugnis“ ablegten, am Schlusse lebhaften Beifall gefunden hätten, „der bemerkenswerterweise von den Professorenbänken ausging“.8
Adeline Rittershaus-Bjarnason um 1914 (Ausschnitt, UAZ AB 1.0800)
Von einer solchen Zustimmung zu „weiblichen Privatdozenten“ war man an preußischen Universitäten zu diesem Zeitpunkt noch weit entfernt. Doch hatten sich, als fünf Jahre später, im Juli 1906, Maria Gräfin von Linden (1869-1936) ihren Antrag auf Habilitation stellte, die Mehrheitsverhältnisse zumindest an der Bonner Philosophischen Fakultät immerhin soweit zugunsten der Frauen verändert, dass die Fakultät diesmal das Habilitationsgesuch Maria von Lindens befürwortete und das Habilitationsverfahren bis zum Gutachten über die vorgelegte Arbeit durchlaufen ließ, ehe sie – aufgrund des Protestes der in der Abstimmung über das Gesuch unterlegenen Minderheit – dann doch wieder beim Ministerium nachfragte, ob dieses überhaupt zulässig sei. Und anders als im Fall von Rittershaus-Bjarnason, in dem sich das Ministerium noch für nicht zuständig erklärt hatte, zog diesmal der Minister das Verfahren an sich und provozierte darüber hinaus das grundsätzliche, künftig für alle preußischen Universitäten verbindliche Verbot von Frauenhabilitationen, das bis 1919 Gültigkeit behalten sollte. „Da die Zulassung zur Habilitation und die Verleihung der Venia legendi zu den wenigen Rechten gehörte, in denen die Universitäten bis dahin frei von staatlicher Beeinflussung entscheiden konnten“, so Eva Brinkschulte in ihrer profunden Analyse der Entstehungsgeschichte des Erlasses vom 29. Mai 1908, „kommt der ministeriellen Strategie hier besondere Bedeutung zu.“9
Der Werdegang der ersten Tübinger Studentin Maria von Linden
Bevor Maria Gräfin von Linden im Sommer 1906 an der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn ihr Gesuch auf Habilitation stellen konnte, hatte sie einen langen und kräftezehrenden Kampf für ihre wissenschaftliche Ausbildung kämpfen müssen. Nach der für Mädchen damals üblichen Schulbildung an einer Höheren Töchterschule hatte sie sich privat vor allem in Latein und Mathematik so weit fortgebildet, dass sie in der Lage war, im Frühsommer 1891 am Stuttgarter Realgymnasium als Externe die Reifeprüfung ablegen zu können.10 Die Genehmigung des Königlich-Württembergischen Ministers für Kirchen- und Schulwesen und des Rektors des Realgymnasiums, dass sie diese Prüfung ablegen durfte, hatte ihr damals schon weit über 80jähriger Großonkel Joseph von Linden (1804-1895) erwirkt, der von 1852 bis 1864 württembergischer Innenminister und als Sprecher des Landtages leitender Minister des Königreichs gewesen war. Als Gegner der Revolution von 1848 hatte von Linden zwar eine konservative und streckenweise auch repressive Politik zu verantworten, jedoch war es ihm, der – wie Maria von Linden auch – katholisch war, 1862 gelungen, im lutherisch dominierten Württemberg das Verhältnis der katholischen Kirche zum württembergischen Staat in einer Weise zu regeln, die dem Königreich den später im Deutschen Reich und besonders in Preußen eskalierenden, das Verhältnis der beiden Konfessionen nachhaltig beschädigenden sogenannten Kulturkampf ersparte.11 Dadurch hatte der Name von Linden in katholischen Kreisen einen sehr guten Klang, was sich während der Diskussion über die Zulassung Maria von Lindens als Gasthörerin an der Universität Tübingen insofern auszahlen sollte als, wie Maria von Linden in ihren Erinnerungen schrieb, der Vertreter der katholisch-theologischen Fakultät bei der Abstimmung im Senat den Ausschlag gegeben habe.12
Die offizielle Zulassung Maria von Lindens als erste Studentin an der Universität Tübingen erfolgte mit Erlass des Ministeriums vom 6. Dezember 1892, natürlich mit der üblichen Einschränkung, dass sie bei jedem einzelne Ordinarius vor dem Besuch seiner Lehrveranstaltungen um dessen persönliche Erlaubnis nachsuchen musste.13 Das Einverständnis des württembergischen Königs hatte wieder Maria von Lindens Großonkel Joseph von Linden eingeholt, dem es offenbar ein patriotisches Anliegen war, zu verhindern, dass seine Großnichte im Ausland studieren musste: „Mein Großonkel war der Meinung“, erinnerte sich Maria von Linden später, „meine Studienpläne müßten unter allen Umständen in Württemberg zur Durchführung kommen. In der Schweiz wäre es ein Leichtes gewesen [als Frau zu studieren], aber warum sollte in Württemberg nicht möglich gemacht werden, was in der Schweiz möglich war und sich bewährte.“14
Von entscheidender Bedeutung für den positiven Ausgang ihres Zulassungsgesuchs an der Universität Tübingen aber war die Unterstützung des Mathematikers Alexander Brill (1842-1935), der seit der ersten Anfrage Joseph von Lindens für seine Großnichte im Jahre 1888, in dem Brill gerade Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät gewesen war, Maria von Lindens Bemühungen um die Aufnahme eines Studiums mit Rat und Tat begleitet hatte und sie während ihrer Tübinger Studienzeit nicht nur weiter fachlich unterstützte, sondern ihr auch sein Haus und seine Familie freundschaftlich öffnete.15
Persönlich kennengelernt hatte Maria von Linden Brill durch die „für alles weibliche Streben zugängliche“ Professorengattin Maria von Froriep (1861-1938),16 die in ihrem Haus eine Art politischen Salon betrieb, in dem auch Brill und seine Frau Anna verkehrten und in dem intensiv „über das Für und Wider des weiblichen Studiums debattiert wurde.“ Es war denn auch Anna Brill (1848-1952), die – als Maria von Linden nach dem Tod ihres Vaters im Januar 1893 und den Anstrengungen der letzten Jahre schwer erkrankte – maßgeblich deren Pflege mittrug. Höchstwahrscheinlich ging es auch auf Alexander Brill zurück, dass seine Professorenkollegen Maria von Linden, nachdem sie durch den Tod des Vaters und diesem folgende Erbstreitigkeiten in finanzielle Bedrängnis geraten war, ihr als unterstützende Erstmaßnahme die Kolleggelder zurückerstatteten.17
Und über Brill führt denn auch eine nicht ganz direkte, aber auch nicht ganz abseitige Linie zu Emmy Noether (1882-1935): Denn Alexander Brill war seit gemeinsamen Studienzeiten in Gießen ein enger Freund von Emmy Noethers Vater Max Noether (1844-1921), mit dem er regelmäßig gemeinsam publizierte und mit dem er seit 1891 durch die Arbeit an einem Bericht über die Entwicklung der Theorie der algebraischen Formen – eine Auftragsarbeit für die im Jahr zuvor gegründete Deutsche Mathematiker-Vereinigung – besonders eng verbunden war.18
Es ist daher mit großer Sicherheit davon auszugehen, dass Max Noether von der ersten Tübinger Studentin und auch von den ihrer Zulassung vorausgehenden Diskussionen erfahren hat, einschließlich der Tatsache, dass von Linden zuvor als Externe die Reifeprüfung am Stuttgarter Realgymnasium abgelegt hatte, was wie die Aufnahme ihres Studiums in Tübingen ebenfalls weit über Stuttgart hinaus Aufsehen erregt hatte: „In Tübingen gab es im Jahres des Heils 1892“, so Maria von Linden selbstironisch in ihren Erinnerungen, „an Kultursensationen: einen Gepäckträger, eine Droschke und, nachdem ich nun glücklich in die Universitätsstadt eingezogen war, auch noch eine Studentin.“19
Zwar war Emmy Noether 1892, als Maria von Linden als Gasthörerin in Tübingen zugelassen wurde, erst zehn Jahre alt und besuchte noch die Höhere Töchterschule in Erlangen, doch als Maria von Linden, die ihr Studium nach dem Tod ihres Vaters mit einem Stipendium des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins hatte fortsetzen können,20 im August 1895 erfolgreich ihr Rigorosum absolviert und dann nach der Drucklegung ihrer Arbeit sich im Februar 1896 stolz als Dr. rer. nat. präsentieren konnte,21 stand Emmy Noether nur noch ein Jahr vor ihrer Schulentlassung und sie wird auch dieses Ereignis mit großer Wahrscheinlichkeit über ihren Vater vermittelt bekommen haben. Es ist also durchaus denkbar, dass Emmy Noether, als sie sich 1897 ebenfalls entschloss, über private Fortbildung, Universitätsbesuch als Gasthörerin und schließlich Abitur als Externe an einem Knabengymnasium den Weg an die Universität bis zur Promotion zu gehen,22 auch der erfolgreiche Kampf Maria von Lindens um wissenschaftliche Bildung vor Augen stand.
Maria von Lindens Hoffnung, dass ihr Doktordiplom sie „in den Genuß aller mit dieser akademischen Würde verbundenen Rechte“ versetzen würde,23 sollte sich allerdings sowohl für sie selbst als auch später für Emmy Noether als Illusion erweisen. Von Linden hatte für diese Zurücksetzung gegenüber ihren männlichen Kommilitonen (und später ihren Wissenschaftlerkollegen) ein genaues Gespür, das sie sich auch nach einer insgesamt schließlich doch weitgehend gelungenen Karriere erhalten sollte, und so vermerkte sie in ihren Erinnerungen, dass sie während ihres
Maria von Linden bei einem zoologischen Kolloquium 1897
Maria von Linden vor dem alten Zoologischen Institut in Tübingen um 1897. In der Hand hält sie das Gehäuse einer der Meeresschnecken, über die sie promoviert hatte; beide Fotos aus einem seinerzeit von Friedrich Blochmann (1858-1931) angelegten Fotoalbum (Herbarium Tubingense, Universität Tübingen).
Studiums „genau besehen doch nicht zu den legitimen Kindern der Alma mater Eberhardina Carolina“ gehört habe, „denn es fehlte die standesamtliche Eintragung, die Immatrikulation. Im Grunde genommen war dies ein jeder Gerechtigkeit hohnsprechendes Messen mit zweierlei Maß.“24
Nach ihrer Promotion bildete sich Maria von Linden zunächst vor allem in Physiologie weiter und wurde dann ab dem Sommersemester 1896 von ihrem Doktorvater Theodor Eimer (1843-1898)25 mit der systematischen Ordnung der Zoologischen Sammlung beauftragt. Dies war jedoch nur eine Aushilfstätigkeit und so schlecht bezahlt, dass Maria von Linden, die auch noch ihre mittellose Mutter unterhalten musste, davon nicht leben konnte. Obwohl sich auch hier wieder der württembergische König persönlich für sie einsetzte, scheiterten alle Versuche, ihr ein einigermaßen angemessenes Gehalt zu verschaffen, am Widerstand der universitären Gremien, die nicht bereit waren, ihre Etats für die Anstellung einer Frau zu belasten. Im Wintersemester 1896/97 bekleidete von Linden zwischenzeitlich eine Assistentenstelle am Zoologischen Institut in Halle, musste aber im April 1897 nach Tübingen zurückkehren und wurde dort wieder für einen Hungerlohn weiter in der zoologischen Sammlung beschäftigt. Zum 1. November 1897 übertrug man Maria von Linden dann „provisorisch und widerruflich“ die zweite Assistentenstelle am Tübinger Zoologischen Institut – eine zwar etwas besser, aber immer noch sehr schlecht bezahlte Stellung.26 Wieder wurde trotz wiederholter Bemühungen Eimers eine Erhöhung ihres Gehalts abgelehnt, so dass sich Maria von Linden schließlich gezwungen sah, Tübingen zu verlassen und in Bonn die Stellung eines „Sammlungsassistenten“ anzunehmen, die, wie man dem Württembergischen Kultusministerium mitteilte, „wesentlich besser bezahlt ist, und ihr auch für die Zukunft günstigere Aussichten bietet.“27
Wie der Kontakt nach Halle und später nach Bonn zustande kam, wissen wir nicht. Doch Maria von Linden pflegte seit Schülerinnenzeiten eine ausführliche Korrespondenz mit vielen Wissenschaftlern, so dass sie möglicherweise schon seit ihrer Jugend Beziehungen nach Halle und Bonn hatte. Zudem wird sie auf der Suche nach einer Anstellung alle in Frage kommenden zoologischen Institute angeschrieben haben, die wiederum natürlich von ihr als der ersten promovierten Zoologin bereits gehört hatten. Wie auch immer: Fakt ist, dass der Direktor des Zoologischen und Vergleichend-Anatomischen Instituts und Museums der Universität Bonn Hubert Ludwig, der seit 1887 in Bonn lehrte, am 17. Januar 1899 beim Universitätskurator einen Antrag auf Einstellung Maria von Lindens als zweite Assistentin an seinem Institut stellte. Sie bringe, so Ludwig, alle erforderlichen Voraussetzungen für diese Stelle mit, sei bereits an einer preußischen Universität (nämlich in Halle) ein Semester „als stellvertretender Assistent mit bestem Erfolge“ tätig gewesen und er sei überzeugt, „in dieser vortrefflichen Zoologin einen durchaus tüchtigen Assistenten zu gewinnen.“ 28 Die Stelle, die Maria von Linden am 1. April 1899 antrat, war zunächst auf ein Jahr befristet, wurde dann aber regelmäßig verlängert, bis Maria von Linden zum April 1906 aus Ludwigs Institut ausschied.29
Leider brechen Maria von Lindens Erinnerungen, denen sie den Untertitel „Erlebtes und Erstrebtes eines Sonntagskindes“ gegeben hatte, mit ihrer Promotion und den mit dieser für sie verbundenen Hoffnungen ab. Wie wissen also nicht, warum sie zum April 1906 ihre Stelle im Ludwigschen Institut aufgab oder vielleicht sogar gedrängt wurde, diese aufzugeben. Dass es sich dabei nicht um einen normalen Stellungswechsel handelte, kann man daraus schließen, dass von Linden, als zwei Bonner Tageszeitungen schon im Januar 1906 in einer kleinen Kurzmeldung berichteten, dass sie aus dem Zoologischen Institut ausgeschieden sei, extrem empfindlich reagierte. Sie wurde bei beiden Redaktionen vorstellig und verlangte eine Richtigstellung dahingehend, dass sie die Assistentenstelle erst zum 1. April 1906 niederlege. In der berechtigten Annahme, dass eine solche Richtigstellung nicht erfolgen werde, wandte sie sich darüber hinaus an den Universitätskurator mit der Bitte, dass dieser entsprechend tätig werden sollte, da die beiden Zeitungsnotizen implizierten, „dass ich plötzlich meine Entlassung eingereicht, oder bekommen habe und ich bin auch bereits darauf angesprochen worden, was die Ursache dieses plötzlichen Austritts sei.“31
In der ersten Reihe als vierte von rechts – fast erdrückt von der Vielzahl der sie umgebenden Männer – Maria von Linden, die auf der Versammlung einen Vortrag „Über Sinnesorgane auf der Puppenhülle von Schmetterlingen“ gehalten hatte. Hubert Ludwig, der 1901 zu einem der stellvertretenden Vorsitzenden der Zoologischen Gesellschaft gewählt worden war,30 könnte der nach links gewandte Mann in der Mitte der zweiten Reihe sein. (UAT S 17b/25)
Was war da geschehen? Was war die Ursache für den Bruch zwischen Ludwig und von Linden, die immerhin sieben Jahre zusammengearbeitet hatten? Und dass es sich um einen echten Bruch handelte, lässt sich daran ablesen, dass sich Ludwig, wie oben einleitend schon erwähnt, zum Wortführer der Gegner des Habilitationsgesuches machte, das Maria von Linden im Frühsommer 1906 bei der Philosophischen Fakultät einreichte. War ihre Absicht, sich zu habilitieren, von der sie Ludwig dann im Dezember 1905 berichtet haben muss,32 der (einzige) Grund für das Zerwürfnis zwischen Ludwig und Maria von Linden oder steckte etwas ganz anderes, vielleicht Persönliches, dahinter? Gewiss, Ludwig hatte auch schon gegen die Habilitation von Adeline Rittershaus-Bjarnason votiert,33 und er trat in der Diskussion um die Habilitation Maria von Lindens als ein prinzipieller Gegner jeder Frauenhabilitation auf. Doch sein erbitterter, letztlich erfolgreicher Kampf gegen die Habilitation Maria von Lindens, von dem im Folgenden noch ausführlich die Rede sein wird, trägt Züge einer tiefergehenden Verletzung, die wahrscheinlich beidseitig war.
Nun war Maria von Linden sicher keine einfache Person. Sie war willens- und durchsetzungsstark, trat bewusst unweiblich auf (als Kind hatte sie davon geträumt, eines Tages ein Junge zu werden), und sie hatte ein klares Bild davon, wer und was sie sein wollte. Und davon ließ sie sich von niemandem abbringen, auch nicht beispielsweise von der Tübinger Frauenrechtlerin Mathilde Weber (1829-1901), der Witwe des Nationalökonomen Heinrich von Weber (1818-1890), die ihr das Stipendium des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins verschafft hatte und in deren Haus sich „alle nach Tübingen gelangenden berufstätigen, gelehrten und politischen Frauen“ versammelten. Mathilde Weber, so Maria von Linden, in ihren Erinnerungen,
gehörte keineswegs der extremen Richtung der Frauenbewegung an, sie wollte nur eine gerechtere Verteilung des Sonnenlichtes zwischen den Geschlechtern, und daß namentlich auch die akademische Sonne weibliche Wesen bescheinen sollte. Die Frau, die in das öffentliche Leben eintrat, sollte aber um Gotteswillen nichts vom „ Blütenstaub “ verlieren und Urbild der Weiblichkeit bleiben. So sehrFrau Weber nun meine Pionierarbeit anerkannte, so konnte sie sich nicht damit abfnden, daß ich, die ich doch so lange auf meine Bubwerdung gewartet hatte, eben doch stark zur Verkörperung des „dritten Geschlechts“ neigte. Ich trug Jackenkleider mit steifem Kragen, Männerhüte, Schuhe, die in ihrer Massivität, Form und Größe ebenfalls an das Männliche grenzten, stand in bester Kameradschaft mit den Kommilitonen, errötete nicht, wenn in der Vorlesung von Männlein und Weiblein die Rede war, kurz – aus meinen Staubbeuteln war der Blütenstaub schon verflogen oder nie in denselben gebildet worden.34
Maria von Linden, Jugendfoto (UAT S 35/1 183 Nr. 3), und links eine Aufnahme aus ihrer Bonner Zeit, wohl 1920er Jahre (UnivA Bonn)
Das war für die damalige Zeit eine äußerst mutiges und vor allem ungewöhnliches Verhalten und möglicherweise sind die „männliche“ Maria von Linden und der ebenfalls sehr durchsetzungsstarke, bisweilen „schroff und rücksichtslos“ auftretende Ludwig35 so aneinander geraten (vielleicht über die Frage der Habilitation), dass eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich war. Doch bleibt dies angesichts fehlender persönlicher Zeugnisse aus dieser Zeit reine Spekulation.
Unmittelbar nach ihrem Ausscheiden aus dem Ludwigschen Institut fand Maria von Linden eine neue Anstellung und zwar zum 1. Mai 1906 als zweite Assistentin am Anatomischen Institut der Medizinischen Fakultät. Der Direktor des Anatomischen Instituts Adolph von La Valette-St. George (1831-1910) begründete seinen Antrag beim Kurator auf die Anstellung eines zweiten Assistenten zunächst mit dem bei den mikroskopischen Übungen anfallenden Arbeitsaufwand:
Namentlich erfordern die mikroskopischen Demonstrationen und Übungen, welche in diesem Halbjahr bereits 115 Teilnehmer zählen, eine sehr eingehende Unterweisung der Studierenden, sowie eine zeitraubende sorgsame Vorbereitung.
Um dann fortzufahren:
Eure Exzellenz haben mir aufgegeben, einen Vorschlag zu Besetzung der neugeschaffenen Stelle zu machen.
Demnach möchte ich mir gestatten, Eure Exzellenz ganz gehorsamst zu bitten, zum zweiten Assistenten die frühere Assistentin des hiesigen Zoologischen Instituts Dr. Gräfin Maria von Linden hochgeneigtest zu ernennen.
Die betreffende Dame hat tüchtige Kenntnisse in Anatomie und Biologie, ist mit den einschlägigen Arbeiten durchaus vertraut, besitzt neben einem sicheren Urteil große manuelle Fertigkeit und wird meiner Meinung nach allen an sie zu stellenden Ansprüchen vollkommen gerecht werden.36
Das sah nach dem Beginn einer erquicklichen Zusammenarbeit aus. Nur hatte Maria von Linden jetzt nicht nur das Institut, sondern auch die Fakultät gewechselt. Dennoch akzeptierte die Philosophische Fakultät ihren nur wenig später gestellten Antrag auf Habilitation und sie fand dort trotz Ludwigs offenkundiger Gegnerschaft vielfältige Unterstützung auch und gerade bei den fachfremden Mitgliedern der Fakultät, die sich damit als überzeugte Befürworter der Habilitation von Frauen erwiesen.
Die Diskussion in der Bonner Philosophischen Fakultät
Maria von Linden stellte ihren Antrag auf Habilitation für das bisher an der Universität Bonn noch nicht vertretene Fach der vergleichenden Biologie Ende Mai oder Anfang Juni 1906.37
Die erste Abstimmung darüber, ob Maria von Linden zu den Habilitationsleistungen zugelassen werden solle, fand vom 9. bis 17. Juni zunächst nur schriftlich statt. Unter expliziter Ablehnung einer „generellen Entscheidung“ über die Habilitation von Frauen sollte im Fall der Zulassung (soll heißen abhängig von dem schriftlichen Umfrageergebnis) der Antrag Maria von Lindens zunächst an die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Abteilung gehen, um die „wissenschaftliche Tüchtigkeit“ der Bewerberin zu bewerten, und danach wieder an die Fakultät, die sich die Entscheidung über „allgemeine und Utilitätsgründe“ vorbehielt. Entschieden wurde über von Lindens Gesuch also nur als Einzelfall und dieses einschließlich des vom Dekan vorgeschlagenen weiteren Procederes von der Bonner Philosophischen Fakultät mit 17 gegen 13 Stimmen zunächst klar befürwortet.38
Leider sind nicht alle Stellungnahmen der schriftlichen Umfrage in der Akte enthalten. Es existiert lediglich ein für das Ministerium angefertigter Auszug von sieben Äußerungen. Nur drei der in diesem Auszug zitierten Ordinarien plädierten darin für die ausnahmsweise Zulassung Maria von Lindens:
Ich bin im Allgemeinen, schrieb der Physiker Johannes Kayser (1853-1940), gegen Zulassung von Damen zur Habilitation und würde gegen jeden Antrag stimmen, wenn ich die betreffende Dame nicht genau kenne. In dem vorliegenden Falle aber bietet die Persönlichkeit alle wünschenswerten Garantien. Wenn mannoch berücksichtigt, daß Gräfin von Linden sehr bedeutende wissenschaftliche Leistungen aufzuweisen hat, und daß sie ein an unserer Universität fehlendes Fach, die Biologie, vertreten will, so begrüße ich ihren Antrag mit Freude, und stimme sehr entschieden für sie. Ihre Habilitation würde ich für eine bedeutende Bereicherung unserer Universität halten.39
Ebenfalls sehr positiv äußerte sich der damals schon fast 70jährige, seit einigen Monaten bereits emeritierte Altphilologe Franz Bücheler (1837-1908), der 1901 auch für die Zulassung von Adeline Rittershaus-Bjarnason gestimmt hatte. Nach einem Hinweis darauf, dass Privatdozenten keinen rechtlichen Anspruch auf eine Anstellung als Professor haben („was der Petentin einzuschärfen, vielleicht zweckmäßig wäre“) führte er aus:
Vom wissenschaftlichen und Fakultäts-Standpunkte aus kann ich die Zulassung von Frauen auch zur Lehre nicht verwerflich finden; irre ich nicht, so hat es auch schon namhafte Universitätslehrerinnen, z. B. in der Mathematik, wenn auch nicht in Deutschland gegeben.40
Gewiß richtig hat Herr Kollege Ritter41im Umlauf von 1901 bemerkt, ein Fall werde unbedingt weiter wirken, und ich verhehle mir nicht die mißliebigen Konsequenzen. Aber einer Person, die ganz dem Anschein nach für die Wissenschaft lebt, die Möglichkeit größerer und wirksamerer Betätigung durch den Hochschulunterricht zu versagen, scheint mir an sich unbillig und bei der Entwicklung welche die Dinge außer, ohne, ja gegen uns genommen haben, besonders hart.42
Worauf Bücheler mit dem letzten Satz anspielte, ist unklar. Möglicherweise auf die Auseinandersetzungen, die zum Ausscheiden Maria von Lindens aus dem Zoologischen Institut und zu ihrem Wechsel an die Medizinische Fakultät geführt hatten („außer und ohne uns“), wodurch sie der Philosophischen Fakultät verloren gegangen war („gegen uns“). Das wäre dann eine sehr klare Positionierung gegen den Kollegen Ludwig gewesen, die sich – wenn es denn so gewesen sein sollte – sicherlich nur ein Emeritus leisten konnte.
„Die Frage, ob die Zulassung einer Dame zur Habilitation der Verfassung entspricht, können wir nach meiner Meinung ruhig dem Ministerium überlassen“, hatte Kayser in seiner Stellungnahme abschließend bemerkt. Doch auch dieser eher harmlos wirkende Satz, der wohl als Entgegenkommen an die Gegner des Habilitationsverfahrens Maria von Lindens gedacht war, stieß schon auf deren entschiedenen Widerspruch:
Rechtlich betrachtet, ist weder die Fakultät, noch der Minister befugt Frauen in den Lehrkörper der Universität aufzunehmen, so der für seine Schroffheit bekannte Althistoriker Heinrich Nissen (1839-1912). Da muß erst ein Gesetz das erlauben.43
Es ist sicher kein Zufall, dass ausgerechnet Nissen, dessen Seminar bei den Studenten vor allem deshalb beliebt war, weil sie die „festen Formen der traditionsreichen altertumswissenschaftlichen Untersuchung“ schätzten und der es übel nahm, wenn einer seiner Schüler eigene Wege ging,44 erstmals die Forderung nach einem Gesetz erhob und damit nicht nur der Fakultät, sondern auch dem Ministerium die Entscheidungsgewalt über Frauenhabilitationen absprach.
Nissens Auffassung schlossen sich der Geograph und bekannte Japanologe Johannes Rein (1835-1918) und auch der Botaniker Eduard Strasburger an, der im Fall von Adeline Rittershaus-Bjarnason noch für deren Zulassung gestimmt hatte (falls ihre Arbeit hervorragend sei), und sich nun „gezwungen“ sah, wie er schrieb, wie der Kollege Nissen zu stimmen.45
Auch der Historiker Moritz Ritter hielt eine potentielle Zulassung Maria von Lindens für eine Kompetenzüberschreitung der Fakultät und auch des Ministers, falls dieser zustimmen sollte. Ritter bekleidete seit 1873 in Bonn einen Lehrstuhl, der nach einem königlichen Erlass von 1853 mit einem katholischen Wissenschaftler besetzt werden musste. Seine Berufung war also mitten im sogenannten Kulturkampf erfolgt, und er war daher nicht nur immer wieder mit konfessionellen Vorurteilen konfrontiert, sondern hatte 1903 auch noch die Kränkung ertragen müssen, dass er als Altkatholik erst 63jährig durch seinen römisch-katholischen Kollegen Aloys Schulte (1857-1941) von seinem Lehrstuhl verdrängt worden war.46 Es ist daher sicher kein Zufall, dass Ritter in seiner Stellungnahme als einziger in seiner Fakultät auf die (im Gegensatz zur geschlechtlichen) in der Satzung verankerte konfessionelle Parität rekurrierte:
Wenn die Fakultät die Frage so einfach, wie der Herr Dekan sie gestellt hat, bejahte, so würde sie eine Entscheidung treffen, zu der sie nicht befugt ist. Wenn auf ihren Antrag der Unterrichtsminister die Zulassung der Gräfin Linden zur Habilitation gestattete, so würde er ebenfalls seine Competenz überschreiten, denn die Satzung, daß der Lehrkörper unserer Universität zwar confessionell, aber nicht geschlechtlich paritätisch ist, daß innerhalb des Lehrkörpers (unserer Universität) nicht nur Professoren, sondern auch Privatdozenten und Lektoren ausschließlich generis masculini sind, beruht auf den Universitätsstatuten (§ 5,1; § 16; § 128 (hier auch die Lektoren);) von dieser aber kann der Minister nicht dispensieren. – Neben diesen rechtlichen Bedenken hebe ich das sachliche Bedenken hervor, ob eine Frage, deren Bejahung in ihren Consequenzen eine radikale Umgestaltung unserer Universitätsverfassung nach sich ziehen kann, so en passant, wie ein laufendes Geschäft und durch Aufstellungen eines Präjudizes, erledigt werden darf.47
Gegen diese von Ritter und Nissen vertretene Rechtsauffassung und offensichtlich als direkte Reaktion auf diese brachten die Befürworter in der Fakultät, die in ihrer Sitzung am 18. Juli 1906 den Beschluss, Maria von Linden zu habilitieren, noch einmal mit dem gleichen Stimmenverhältnis wie in der schriftlichen Abstimmung bekräftigt hatten, detailliert begründete Gegenargumente vor, die sie in dem am 5. August 1906 für das Ministerium verfassten Bericht niederlegten:
Auch die Majorität der Fakultät verhehlte sich nicht, daß Bedenken gegen die Habilitation einer Dame vorliegen. […] Solche Bedenken betreffen fürs erste die Rechtslage. Aber der Majorität der Fakultät scheinen überwiegende Gründe für die rechtliche Zulässigkeit der Habilitation einer Dame zu sprechen. Gewiß ist in unseren durch Kabinettsordre vom 1. September 1827 erlassenen Universitätsstatuten von Privatdozenten, wie von Professoren, Institutsgehilfen, Promovenden und Studenten nur in männlicher Form die Rede. Unzweifelhaft ist an irgend welche weiblichen Glieder der Universität damals nicht gedacht worden. Aber gerade deshalb sollten diese Ausdrücke nicht das genus masculinum betonen und das genus femininum ausschließen. Die bloße männliche Form der sprachlichen Bezeichnung reicht zu einem solchen Ausschluß daher nicht aus. Vielmehr bezeichnen diese Ausdrücke nur die Träger gewisser Rechte und Pflichten: jeder, dem die Rechte und Pflichten übertragen werden, ist Studierender, Institutsgehilfe, Privatdozent u.s.w. Wem sie übertragen werden sollen entscheidet sich daher – unter diesen Voraussetzungen nach anderen als – rechtlichen Gesichtspunkten.48
Das ist eine mehr als bemerkenswerte Argumentation, die von keiner anderen Universität oder Fakultät während der Diskussion über die Habilitation von Frauen in den Jahren 1906 und 1907 in dieser Klarheit vorgebracht wurde. Denn die Philosophische Fakultät der Universität Bonn unterschied hier zwischen grammatischem und natürlichem Geschlecht und legte diese Unterscheidung ganz gegen den herrschenden Zeitgeist im Interesse der Frauen aus, indem sie argumentierte, dass die Frauen in der männlichen (grammatikalischen) Form mit gemeint seien. Sie rekurrierte hier also, ohne dies explizit so zu benennen, auf das inzwischen durch das Postulat der geschlechtergerechten Sprache in Verruf geratene generische Maskulinum, das unter der fraglos richtigen Prämisse, dass Genus und Sexus (sprachliches und biologisches Geschlecht) zwei grundverschiedene Dinge sind, (zumindest formal) alle einschließt und niemanden ausschließt.49 Angesichts der Tatsache, dass sich die Gegner jeder Frauenhabilitation immer wieder darauf beriefen, dass in den Satzungen der Universitäten von Privatdozenten nur in der männlichen (grammatikalischen) Form die Rede sei und dies umstandslos mit dem dadurch gegebenen Ausschluss der Frauen gleichsetzten (diese also keine „Privatdozenten“ werden könnten), zeugt die Aussage der Bonner Philosophischen Fakultät von einem fortschrittlichen und vorurteilsfreien Denken, das in der damaligen Zeit seinesgleichen sucht.
Untermauert wurde die hier entwickelte Beweisführung mit dem Hinweis auf die bisherige Praxis der Zulassung von Frauen als Gasthörerinnen und – mit Blick auf Maria von Linden selbst – deren Beschäftigung als Assistentinnen:
Die Zulassung von Damen als Hospitantinnen ist ohne Änderung des königlichen Erlasses vom Jahr 1827 nur durch Ministerialverfügungen seit dem Jahr 1896 gestattet und geregelt worden. Wie an anderen preußischen Universitäten, so ist auch an unserer Fakultät in dem Jahre 1905-06 die Promotion einer Dame vollzogen worden, ohne daß gegen diese Zulassung und die Erteilung der Doktorwürde irgend ein Bedenken von einem Mitgliede der Fakultät ausgesprochen worden wäre. Diese Praxis ist bei den Studierenden und Promovenden nicht stehen geblieben. Auch bei uns ist eine Dame als ‚ordentlicher Institutsgehilfe‘, wie sie in § 5.2 unserer Universitätsstatuten aufgeführt werden, bestellt worden: die Gräfin … Dr. von Linden war von Winter 1898 bis zum April dieses Jahres zweite Assistentin am hiesigen zoologischen Institut, und fungiert seitdem in gleicher Eigenschaft am hiesigen anatomischen Institut. […] Wenn rechtliche Bedenken der Anstellung solcher weiblichen Mitglieder des Lehrkörpers nach § 5.2 der Statuten nicht entgegen standen, so scheinen sie uns auch nicht aus dem Wortlaut des § 5.1 dieser Statuten gegen die Zulassung von weiblichen Privatdozenten herleitbar zu sein. Zur Stütze dieser ihrer Rechtsauffassung darf sich die Majorität der Fakultät ferner auf die Tatsache berufen, daß in unserem Senat bei der Beschlußfassung in diesem Semester über den Antrag der hiesigen Abiturientinnen auf Zulassung zur Immatrikulation keines der Mitglieder, auch keiner der anwesenden Juristen, ein rechtliches Bedenken gegen diese Zulassung erhob.50
Auch auf das von Nissen vorgebrachte Argument, dass Privatdozenten „Quasi-Staatsbeamte“ seien und die Verfassung bisher weder weibliche Professoren noch Richter kenne,51 ging man in dem Bericht ein, indem man darauf verwies, dass aus dem Privatdozentenstatus nicht der Anspruch auf eine Professur folge:
Eine rechtliche Consequenz auf den Bestand des engeren Lehrkörpers der Universität hat die Zulassung von Damen zur Habilitation überdies nicht. Nach der Begründung des Entwurfs eines Gesuchs betreffend die Disciplin über die Privatdozenten vom Januar 1896 werden die Privatdozenten nicht vom Staat angestellt, sondern haben nur die Erlaubnis zum Halten von Vorlesungen in einer bestimmten Sache erhalten, sie erlangen dadurch eine beamtenähnliche Stellung, welche ihnen ebenso wie den beamteten Professoren bestimmte Verpflichtungen auferlegt. Und der § 34 unserer Universitätsstatuten besagt, daß die Privatdozenten kein Recht auf eine außerordentliche Professur haben, ein Grundsatz, dem in § 63 der Fakultätsstatuten eine schwächere, aber gleichfalls jedes Recht ausschließende Formulierung gegeben ist.52
Das ist eine zwar rechtlich einwandfreie, aber in ihrer Konsequenz dennoch etwas fragwürdige Argumentation. Denn natürlich strebten Frauen genau wie Männer mit der Habilitation letztendlich eine Professur an, und das wussten natürlich auch die Befürworter der Habilitation Maria von Lindens. Möglicherweise sollte das Argument, dass eine Habilitation ja noch keine automatischen Auswirkungen auf den engeren Lehrkörper habe, auf das Ministerium und die Gegner jeder Frauenhabilitation und vielleicht auch auf nur zögerliche Befürworter beruhigend wirken. Auf jeden Fall wollte man offensichtlich vermeiden, die Diskussion um die Habilitation von Frauen nicht schon mit dem nächsten Schritt (der Übernahme eines Lehrstuhls durch eine Frau) zu belasten. Dies war allerdings vergeblich, da die Gegner von Frauenhabilitationen natürlich immer wieder darauf verwiesen, dass mit der Habilitation auch die Frage der Übernahme einer Professur durch eine Frau im Raum stünde. Es gab jedoch, wie wir weiter unten sehen werden, auch Stimmen, die eben, weil eine Lehrstuhlübernahme durch eine Frau früher oder später die unausweichliche Folge ihrer Zulassung zur Habilitation sein würde, diese Konsequenz nicht nur mitbedachten, sondern ausdrücklich befürworteten.
Die „nicht rechtlichen Bedenken, die der Habilitation von Frauen entgegen stehen, sind von der Fakultät gleichfalls erwogen worden“, hieß es weiter in dem Bericht der Bonner Philosophischen Fakultät:
Auch die Majorität der Fakultät hält dafür, daß es nicht im Interesse der Universitäten liegt, wenn Frauen-Habilitationen sich häufen. Eine freie Bahn zu regelmäßigen Zulassungen soll nicht geschaffen werden. Eine bloße Durchschnittsleistung soll nicht als ausreichende Qualifikation für die Habilitation einer Dame angesehen werden. Wir finden es überdies angezeigt, daß gewisse Garantien in dem Lebensalter sowie in dem Gesamtcharakter der Bewerberinnen gefordert werden. Schon deshalb halten wir es, ebenso auch aus Gründen, die den bisherigen Erfahrungen entstammen, keinesfalls für wahrscheinlich, daß solche Gesuche sich häufen. Es wird und soll sich vielmehr stets um Ausnahmefälle handeln, die den Gesamtcharakter unserer Universitäten nicht zu ihrem Nachteil verändern können. Es schien der Majorität deshalb unerläßlich festzustellen, ob ein Ausnahmefall dieser Art in der Meldung der Gräfin … Dr. von Linden vorliege.53
Damit argumentieren die Befürworter der Habilitation von Lindens exakt so, wie dies neun Jahre später auch die Fürsprecher Emmy Noethers tun sollten, die in ihrem Antrag und ihren Gutachten immer wieder betonten, dass eine grundsätzliche Regelung von Frauenhabilitationen nicht beabsichtigt und auch nicht erwünscht sei, sondern lediglich eine Ausnahme für den, wie es bei Emmy Noether hieß, „vorliegenden einzigartig liegenden Fall“.54
Federführend verfasst worden war der oben zitierte Bericht von dem Philosophen und Psychologen Benno Erdmann (1851-1921), der 1906 Dekan der Philosophischen Fakultät war und ein Jahr später zum Rektor der Bonner Universität gewählt werden sollte. Seine Einführungsrede als Rektor hielt Erdmann über die „Funktionen der Phantasie im wissenschaftlichen Denken“ und präsentierte sich damit wie auch im Fall Maria von Lindens als unkonventioneller und eigensinniger Denker.
Während seiner Studienzeit hatte Erdmann zudem ein Semester in Heidelberg studiert, und zwar genau zu der Zeit, als die Universität Heidelberg als erste Universität in Deutschland drei Studentinnen als Gasthörerinnen zugelassen hatte, und zwar die später weltbekannte Mathematikerin Sofja Kowalewskaja (1850-1891) und ihre beiden Freundinnen, die Chemikerin Julia Lermontowa (1847-1919) und die Juristin Anna Jewreinowa (1849-1919). Zwar hatte Kowalewskaja Heidelberg, als Erdmann dort im Sommersemester 1871 studierte, schon wieder verlassen, aber Lermontowa und Jewreinowa waren noch da, und Erdmann hat diese Frauen, die in der ganzen Stadt so großes Aufsehen erregten, dass sich die Leute auf der Straße nach ihnen umdrehten, sicherlich ebenso wahrgenommen wie dies auch Emmy Noethers Vater Max Noether getan haben wird, der sich Anfang der 1870er Jahre gerade in Heidelberg habilitierte.55 Erdmann war also wie Max Noether ein Zeitzeuge der allerersten, noch von Ausländerinnen bestrittenen Anfänge des Frauenstudiums in Deutschland, was beide nicht unbeeinflusst gelassen haben wird.56
Seine Kollegen und Schüler bescheinigten Erdmann nicht nur ein ausgeglichenes und ausgleichendes, jede Polemik ablehnendes Wesen gehabt zu haben, sondern auch eine tiefe, jedoch völlig unsentimentale „Güte des Herzens“, die sich insbesondere in seiner Lehrtätigkeit offenbarte und Ausdruck seiner „einheitlich geschlossenen Persönlichkeit“ war.57
Von einer „einheitlich geschlossenen Persönlichkeit“ konnte dagegen bei Hubert Ludwig, zu dessen Gegenspieler Erdmann in der Habilitationsangelegenheit Maria von Lindens als Dekan nolens volens geworden war, keine Rede sein. Über ihn schrieb sein Gießener Kollege Johann Wilhelm Spengel (1852-1921) die folgenden, an Deutlichkeit nicht zu überbietenden Worte, die umso bemerkenswerter sind, weil sie sich in einem Nachruf finden, in dem Zurückhaltung geboten ist und negative Charaktereigenschaften normalerweise keinen Platz finden:
War er einmal zu der Einsicht gelangt, welcher Weg der richtige sei, so ging er ihn unbeirrt und unverwandt. Hindernisse zu umgehen, war nicht seine Art; meist zog er vor, sie, gelegentlich mit schonungslosem Tritt, bei Seite zu stoßen, selbst auf die Gefahr hin, schroff und rücksichtslos zu erscheinen.58
Auch Ludwigs Bonner Kollege und Mitstreiter gegen die Habilitation Maria von Lindens, der Chemiker Richard Anschütz (1852-1937), hat Ludwig offensichtlich ganz ähnlich wahrgenommen:
In seltenem Maße hatte er die Gabe, unvermutet ihm entgegentretende Schwierigkeiten rasch zu durchschauen und zielbewusst aus dem Weg zu räumen. Unterstützt durch ein ausgezeichnet geschultes Gedächtnis und einen keine Ermüdung kennenden Fleiss schuf er seine scharfsinnigen Gutachten.59
Diese hier beschriebenen Verhaltensweisen zeigte Ludwig auch in der Habilitationssache Maria von Lindens, in der er unermüdlich ein (Gegen-)Gutachten nach dem anderen verfasste und sich trotz aller Beschwichtigungs- und Mäßigungsversuche von Seiten Erdmanns rechthaberisch bis zur Streitsucht und besserwisserisch bis zur Pedanterie gerierte.60
Schon in der einem ersten Stimmungsbild dienenden schriftlichen Umfrage von Anfang Juli 1906 hatte Ludwig vehement gegen die vorgegebene Fragestellung Erdmanns protestiert und wie Nissen und Ritter eine gesetzliche Regelung der Frauenhabilitationen verlangt:
Ich widerspreche der von dem Herrn Dekan vorgenommenen Vermengung der speziellen Frage mit der prinzipiellen und verlange, daß wie im Jahre 1901 die prinzipielle Frage zuerstfür sich allein gestellt wird. Nur auf diese grundsätzliche Frage, ob Damen überhaupt zu [sic!] Habilitation zugelassen werden können, bezieht sich mein jetziges Votum. Wie früher bin ich jetzt gegen jede Zulassung von Damen zur Habilitation. Wissenschaftliche Verdienste von Damen können, wo sie in ausreichendem Maße vorhanden sind, auf anderem Wege eine öffentliche, staatliche Anerkennung erfahren als durch Zulassung zur akademischen Lehrtätigkeit. Letztere ist zur Zeit rechtlich unmöglich; ich schließe mich darin durchaus der Ansicht der Herrn Kollegen Nissen und Ritter an. Weder durch einen Fakultätsbeschluß, noch durch eine Ministerial-Verfügung, sondern nur auf gesetzlichem Wege kann die akademische Laufbahn den Damen eröffnet werden.61
Damit erwies sich Ludwig, der in der 1897 unter dem Titel „Die akademische Frau“ veröffentlichten Umfrage über „die Befähigung der Frau zum wissenschaftlichen Studium und Berufe“ die „grundsätzliche Ausschließung der Frauen von den Universitäten“ noch für ein „Unrecht“ gehalten hatte, „das schon viel zu lange gedauert hat“,62 als einer der Professoren, die Frauen zwar als Studentinnen und als zuarbeitende, ihnen unterstellte Assistentinnen, aber nicht als Kolleginnen akzeptieren konnten.
War nach anfänglichem Widerstreben die Vorstellung von der wissenschaftlich neugierigen, interessierten Schülerin für viele Professoren akzeptabel, für manche auch recht reizvoll geworden, schrieb Hiltrud Häntzschel in ihrem Beitrag zur Geschichte der Habilitation, so bedeutete die Vorstellung vom Geschlechterrollentausch – eine wissenschaftlich ausgewiesene Frau unterrichtet junge Männer – für das Selbstverständnis des deutschen Professors ein unerträgliches Skandalon – ein Infragestellen der eigenen Position. 63
Und dieses Skandalon galt es zu bekämpfen und zwar mit allen Mitteln, und so gab sich Ludwig auch nicht damit zufrieden, dass er bereits in dem zitierten Umlauf seinen Standpunkt klar und eindeutig niedergelegt hatte, sondern protestierte weiter und unermüdlich gegen den Beschluss der Fakultät mit allen ihm zu Verfügung stehenden Mitteln und auf allen Ebenen.
Hubert Ludwig, undatiert (UnivA Bonn, Ausschnitt)
Benno Erdmann um 1906 (Humboldt Universität Berlin)
Schon im Umlauf hatte Ludwig, „für den Fall, daß ich mit meiner Abstimmung in der Minderheit bleibe“,64 ein Separatvotum angekündigt, das neben den schon erwähnten Kollegen Nissen, Strasburger, Ritter und Anschütz, der übrigens wie Strasburger 1901 noch für die Habilitation von Adeline Rittershaus-Bjarnason gestimmt hatte,65 auch der Indologe Hermann Jacobi (1850-1937), der Orientalist Eugen Prym (1843-1913), der Altphilologe Anton Elter (1858-1925) und der Historiker Aloys Schulte unterzeichneten. Der Philosoph und Kunsthistoriker Carl Justi (1832-1912), der Mineraloge Hugo Laspeyres (1836-1913) und der oben schon erwähnte Geograph Johannes Rein befanden sich bei Unterzeichnung dieses Votums schon in den Ferien, so dass – wie Ludwig schrieb – „ihre wahrscheinliche Zustimmung nicht eingeholt werden konnte“.66 Abgesehen von dem zwar von Ludwig im Separatvotum als Angehörigen der unterlegenen Minderheit genannten Germanisten Franz Wilhelm Wilmanns (1842-1911), der sich diesem jedoch nicht offiziell angeschlossen hatte,67 hatte Ludwig für seine Gegenstellungnahme also die Unterstützung aller der insgesamt dreizehn Gegner der Habilitation Maria von Lindens.
Auffällig ist dabei, dass sich um Erdmann die jüngeren Mitglieder der Philosophischen Fakultät scharten und das Durchschnittsalter in dieser Gruppe daher nur 52 Jahre betrug,68 während sich um den mit Erdmann fast gleichaltrigen Ludwig die älteren und alten Fakultätsmitglieder sammelten.69 Das Durchschnittsalter dieser Gruppe betrug 61,5 Jahre, lag also fast zehn Jahre über dem Altersdurchschnitt der Befürworter. An Maria von Linden schieden sich also insbesondere die Geister auch in Jung (pro) und Alt (contra).
Dass jüngere Dozenten aufgeschlossener für das Neue, hier für die Aufnahme von Frauen in den Lehrkörper, sind, ist nicht so selbstverständlich, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Im Gegenteil: Gerade in der Auseinandersetzung um das Frauenstudium erwiesen sich häufig ältere Dozenten, die ihre Karriere schon gehabt hatten und Konkurrenz daher nicht mehr fürchten mussten, als die zuverlässigeren und freundlicheren Frauenförderer.