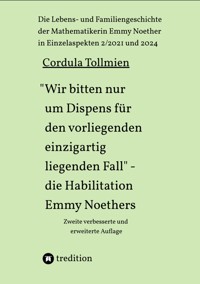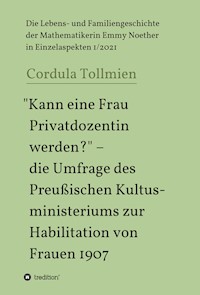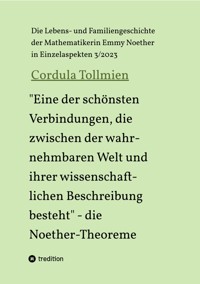
"Eine der schönsten Verbindungen, die zwischen der wahrnehmbaren Welt und ihrer wissenschaftlichen Beschreibung besteht" - die Noether-Theoreme E-Book
Cordula Tollmien
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Die Lebens- und Familiengeschichte der Mathematikerin Emmy Noether in Einzelaspekten
- Sprache: Deutsch
Es geht um die Lebens- und Familiengeschichte der bedeutenden jüdischen Mathematikerin Emmy Noether. Sie wird allzu oft nur auf ihre Mathematik reduziert . Ich möchte Ihr ein facettenreiches vielfältiges Leben zurückgeben, zu dem nicht nur ihre wissenschaftlichen unbestreitbar hohen Verdienste gehören. Deshalb habe ich ihre Biografie auf insgesamt 15 Bände angelegt. Bereits erschienen ist 2021 die Geschichte und die Vorgeschichte Ihrer Habilitation: "Kann eine Frau Privatdozentin werden?" – die Umfrage des Preußischen Kultusministeriums zur Habilitation von Frauen 1907, und "Wir bitten nur um Dispens für den vorliegenden einzigartig liegenden Fall" – die Habilitation Emmy Noethers, beide tredition Hamburg 2021. Mit dem hier vorliegenden dritten Band schließe ich die noch offene Lücke in Emmy Noethers Habilitationsgeschichte, indem ich mich mit dem Thema ihre Habilitationsarbeit beschäftige, in der sie einen wichtigen, bis heute nachwirkenden Beitrag zur Allgemeinen Relativitätstheorie geleistet hat. Dabei stand sie in engem Kontakt mit Albert Einstein und mit den Göttinger Mathematikern Felix Klein und David Hilbert, die die Göttinger Universität zu einem weit über die Grenzen von Stadt und Universität hinaus berühmten Zentrum der Mathematik gemacht hatten, in dem künftig auch Emmy Noether eine wichtige Rolle spielen sollte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 849
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Zitat im Titel stammt von Ernst Peter Fischer, dessen sehr lesenswerte Kleine Geschichte der Wissenschaft in Portraits, der er den Titel Leonardo, Heisenberg & Co gegeben hat (Piper München Zürich 2002), auch einen Abschnitt über Emmy Noether oder Die Bedeutung der Symmetrie einhält. Das Zitat findet sich dort auf S. 136.
Cordula Tollmien, geb. 1951, studierte Mathematik, Physik und Geschichte an der Universität Göttingen. Seit 1987 arbeitet sie als freiberufliche Historikerin und Schriftstellerin und veröffentlichte u. a. auch eine Reihe von Kinderbüchern. Sie war an dem 1987 publizierten Projekt zur Geschichte der Universität Göttingen im Nationalsozialismus beteiligt, arbeitete von 1991 bis 1993 als wissenschaftliche Lektorin bei der Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte und trug Grundlegendes zum dritten Band der Göttinger Stadtgeschichte bei, der die Jahre 1866 bis 1989 behandelt. In den Jahren 2000 bis 2011 hatte sie einen Forschungsauftrag der Stadt Göttingen zur NS-Zwangsarbeit (www.zwangsarbeit-in-goettingen.de), und 2014 erschien ihr Buch über die Geschichte der jüdischen Göttinger Familie Hahn. Mit der Entwicklung der akademischen Frauenbildung und insbesondere mit den Biografien von Mathematikerinnen beschäftigt sie sich seit 1990 – dem Jahr, in dem ihre Arbeit erschien, in der erstmals die Geschichte der Habilitation Emmy Noethers im Detail nachgezeichnet wurde. 1995 publizierte sie eine Biografie der russischen Mathematikerin Sofja Kowalewskaja.
Die Lebens- und Familiengeschichte der Mathematikerin Emmy Noether in Einzelaspekten 3/2023
Cordula Tollmien
„Eine der schönsten Verbindungen, die zwischen der wahrnehmbaren Welt und ihrer wissenschaftlichen Beschreibung besteht“ – die Noether-Theoreme
Ahrensburg 2023
© 2023 Cordula Tollmien, Rehhagen 7, 34346 Hann. Münden – www.tollmien.com
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg
ISBN
Softcover:
978-3-384-08324-1
Hardcover:
978-3-384-08325-8
E-Book:
978-3-384-08326-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Es ist m. E. nicht anzunehmen, daß in der ganzen Welt irgend jemand anders heute existiert, der für uns erreichbar wäre und uns Fräulein Noether ersetzen könnte.
Constantin Carathéodory am 1. August 1915 in seinem Gutachten zu Emmy Noethers Habilitationsgesuch
Danksagung
An erster Stelle ist hier Tilman Sauer zu nennen, der mich nicht nur auf die Notizen Felix Kleins zu seinen Besprechungen mit Emmy Noether aufmerksam gemacht hat, sondern mir auch seine chronologisch sortierte Transkription dieser Notizen und der ebenfalls in diesem Aktenkonvolut enthaltenen Briefe zur Verfügung gestellt hat. Auch David Rowe danke ich sowohl für eine Vielzahl von Literaturhinweisen, die mir von großem Nutzen waren, als auch für die von ihm in bekannter Großzügigkeit überlassenen Quellen. Beide habe im Übrigen eine vorläufige Fassung meines Manuskripts gelesen und mir wertvolle Tipps für dessen Überarbeitung gegeben.
Besonders erfreulich waren für mich die anregenden Diskussionen mit Michael Negele, der mich vor einigen Jahren als Mitherausgeber einer dreibändigen Biografie des Schachspielers und Mathematikers Emanuel Lasker kontaktiert hatte und dem ich wertvolle Hinweise zu den Beziehungen zwischen Lasker und Max und Emmy Noether verdanke, von denen zu profitieren ich in dem hier vorliegenden Band zunächst gar nicht erwartet hatte.
Ich danke außerdem allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der von mir kontaktierten Archive und Bibliotheken: Genutzt und ausgewertet habe ich in erster Linie die Nachlässe von David Hilbert und Felix Klein, die von Frau Bärbel Mund in der Handschriftenabteilung der Göttinger Universitätsbibliothek in gewohnter Weise freundlich und sachkundig betreut werden. Doch auch Marlinde Schwarzenau von Archiv des Deutschen Museums in München verdanke ich wichtige Hinweise, und Oliver Schröer vom Stadtarchiv Göttingen hat für mich die Göttinger Lokalzeitungen nach einer Spur von Einsteins Göttinger Vorlesungen im Juni/Juli 1915 durchforstet.
Mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat mir in besonderer Weise Angelika Deese, und meine Schwester Sibylle Rohr hat mich in allen Alltagsdingen unterstützt, so dass mir Zeit und Kraft für die hier vorgelegte umfangreiche Veröffentlichung blieb.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Danksagung
Vorwort
1. Emmy Noether trifft auf Einstein
Der Tod der Mutter
Salzburg 1909: Invariantentheorie im Stil Gordans / Über die Natur des Lichts
Wien 1913: Invariantentheorie im Sinne Hilberts / Zum Stand des Gravitationsproblems
Sommer 1915: Einstein endlich in Göttingen
Wer war 1915 in Göttingen bei Einstein?
„Das Erscheinen von Angehörigen eines mit uns im Kriege stehenden Staates“
„Das hat sich sogar der hiesige Geograph angehört“ – Emmy Noether vor der Göttinger Mathematischen Gesellschaft
2. Hilbert und Einstein, und ja, auch Emmy Noether
„In Göttingen hatte ich die große Freude, alles bis ins Einzelne verstanden zu sehen.“
„Besonders die Vorträge Einsteins über Gravitationstheorie waren ein Ereigniss.“348
„Es Lässt sich nämlich die allgemeine Kovarianz erzwingen.“401
Mitten im relativistischen Getümmel: 420 Emmy Noether
„Nur ein Kollege hat sie wirklich verstanden.“
Nostrifizierung (fast) überall
Hilbert vollendet die erste und versucht sich an der zweiten Mitteilung
„Ich habe Frl. Nöther diese Frage schon übergeben.“547
„Die Invariantentheorie wird von Fräulein Dr. Noether behandelt werden.“570
Das Kausalitätsprinzip in der Physik
Einstein kritisiert noch einmal Hilbert
Hilbert macht sich auf zu neuen Ufern
3. Emmy Noether und Felix Klein
„Überhaupt Besprechung heute 6 Uhr“ – Anfänge der gemeinsamen Arbeit von Felix Klein und Emmy Noether
Felix Kleins „Vorläufiger Einstein“
Emmy Noethers Differentialinvarianten – ein erster Entwurf
„Das allgemeine Problem, welches ich an die Spitze meines Erlanger Programms gestellt habe, auch auf Mechanik und mathematische Physik ausdehnen“751
„Nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Gärungsprozess der modernen Physik.“765
„Für Frl. Noether: Nun wieder reine Mathematik, von Menschenwerk befreit.“792
„Wie erreiche ich Frl. Noether?“
Der Laskersche Zerlegungssatz – eine Auszeit von der Relativitätstheorie
„Sie Müssen sich Riemann’s Werke als Bibel anschaffen“879
„Über das Riemannsche Krümmungsmaß und Verwandtes“
„Es imponiert mir, dass man diese Dinge von so allgemeinem Standpunkt übersehen kann“
„Es bleibt dabei Skrupel betreffend die sogenannten Erhaltungssätze.“
„Ich will das jetzt ausarbeiten; ganz schnell geht das aber nicht!“991 – Emmy Noether auf dem Weg zu ihren Invarianten Variationsproblemen
Das „Ei des Kolumbus“ – Klein und Runge auf Irrwegen
„Dieser Weg ist nicht gangbar…“1014 – Einstein weiß, was faul ist am „Ei des Kolumbus“
Sommer 1918: Der Energiesatz in der allgemeinen Relativitätstheorie1030
Die Göttinger Antwort auf Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie kam Ende Juli 19181071
„Beim Empfang der neuen Arbeit von Frl. Noether…“1094
4. Die Noether-Theoreme: Bedeutung und Wirkung
Emmy Noethers Invariante Variationsprobleme
Die Noether-Theoreme in der Physik
Von Fußnoten und Danksagungen über Völliges Ignorieren zu respektvoller Aneignung – aus der Rezeptionsgeschichte der Noether-Theoreme
„Nicht schlecht für eine Mathematikerin“1220 – anhaltende Bewunderung auch außerhalb der mathematischen und physikalischen Welt
Anhang
Anhang 1: Veröffentlichungen Emmy Noethers bis 1919
Anhang 2: Emmy Noethers Vorträge vor der Göttinger Mathematischen Gesellschaft bis 1918
Anhang 3: Emmy Noethers Göttinger Lehrveranstaltungen vom Sommersemester 1916 bis zum Wintersemester 1917/18
Anhang 3: Emmy Noethers Göttinger Lehrveranstaltungen vom Sommersemester 1918 bis zum Sommersemester 1919
Abkürzungsverzeichnis
Literatur- und Quellenverzeichnis
Verzeichnis der Literatur und gedruckten Quellen
Verzeichnis der ungedruckten Quellen
Personenregister
Vorankündigungen
Die Lebens- und Familiengeschichte der Mathematikerin Emmy Noether in Einzelaspekten
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Danksagung
Vorankündigungen
Die Lebens- und Familiengeschichte der Mathematikerin Emmy Noether in Einzelaspekten
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
Emmy Noether, Invariante Variationsprobleme, in: Nachrichten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse (1918), S. 235-257, hier S. 235
Vorwort
Die Autorin legt mit diesem dritten Band ihres weit ausgreifenden Emmy-Noether-Projekts die bisher fehlende inhaltliche Füllung zu den in den bereits erschienenen Bänden 1 und 2 beschriebenen formalen und institutionellen Aspekten von Emmy Noethers Habilitation vor. Einfacher ausgedrückt: Dieser dritte Band der Emmy Noether Biografie wird davon handeln, womit sich Emmy Noether, nachdem sie der Einladung David Hilberts und Felix Kleins folgend Ende April 1915 nach Göttingen gekommen war, wissenschaftlich auseinandersetzte – eine Auseinandersetzung, die in ihrer 1918 erschienenen Habilitationsarbeit ihren krönenden Abschluss fand.
Unter dem schlichten Titel Invariante Variationsprobleme (Noether 26. Juli/ September1918) entwickelte sie darin ein Theorem, das nach Meinung des Wissenschaftshistorikers Ernst Peter Fischer eine der „schönsten Verbindungen sichtbar“ mache, die „zwischen der wahrnehmbaren Welt und ihrer wissenschaftlichen Beschreibung besteht.“ (Ernst Peter Fischer 2002, S. 136). Zwar hat Emmy Noether die Anwendung ihrer beiden Theoreme auf die Physik (es waren anders als häufig rezipiert zwei Theoreme und nicht nur eins) ein Stück weit bereits selbst vorgenommen. Doch war sie Mathematikerin und keine Physikerin. Daher müssen die in Noethers rein mathematischer Fassung relativ schwer verständlichen beiden Sätze zunächst einmal physikalisch übersetzt werden. Und in dieser physikalischen Übersetzung besagt dann das von Fischer so begeistert beschriebene erste Noether-Theorem, dass zu jeder kontinuierlichen Symmetrie eines physikalischen Systems eine Erhaltungsgröße existiert und umgekehrt. Emmy Noether stellte also einen Zusammenhang her zwischen der Symmetrie einer mathematischen Form und der Erhaltung einer physikalischen Größe. Oder anders gesagt: Sie legte klar, „dass die Invarianz eines Naturgesetzes mit der Konstanz einer Naturerscheinung einhergeht“ (Ernst Peter Fischer 2002, S. 142).
An einem Beispiel verdeutlicht, wieder in Fischers Worten:
Die schlichte Tatsache, daß das Ergebnis eines Experiments sich nicht ändert, wenn man seine Anfangszeit verschiebt, kann man auch so formulieren, daß die Gesetze der Physik invariant gegenüber einer Zeitverschiebung (Translation) sein müssen. Das Noether-Theorem sagt jetzt voraus, daß unter diesen Bedingungen eine physikalische Größe konstant sein muß und dies ist die Energie (Ernst Peter Fischer 2002, S. 143).
Oder noch einmal in anderen Worten: Aus der Homogenität der Zeit, der sogenannten Translationsinvarianz, folgt der Energieerhaltungssatz.
Die Beschreibung des mathematisch und physikalisch deutlich komplizierteren zweiten Noetherschen Theorems sei dem letzten Kapitel in dem folgenden Text vorbehalten; hier sei dazu nur angemerkt, dass Emmy Noether selbst als Beispiel für ihr zweites Theorem die „allgemeine Relativitätstheorie“ angab (Noether 26. Juli/September 1918, S. 239 f.). Damit ist sowohl verwiesen auf den Kontext der Arbeiten Noethers in Göttingen, die als Invariantenspezialistin sowohl Hilbert als auch Klein bei deren Beschäftigung mit der Einsteinschen Allgemeinen Relativitätstheorie unterstützte, als auch auf Emmy Noethers Beziehung zu Einstein selbst.
So wird denn das erste Kapitel auch vornehmlich dem zunächst noch zufälligen, wahrscheinlich nicht mit einem persönlichen Kennenlernen verbundenen Aufeinandertreffen von Einstein und Emmy Noether vor ihrer Göttinger Zeit gewidmet sein, einleitend aber auch auf den überraschenden Tod ihrer Mutter im Mai 1915 eingehen, der Emmy Noether nur zwei Wochen nach ihrer Ankunft in Göttingen wieder zurück nach Erlangen zwang. Rechtzeitig zurück zu Einsteins Vorlesungen über Gravitation, die auf Initiative Hilberts Ende Juni 1915 in Göttingen stattfanden, hielt Emmy Noether eine Woche nach Einstein ihren ersten Vortrag vor der Göttinger Mathematischen Gesellschaft, der als eine Art Eintrittsbillett in die Gemeinschaft der Göttinger Mathematiker und Physiker gelten kann. Da Emmy Noether den Sommer 1915 jedoch wieder in Erlangen verbrachte, wo sie sich um ihren kränkelnden Vater kümmerte, kann man mit Fug und Recht sagen, dass sie eigentlich erst Anfang November 1915 richtig in Göttingen ankam, wovon im Zweiten Kapitel die Rede sein wird.
Zunächst geht es in diesem Kapitel allerdings um die Beziehung zwischen David Hilbert und Albert Einstein. Denn Hilbert hatte sich nach Einsteins Besuch in Göttingen das ehrgeizige Ziel gesetzt, Einsteins Theorie in einen größeren feldtheoretischen Rahmen einzubetten, in dem er Gravitation und Elektromagnetismus miteinander verbinden wollte. Währenddessen mühte sich Einstein, inzwischen überzeugt, dass seine 1913 entwickelten und noch in Göttingen vorgetragenen Gravitationsfeldgleichungen fehlerhaft seien, diese Fehler zu beseitigen. Beide Forscher, die sich gegenseitig über ihre jeweiligen Fortschritte mal mehr mal weniger ausführlich informierten, erreichten Ende November 1915 (vorgeblich) das jeweils selbstgesteckte Ziel. Weil Hilbert seine Ergebnisse fünf Tage vor Einstein der Öffentlichkeit präsentierte und Einstein zumindest anfänglich darüber verärgert zu sein schien, hat es sich eingebürgert, von einem Wettstreit zwischen Hilbert und Einstein um die Aufstellung der richtigen Gravitationsgleichungen zu sprechen, der gelegentlich sogar zu einem Prioritätsstreit hochstilisiert wurde (Earman und Glymour 1978, Corry, Renn und Stachel 1997, Renn und Stachel 2007). Befeuert wurde diese Sichtweise durch Hilberts vollmundige Ankündigung in seiner am 20. November 1915 der Göttinger Gesellschaft vorgelegten Ersten Mitteilung, dass er „im Folgenden – im Sinne der axiomatischen Methode – wesentlich aus drei [später geändert in „zwei“] einfachen Axiomen ein neues System von Grundgleichungen der Physik aufstellen“ werde, „die von idealer Schönheit sind“ und durch die „unsere Vorstellungen über Raum, Zeit und Bewegung von Grund auf in dem von Einstein dargelegten Sinne umgestaltet“ werden (Hilbert, Fahnenkorrektur, und Ders. 20.11.1915/31.3.1916, S. 395 und S. 407). Hilbert verstellte so selbst den Blick darauf, dass er nicht nur einen ganz anderen Ansatz verfolgte als Einstein, sondern auch ein völlig anderes Ziel hatte. Subjektiv mag es sich daher streckenweise durchaus um einen Wettstreit oder auch Konkurrenzkampf zwischen Hilbert und Einstein gehandelt haben, objektiv war es dies aus den genannten Gründen nicht (Sauer 1999, S. 566; Rowe 1999, S. 201, und 2004, S. 103 f.; Corry 2004, S. 421; Sauer 2005). Darauf hat mit guten Gründen schon Felix Klein in einer in seinen Gesammelten Werken eingefügten Fußnote zu seinem im Januar 1918 veröffentlichten Kommentar zu Hilberts Erster Mitteilung (Klein 25.1.1918) hingewiesen:
Von einer Prioritätsfrage kann dabei keine Rede sein, weil beide Autoren ganz verschiedene Gedankengänge verfolgen (und zwar so, daß die Verträglichkeit der Resultate zunächst nicht einmal sicher schien). Einstein geht induktiv vor und denkt gleich an beliebige materielle Systeme. Hilbert deduziert […] aus voraufgestellten obersten Variationsprinzipien. (Klein 1921, S. 566).
In das Göttinger „relativistische Getümmel“ (Rowe 1999, S. 210), das im November 1915 seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte, war auch Emmy Noether eingebunden, zunächst als Zuträgerin für Hilbert, später als das „Getümmel“ sich etwas gelegt und in ein ruhigeres Fahrwasser gemündet war, in enger Zusammenarbeit mit Felix Klein, wovon in Kapitel 3 die Rede sein wird. Erst aus dieser Zusammenarbeit mit Klein entstanden dann die heute sogenannten berühmten Noether-Theoreme, wobei sich auch in Hilberts Grundlagen schon ein Spezialfall von Noethers späterem zweiten Theorem findet, allerdings – anders als bei Emmy Noether – ohne Beweis (Corry 1999, S. 520).
An dieser Stelle ist es wichtig, wie auch schon im Vorwort zu Band 1 (Tollmien 1/2021, S. 9 f.) noch einmal hervorzuheben, dass es sich bei dem hier vorgelegten Emmy-Noether-Projekt nicht um eine Wissenschaftsgeschichte im engeren Sinne handelt, sondern um eine Biografie. Allerdings spielt die Wissenschaft oder besser die wissenschaftliche Entwicklung, die schließlich zu den Noether-Theoremen führte, in dem hier vorliegenden Band naturgemäß eine prominentere Rolle als in den beiden bereits vorliegenden Bänden, so dass auf eine kurze Erläuterung zu den grundlegenden mathematischen Begriffen und gegebenenfalls auch auf deren historischen Kontext nicht ganz verzichtet werden kann. Aber der Fokus liegt auch hier auf dem Biografischen, diesmal jedoch nicht nur auf Emmy Noether, sondern stärker als zuvor auch auf den sie begleitenden Protagonisten wie Hilbert, Klein und natürlich Einstein. Denn ohne beispielsweise die Wege und Umwege, die insbesondere Einstein auf seinem Weg zur Allgemeinen Relativitätstheorie ging, ist weder verständlich, was Hilbert bewog, sich in direkter Folge und zugleich Abgrenzung davon mit Einsteins Ideen zu befassen, noch was später – wiederum in Auseinandersetzung mit Einstein als auch mit Hilbert – Kleins Motivation war, sich ebenfalls in das „relativistische Getümmel“ zu stürzen und sich der noch ungeklärten Frage nach der Geltung von Energieerhaltungssätzen in der Allgemeinen Relativitätstheorie zu widmen. Der unterschiedlichen Dichte in der Quellenüberlieferung ist es geschuldet, dass in dem vorliegenden Band streckenweise mehr von Einstein, Hilbert und Klein die Rede zu sein scheint als von Emmy Noether. Doch wie in der gesamten von mir geplanten Biografiereihe kann man sich ihr aufgrund der nur sehr spärlichen Überlieferung zu ihrer Person häufig nur über andere Menschen nähern und sie so über das Umfeld, in dem sie sich bewegte, um- oder einkreisen.
Anders als beispielsweise Hilbert hatte Emmy Noether kein genuin physikalisches Interesse, und auch die Übertragung des sogenannten Erlanger Programms auf die Allgemeine Relativitätstheorie, die Klein bewegte, stand nicht im Zentrum ihrer gemeinsam mit ihrem Erlanger Freund und Lehrer Ernst Fischer entwickelten Fragestellungen (siehe dazu den geplanten Band 4 dieser Emmy Noether Biografie). Sowohl David Hilbert als auch Felix Klein, das kann man wohl ohne Übertreibung sagen, spannten Emmy Noether also für ihre Ziele ein, streckenweise könnte man vielleicht sogar von be- oder ausnutzen sprechen. Dennoch hat sie sich in die Ausein-andersetzungen um die ihr von Hilbert und Klein vorgegebenen Fragen mit der gleichen Verve, Ausdauer und Kreativität gestürzt, mit der sie auch ihre späteren, von ihr selbst bestimmten und entwickelten Fragestellungen behandelte. Wir verdanken Emmy Noethers Engagement in dieser für sie persönlich eher abseitigen Fragestellung eine mathematische Lösung der insbesondere von Klein verfolgten Frage nach den Energieerhaltungssätzen, die sie durch eine zwar nicht ganz neue, von ihr aber über die bisher vorgenommenen Anwendungen hinaus grundlegend verallgemeinerte Kombination von Invariantentheorie, Variationsrechnung und Gruppentheorie beantwortete, was Thema des ersten Abschnitts von Kapitel 4 sein wird. In physikalischer Übersetzung (Abschnitt 2 von Kapitel 4) ergibt sich daraus die erwähnte Verbindung zwischen Symmetrie und Erhaltungssätzen, die von so großer Schönheit ist, dass amerikanische Physiker deren Bedeutung überschwänglich übertreibend mit dem Satz des Pythagoras verglichen (Lederman und Hill 2004, S. 21). Obwohl sich Emmy Noether in ihrem späteren wissenschaftlichen Leben mit vergleichbaren Fragen nicht mehr beschäftigte, ist sie inzwischen für diese ihre erste große Göttinger Veröffentlichung – zumindest in der nicht-mathematischen Welt – bekannter als für ihre spätere wegweisende, epochale Gestaltung der modernen Algebra.
Wichtig ist daher auch die Rezeptionsgeschichte der Noether-Theoreme in den Blick zu nehmen, die zunächst einmal wenig Aufmerksamkeit fanden. Dafür waren zum einen ihre Kollegen und Mitstreiter verantwortlich, die sich wie Hilbert, Klein und Einstein zwar während der Zusammenarbeit auf sie bezogen und ihre Verdienste zumindest in Nebenbemerkungen oder Fußnoten auch öffentlich machten (Klein 25.1.1918, S. 476 und S. 477, Hilbert 1924, S. 6 Anm. 6), in ihren späteren Publikationen Emmy Noether aber entweder ganz unterschlugen oder sich darauf beschränkten, ihre Arbeit im Literaturverzeichnis zu erwähnen. Es begann schon damit, dass Hilbert Noether in seinen Veröffentlichungen über Die Grundlagen der Physik 1915 und 1916/17 gar nicht erwähnte und sich Klein in seiner im Juli 1918 veröffentlichten Arbeit über die Erhaltung von Impuls und Energie in der Einsteinschen Gravitationstheorie zwar bei ihr bedankte (Klein 19.7.1918, S. 171), sie aber nach heutigem Verständnis eigentlich als Koautorin hätte nennen müssen.
Zum anderen aber wurden – und das ist ein weiterer Grund für die lange Nichtbeachtung von Emmy Noethers intellektueller Meisterleistung, die sie mit den Noether-Theoremen vollbracht hatte – Symmetrien in der Physik erst in den 1950er Jahren populär, und auch damals gab es nur wenige Physiker, die Noethers Originalartikel lasen und verstanden. Noch 1968 schrieb der ungarisch-amerikanische Physiker Eugene Wigner an Noethers Biographen Clark Kimberling, dass die Hochachtung, die die Physiker Emmy Noether zollten, nur ein Lippenbekenntnis sei und die meisten seiner Kollegen ihre Arbeit nicht wirklich gelesen hätten (nach Kosmann-Schwarzbach 2011, S. 82).
Die französische Mathematikerin Yvette Kosmann-Schwarzbach hat 2006 (englische Übersetzung 2011) eine detaillierte Darstellung der Rezeptionsgeschichte der Noether-Theoreme vorgelegt, die kaum Fragen offenlässt. Auf diese Veröffentlichung kann daher verwiesen und, nachdem die Theoreme in Noethers Invarianten Variationsproblemen in die Physik übersetzt worden sind, die Darstellung der Nachwirkungen dieser Arbeit vergleichsweise kurz gehalten und auf ein paar herausragende Streiflichter beschränkt werden, zumal der Schwerpunkt dieses Bandes auf der Entstehungsgeschichte der Noether-Theoreme und nicht auf deren von Emmy Noether weitgehend unabhängigen Wirkungsgeschichte liegt.
Zu Emmy Noethers heute weltberühmten Theoremen, zu Hilberts und Kleins Beschäftigung mit der Allgemeinen Relativitätstheorie und zu Einsteins Wegen und Irrwegen bei der Aufstellung Gravitationsgleichungen existiert inzwischen eine so reichhaltige Literatur, dass es schwer ist, den Überblick zu behalten. Ich habe deshalb davon abgesehen, auch nur annähernd, und sei es auch nur auf der Verweisebene, irgendeine Form von Vollständigkeit zu erreichen zu versuchen. Doch seien hier stellvertretend die Arbeiten von Leo Corry, Michel Janssen, Jürgen Renn, David Rowe und Tilman Sauer genannt, die ich so weit wie möglich gelesen und so genau wie möglich studiert habe. Ohne die Publikationen dieser Autoren wäre die hier vorgelegte Buchveröffentlichung nicht möglich gewesen. Besonders hervorgehoben sei in diesem Zusammenhang der bisher leider noch nicht veröffentlichte Aufsatz Tilman Sauers mit dem schönen Titel „Wir haben, ehe alles ganz klar war, uns verschiedentlich gestritten.“ – Emmy Noether, David Hilbert und Felix Klein, dem ich wertvolle Anregungen verdanke. Ohne die diesem Aufsatz zugrundeliegende mir von Tilman Sauer zugänglich gemachte Quellensammlung, anhand derer sich verschiedenen Etappen der Zusammenarbeit zwischen Emmy Noether und Felix Klein in bisher nicht erreichter Genauigkeit nachzeichnen lassen, hätte ich die Entstehung der Noether-Theoreme nicht so genau schildern können, wie dies jetzt in diesem Buch möglich wurde. Ebenfalls wichtig war für mich Arianna Borellis gleichfalls noch nicht veröffentlichte Publikation Vom mathematischen Satz zum physikalischen Prinzip, in der sie am Beispiel der Quantenphysik die Bedeutung des ersten Noether-Theorems in der Physikgeschichte darlegt, die mir das Verständnis davon, wie aus der abstrakten Mathematik der Noether-Theoreme ein empirisches Prinzip der Physik werden konnte, wesentlich erleichtert hat.