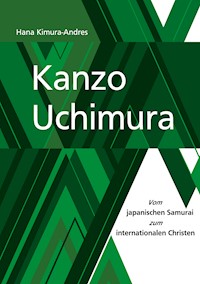
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Kanzo Uchimura, ein Samurai-Sohn, geht einen spannenden Lebensweg. Aus nichtchristlicher Umgebung heraus wird er Christ ohne den dogmatischen oder traditionsreichen `Überbau einer westlichen Kirche. Dadurch wird das das Wesentliche am Christentum klar und verständlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Keine Nachahmung
Vorwort
Uchimura-Zitate
Umschrift nach der Hepburn-Methode
Über die Verfasserin
Dankeswort
Einleitung
Inselbewohner
Der Konflikt
Christentum und viele Kirchen
Christentum und das Wort Gottes
Erster Schritt ins Christentum
Samurai-Herkunft
Neue Erziehungsziele
Sternstunde eines Lehrers
„Boys, be ambitious!“
Studentenmissionare
Vorurteil
Eine schreckliche Lage
Der praktische Gewinn des neuen Glaubens
Ein unvergesslicher Tag
Studentengemeinde
Eine demokratische Versammlung
Christentum in Theorie und Praxis
Weihnachtsfeier
Tischgebet
Selbstvertrauen der Studentenkirche
Mission in der Familie
Paulus, ein Diener Jesu Christi
Eine unabhängige Kirche
Schwierigkeiten beim Bau einer Kirche
Unabhängigkeit
Abschluss des Hochschulstudiums
Ein einzigartiges Haus
Die Verfassung der neuen Kirche
Ein 100-Dollar-Scheck
Frohe Weihnachten
Hiobsbotschaft
Ein christlicher Weg
Unbeschreibliche Freude
Modernes Christentum
Leere im Herzen
Christ im Beruf
Standfestigkeit
Leere im Herzen
Einsam unter Freunden
Gefühlschristentum
Gescheiterte Ehe
In der Christenheit
Radikaler Wechsel
Naive Gedanken
Mammon
Betrogene Hoffnung
Mit anderen Augen
In der Heilanstalt
Eindrucksvolle Persönlichkeiten
Ein liebenswerter Freund
Im Nebel
Bücherfreunde
Verwirrende Gedanken
Mehr Licht!
Ortswechsel
Die Entscheidung
Konfuzius und Jesus
Änderung der Blickrichtung
Die Begegnung
Kleine Widrigkeiten
Eine Feuerprobe
Perlen des Hochschulstudiums
Die neue Blickrichtung
Vom Sinai nach Golgatha, von Sapporo nach Amherst
Zwei „J“
Theologiestudium
Die Heimkehr
Eindrücke von der Christenheit
Ein besonderes Privileg
Christentum ohne Überbau
Christentum und andere Religionen
Christenheit und Dunkel
Christenheit und Licht
Christliche Mission
Verlangen nach Predigern des Evangeliums
Ausbildung als Lehrer
Misserfolg und Krankheit
Kurze Ehe
Elite-Oberschule
„Majestätsbeleidigung“
Allein, aber nicht allein
Ich vertraue auf Jesus
Ausbildung als Schriftsteller
Wanderjahre
Trost für einen Christen
Blickpunkt Japan
Redakteur
Ein neues Jahrhundert
Enges Christentum
Bibelstudien
Erst „Was“, dann „Wie“
Bibelstudienzeitschrift
Bibelstudienversammlungen
Der Anfang
Sonntagsversammlung
Versammlungsstil
Freundesversammlungen
Aufbauen und auflösen
Lehrer-Schüler-System
Ausbildung selbstständiger Lehrer
Das Ende von Uchimuras Bibelstudienversammlung
Die Fortsetzung
Eine
Kirche
Christ und Christentum
Uchimuras schriftliches Werk
Christ und Christus
Erfahrung der Bekehrung
Christentum ist Christus
Christentum ist das Evangelium vom Kreuz
Christentum ist Christus, nicht Kirche
Christentum ist Liebe, nicht Gesetz
Christentum ist Geist, nicht Form
Die Sakramente
Christentum in Ost und West
Christentum von Ost nach West
Christentum von West nach Ost
Echte Missionare
Ein japanischer Missionar
Das Christentum der Zukunft
Der Name „Mukyokai“
Mukyokai als Alternative
Mukyokai oder Kirche?
Mukyokai gegen die Kirche
Mukyokai. Japanisches Christentum?
Das Ideal der Selbstständigkeit
Fortsetzung der Evangeliumsgeschichte
Ich ... für Gott
Das Christentum der Zukunft
Anhang
Zeit-Tabelle
Weiterführende Literatur
Christ sein
• Keine Nachahmung
Ich ahme nicht Augustinus nach, auch nicht Luther oder Knox, Wesley oder Carlyle, auch nicht Moody oder sonst irgendeinen Mann der Vergangenheit oder Gegenwart. Ich bin ich selbst.
Gott hat mich zu einem besonderen Zweck geschaffen, er hat mich an einen besonderen Platz gestellt und zu einem besonderen Werk berufen. Er führt mich auf besonderen Wegen, weil ich sein besonderes Werkzeug bin.
Diejenigen, die mich mit diesem oder jenem Mann in Europa oder Amerika vergleichen, stellen mich falsch dar und verkennen Gottes Plan für mich.
Gott schafft nicht zwei gleiche Menschen und jeder Mensch ist das besondere Werk seiner Hände. Weil ich also eine besondere Schöpfung Gottes bin und von meinem Gott besonders geführt werde, bin ich frei und unabhängig.
Ich schaue auf ihn, um Tag für Tag seine besondere Führung zu erfahren, und vertraue auf die Hände, die mich meinen besonderen Weg führen.
Ich bin allein, aber nicht allein, weil Gott in seiner Gnade mit mir geht.
Kanzo Uchimura
Zitat aus „Pfeil-Worte Arrow Words“, S. 23
Vorwort
Uchimura-Zitate
Sie liegen ganz falsch, wenn Sie denken, der japanische Christ Kanzo Uchimura (Aussprache: Kansoh Utschimura) ist nichts für Sie, wenn Sie nicht gerade Japan-Fan oder Missionswissenschaftler sind.
Lesen Sie einmal, was er Ihnen für Ihr Leben zu sagen hat, in diesem Buch kommt er selbst zu Wort. Zuerst wird in Auszügen, mit neuer Gliederung und mit erklärenden Überleitungen, sein Buch „Wie ich ein Christ wurde. Aus meinem Tagebuch“ vorgestellt. Er erzählt mit spannenden Szenen aus seinem Leben, wie er zum christlichen Glauben kam. Dann werden seine Wirkungsgeschichte und die Hauptgedanken aus seinen späteren Schriften zusammengefasst.
Uchimura-Zitate und Uchimura-Buchtitel werden in diesem Buch durch einen Wechsel der Schrift deutlich gemacht. Zum Beispiel:
1. März 1886. - Wenn Gott uns etwas schenkt, dann ist es ... etwas wirklich Wesenhaftes, das durch die Stürme der Welt nicht erschüttert werden kann. (Tagebuch)
Das Eine fesselte meine Aufmerksamkeit und nahm meine ganze Seele in Besitz. Ich dachte Tag und Nacht daran. Sogar wenn ich die Kohleneimer aus dem Keller hinauf zu meinem Zimmer im obersten Stock trug, ... (Kommentar)
„Trost für einen Christen“ (Buchtitel)
Wenn in diesem Buch allgemein von „Kirche“ gesprochen wird, dann als Sammelbegriff, der sowohl die katholische Kirche als auch die verschiedenen protestantischen Kirchen einschließt.
Bei Personennamen werden – nach deutschem Sprachgebrauch – im Text zuerst Vorname, dann Familienname genannt.
Umschrift nach der Hepburn-Methode
Die Umschrift der japanischen Namen in lateinische Schrift erfolgt nach der Hepburn-Methode. Hier ein paar Beispiele. Die deutsche Aussprache und eine kurze Erklärung des Wortes werden in Klammern beigefügt.
Über die Verfasserin
Beim Theologiestudium hat die Verfasserin ihren japanischen Mann kennen gelernt. Er hat ihr nichts von dem japanischen Christen Kanzo Uchimura erzählt. „Sie soll selbst lesen und dann wird sie verstehen.“, dachte er. Und so war es auch. Heute sagt sie von sich: „Ich liebe meine Heimatkirche und Kanzo Uchimura.“
Dankeswort
Ohne die Hilfe meines Mannes, Naofumi Kimura, hätte dieses Buch niemals geschrieben und herausgegeben werden können. Alles ist Gnade.
Einleitung
„Christ werden? Nein, niemals!“, denkt er. Er, das ist ein Japaner mit dem Namen . Er schreibt seinen Namen in lateinischen Buchstaben „Kanzo Uchimura“ (Aussprache: Kansoh Utschimura) und so wird er international bekannt.
Uchimuras Samurai-Großvater war noch stolz auf seine mit Fasanenfedern besetzten Pfeile. Der Enkel kämpft nicht mehr mit solchen Waffen, sondern will mit modernem Wissen mithelfen, sein Land in eine neue Zeit zu führen. Auf diesem Weg begegnet er als Student dem Christentum.
Inselbewohner
Bis zu Uchimuras Zeit war Japan ein isolierter Inselstaat gewesen und das Christentum war seit rund 200 Jahren verboten.
Um die Mitte des 16. Jahrhunderts (15.8.1549) hatte der Jesuit Francisco de Xavier (7.4.1506 – 3.12.1552) von der südjapanischen Hafenstadt Kagoshima aus die Japan-Mission begonnen. Am Anfang hatten sie Erfolg, er und die anderen Missionare. Aber mit ihnen waren noch andere Ausländer gekommen, die Handel treiben und Einfluss gewinnen wollten – und gefährliche Feuerwaffen mitbrachten. In Japan kämpften damals Landesfürsten und ihre Feldherrn um die Macht und die Erweiterung ihres Herrschaftsgebietes.
Gehen wir gleich zum Ergebnis dieser Jahre. Die Tokugawa-Regierung gewann schließlich die Oberhand (1603) und sah in den Fremden keinen Nutzen zur Festigung der eigenen Herrschaft. Ganz im Gegenteil. Deshalb wurden Missionare und alle anderen Ausländer des Landes verwiesen, niemand durfte mehr von außen ins Land hinein, niemand mehr von innen hinaus.
Aber damit war das Problem, das die fremden Eindringlinge geschaffen hatten, noch nicht ganz gelöst.
Die japanischen Christen mussten im Land selbst ausgerottet werden, wenn sie nicht ihren neuen Glauben aufgeben wollten – und das wollten viele nicht. Christenverfolgung wurde nun mit System betrieben, mit Kontrolle, Hinrichtungen und Märtyrern. Manche Christen gingen in den Untergrund und noch 200 Jahre lang lebte unter den „verborgenen Christen“ der Einfluss der ersten Missionare weiter.
Aber dann, wenige Jahre vor Uchimuras Geburt, tauchten Schiffe vor der Küste Japans auf, wie man sie von dieser Insel aus noch nie gesehen hatte, schwarz und Rauch dampfend, bewundernswert und bedrohlich. Amerika forderte die Öffnung des Landes (1853).
Der Konflikt
Auf kulturellem Gebiet hatte Japan in seiner Geschichte vieles von seinen asiatischen Nachbarn übernommen, aber war nie in die Sklaverei eines anderen Volkes geraten und war durch seine Politik der Abschottung auch der Kolonialisierung durch westliche Länder entgangen. So konnte eine eigene Kultur und Ethik entwickelt und ein ungebrochener Nationalstolz bewahrt werden. Es waren also die geistigen Voraussetzungen und die innere Kraft vorhanden, sich der von außen kommenden Herausforderung zu stellen.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der Westen industriell, militärisch und wirtschaftlich Japan überlegen. Es gab nur eine Möglichkeit, nicht unter fremde Herrschaft zu geraten: Japan musste denselben Entwicklungsstand erreichen wie die westlichen Länder.
Damit war aber auch ein Konflikt zwischen Ost und West schon vorprogrammiert: Auf der einen Seite erstarkte der Nationalismus, wie immer in wirtschaftlich oder politisch schwierigen Zeiten; auf der anderen Seite lockte neues Wissen.
Aber dieses Wissen hatten Ausländer und zu ihnen gehörte eine fremde Kultur und eine – so dachte man allgemein – rein westliche Religion.
Es galt nun, die eigene Identität zu bewahren und gleichzeitig neues Wissen aufzunehmen und an der Spitze der Zeit zu stehen, als Politiker, als Unternehmer, als Wissenschaftler – und Uchimura als Christ.
Christentum und viele Kirchen
Für Uchimura und seine Generation gab es keine christliche Tradition in Japan, nur überlieferte Vorbehalte gegen diese Religion, die einst aus dem Westen gekommen und schnell wieder vertrieben worden war.
Trotz dieser negativen Vorbedingungen kamen schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also bald nach Öffnung des Landes, wieder Missionare nach Japan. Die katholischen Missionare des 16. Jahrhunderts waren Mitglieder verschiedener Orden und genauso waren die protestantischen Missionare des 19. Jahrhunderts nicht nur Christen, sondern sie waren von verschiedenen Missionsgesellschaften geschickt worden und gehörten verschiedenen Kirchen an, d.h. sie brachten zusammen mit der Bibel auch die Traditionen und Dogmen der eigenen Kirche mit und auch die Streitigkeiten der Kirchen untereinander.
Zuerst war man um die Einheit und Selbstständigkeit der Christen in Japan bemüht (Konferenz von Yokohama, 20. – 25.9.1872), aber die Spaltung der japanischen Christen in verschiedene Kirchen mit unterschiedlichen Dogmen und auch die finanzielle Abhängigkeit von ausländischen Kirchen waren nicht aufzuhalten. Warum muss das so sein, fragt sich Uchimura schon als Student.
• Christentum und das Wort Gottes
Christentum ist der Name für die mit nicht christlichen Elementen durchsetzte und verwestlichte Form des Messias-Glaubens, wie er von Jesus und seinen Schülern gepredigt wurde.
Es ist nicht der echte Christus-Glaube, sondern eine europäische oder amerikanische Version davon; das ist sein ganzer Wert und mehr auch nicht. Deshalb sind wir nicht daran gebunden, denn dieses Christentum ist nicht verbindlicher als irgendwelche anderen Ideen westlichen Ursprungs.
Ihr sogenanntes Christentum ändert sich ständig. Was ihre Missionare uns vor 50 Jahren gelehrt haben, wird von den nachfolgenden Missionaren mit Nachdruck verworfen.
Aber das Wort Gottes ist ganz anders. Es ist dasselbe gestern, heute und für immer. Keine Philosophie oder Wissenschaft kann es ändern; es erlaubt keine „modernen Ideen“; Bischöfe und Doktoren der Theologie sind Gottes Wort gegenüber machtlos.
Wir folgen dem Wort Gottes in aller Demut. Aber mit dem sogenannten Christentum von Amerika und Europa verfahren wir je nachdem, wir nehmen es an oder auch nicht.
Kanzo Uchimura
Zitat aus „Pfeil-Worte Arrow Words“, S. 95
I Erster Schritt ins Christentum
Samurai-Herkunft
Uchimura stellt sich in seinem Buch „Wie ich ein Christ wurde“ so vor:
Ich bin am 23. März 1861 geboren. Meine Familie gehörte dem Samurai-Stand an. Ich war dazu bestimmt zu kämpfen – vivere est militare, leben heißt kämpfen – von der Wiege an.
Samurai! Da tauchen japanische Filmhelden aus vergangener Zeit, phantasievolle Helme tragend und mit Schwertern bewaffnet, womöglich Harakiri (Selbstmord durch Bauchaufschlitzen) machend, in unserer Phantasie auf.
Aber Samurai (ca. 5% der Bevölkerung) waren nicht wilde Stammeskrieger und entwickelten nicht nur kriegerische Fähigkeiten, sondern waren auch Gelehrte und Berater eines Shogun (Oberbefehlshaber) oder eines Daimyo (Fürsten) oder auch eines privaten Dienstherrn und stellten seit Beginn der Tokugawa-Regierung (1603), also seit Beginn der Feudalherrschaft und der zweihundert Jahre lang dauernden Abschließung des Landes, die militärische Schutzmacht.
Der Samurai-Stand hatte einen eigenen Sittenkodex, „Bushido“, „Weg des Kriegers“, der sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt und die Moral des ganzen Volkes mitgeprägt hat.
Uchimura stammt also aus einer dieser Samurai-Familien (Takasaki-Fürstentum). Er ist stolz auf seine Herkunft und seine Familie, stolz auf seinen Vater, der nicht nur wie der Großvater ein Krieger ist, sondern ein gebildeter Mann.
Mein Vater hatte eine höhere Bildung als der Großvater, konnte gute Gedichte schreiben und beherrschte die Kunst, Menschen zu führen. Daneben besaß er beachtliche militärische Fähigkeiten und konnte selbst ein äußerst zügelloses Regiment ganz wunderbar führen.
Uchimura ist als Samurai geboren und will als Samurai sterben. Zwar wird der Samurai-Stand gerade abgeschafft, als sein Leben beginnt (Meiji-Kaiser 1868 – 1912). Aber er will ja auch nicht so ein Samurai werden wie sein Großvater.
Mein Großvater väterlicherseits war durch und durch Soldat; er war am glücklichsten, wenn er sich in seiner schwerfälligen Rüstung zeigen konnte, bewaffnet mit einem Bambusbogen und mit Pfeilen, die mit Fasanenfedern besetzt waren, und mit seiner fünfzig Pfund schweren Flinte. Er beklagte, dass Frieden im Land war, und starb im Bedauern, nie Gelegenheit gehabt zu haben, seinen Beruf praktisch auszuüben.
Uchimura wird nicht mit solchen Pfeilen kämpfen, wie sie der Stolz des Großvaters waren, sondern mit Pfeil-Worten, die genau ins Ziel treffen und Wegweiser sind.
Leben heißt kämpfen, das war ihm in die Wiege gelegt. Aber Christentum gehört ganz bestimmt nicht zu seinem Erziehungsprogramm. Er lernt konfuzianische Lehren durch seinen Vater und seine Umgebung kennen. Dazu kommt buddhistisches und shintoistisches Gedankengut.
Mein Vater hatte Konfuzius gründlich studiert und konnte fast alle Stellen aus den Schriften und Worten dieses Weisen auswendig zitieren. Meine frühe Erziehung richtete sich natürlich nach diesen Grundsätzen und obwohl ich die ethischen und politischen Lehren der chinesischen Weisen nicht verstehen
konnte, so habe ich doch ihre grundsätzliche Geisteshaltung in mich aufgenommen. Loyalität gegenüber dem eigenen Feudalherrn, Treue zu den Eltern und Lehrern und Achtung ihnen gegenüber, das sind die zentralen Themen der chinesischen Ethik. Kindliche Ehrfurcht ist, so lehrte man, die Quelle aller Tugenden. Die Geschichte, wie ein Sohn dem unvernünftigen Wunsch seines alten Vaters nachkommt und mitten im Winterwald nach Bambussprossen suchen geht und sie tatsächlich wunderbarerweise unter dem Schnee findet, diese Geschichte kennt jedes Kind in Japan genauso wie die Kinder mit christlicher Erziehung die Geschichte von Joseph und seinen Brüdern kennen. Sogar gewalttätige und tyrannische Eltern muss man mit Sanftmut ertragen und dazu werden viele Beispiele aus alter Zeit erzählt.
So nahm die Loyalität gegenüber dem Feudalherrn bei der Jugend, besonders in Kriegszeiten, geradezu romantische Züge an. Das Leben soll einem nicht mehr wert sein als ein Staubkörnchen, wenn es gilt, dem Herrn in einer Notlage zu dienen. Es gibt keinen vornehmeren Ort, wo man sterben könnte, als vor dem Ross seines Herrn, und dreimal selig ist der, dessen Leichnam unter den Pferdehufen zertrampelt wurde.
Und nicht weniger Achtung soll der Jugendliche auch seinem Meister (seinem geistigen und moralischen Lehrer) entgegenbringen, der für ihn nicht einfach nur Schullehrer oder bezahlter Universitätsprofessor ist. Die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler ist vielmehr die eines Jüngers zu seinem Herrn, dem er sich mit Leib und Seele ganz anvertrauen darf und muss.
Der Feudalherr, der Vater und der Lehrer, das war für den Jugendlichen seine Dreieinigkeit. Keiner von den dreien war niedriger als der andere zu schätzen und die quälendste Frage war, wen er retten würde, wenn alle drei gleichzeitig am Ertrinken wären, er aber nur einen retten könnte.
Die Feinde des Herrn, des Vaters und des Lehrers waren auch seine eigenen Feinde, die er notfalls bis ans Ende der Welt zu verfolgen hat und von denen er Genugtuung fordern muss, Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Die östlichen Lehren schärfen den Gehorsam und die Achtung gegenüber Höhergestellten ein, aber es mangelt auch nicht an Vorschriften über den Umgang mit Gleichgestellten und Untergebenen.
Aufrichtige Freundschaft, harmonisch-friedliche Brüderschaft und Milde gegenüber Leuten von niedrigerem Stand und gegenüber Untergebenen werden mit Nachdruck gefordert.
Man berichtet oft über die Grausamkeit der Heiden gegenüber Frauen, aber das findet in unserem Sittenkodex keinen Anhalt und ganz übergangen wird dieses Problem auch nicht. Unsere idealen Mütter und Frauen und Schwestern sind fast so, wie man sich die besten christlichen Frauen vorstellt. Und da unsere Frauen ganz ohne den erhebenden Einfluss des Christentums sind, bewundere ich sie umso mehr, denn es gibt Frauen, die Hervorragendes leisten und einen ausgezeichneten Charakter haben.
Ich denke, viele, die sich selbst Christen nennen, haben auch nicht viel bessere Lehren als die, in denen ich erzogen wurde. Aber daneben gab es für mich doch auch eine Menge Minuspunkte und viel Aberglauben.
Der schwächste Punkt der chinesischen Sittenlehre ist die Sexualmoral. Sie schweigt zwar nicht ganz zur Tugend der Reinheit im Umgang miteinander, aber die Art, wie man für gewöhnlich mit der Verletzung des Keuschheitsgebotes umgeht und bewusst darüber hinwegsieht, hat eine allgemeine Gleichgültigkeit in dieser Frage zur Folge. Polygamie im strengen Sinn des Wortes kennt man bei uns hier im Osten nicht.
Aber wenn man sich Nebenfrauen hält, was ja aufs Gleiche hinausläuft, so wird das, wenn überhaupt, von unseren Sittenlehrern nur sehr milde getadelt. Mein Vater gab mir erhabene Lehren über Pflichterfüllung und hohe Ziele, und wenn er mich zu Studium und Fleiß ermahnte, so merkte ich, dass er dabei auch einen ansehnlichen Harem im Auge hatte. Ein großer Staatsmann und Gelehrter kann man wohl auch ohne streng-sittliche Grundsätze sein. Derselbe Mann kann in ernsten Stunden die Zügel im Staat ergreifen und in weniger ernsten Momenten ein unsauberes Leben genießen. Ausschweifende Sittenlosigkeit findet sich oft bei Leuten, die einen scharfen Verstand haben und im öffentlichen Leben geachtet sind.
Obwohl ich nicht blind bin für die Dunkelheit, die in anderen Ländern genauso groß ist wie bei uns, will ich doch gern zugeben, dass die chinesische Ethik in Fragen der gesellschaftlichen Sittlichkeit ganz unzureichend ist.
Aber wenn ich auf meine Vergangenheit zurückblicke, demütigt mich nichts mehr als die geistliche Finsternis, in der ich umhertappte. Ich war voller Aberglauben. So glaubte ich, und zwar ganz ehrlich, dass in jedem unserer unzähligen Tempel ein anderer Gott wohnt, der eifersüchtig über seinen Zuständigkeitsbereich wacht und bereit ist, jeden zu bestrafen, der sein Missfallen erregt. Der Gott, den ich am meisten verehrte und zu dem ich besonders betete, war der Gott der Gelehrsamkeit und der Schrift. Ihm widmete ich treu und mit dem gebührenden heiligen Ernst jeden fünfundzwanzigsten Tag des Monats und brachte ihm Opfer dar. Ich warf mich vor seinem Bild nieder und flehte ihn an, mir zu helfen, meine Handschrift zu verbessern und mein Gedächtnis zu stärken.
Es gibt einen Gott, der für den Reisanbau zuständig ist. Seine Boten, die er zu den Menschen schickt, sind weiße Füchse. Wir können ihn darum bitten, unser Haus vor Feuer und Dieben zu bewahren. Da mein Vater oft unterwegs gewesen ist und ich dann mit meiner Mutter allein war, bat ich den Reisgott immer und immer wieder, unser armes Haus vor den genannten Übeln zu bewahren.
Und dann gab es einen Gott, den ich mehr als alle anderen fürchtete. Sein Emblem war ein Rabe und er erforschte das Innerste des Herzens. Der Tempelwärter verteilte Blätter, auf denen Raben in düsteren Farben gemalt waren. Das alles sollte eine wundersame Wirkung haben. Wer gelogen hatte und so ein Blatt hinunterschluckte, würde augenblicklich einen starken Blutsturz bekommen. Ich rief manchmal meine Kameraden, wenn sie mir nicht glauben wollten, dazu auf, meine Wahrhaftigkeit zu testen, indem ich ihnen anbot, ein Stückchen von dem heiligen Blatt runterzuschlucken.
Ein anderer Gott besaß heilende Kräfte gegen Zahnschmerzen. Also wandte ich mich auch an ihn, weil ich sehr unter diesem schmerzvollen Übel litt. Er verlangte von seinen Verehrern das Versprechen, keine Birnen zu essen. Diese Früchte mochte er absolut nicht. Ich war natürlich sehr gern bereit, die auferlegte Entbehrung auf mich zu nehmen. Meine späteren Studien in Chemie und Toxikologie zeigten mir, dass dieses Verbot durchaus eine wissenschaftliche Grundlage hatte, denn der schädliche Einfluss von Traubenzucker auf kariöse Zähne ist hinreichend bekannt.
Aber nicht jeder heidnische Aberglaube hat so einen vernünftigen Hintergund. Ein Gott verbot mir, Eier zu essen, ein anderer verbot mir Bohnen. Und weil ich alle diese Gebote beachten wollte, kam es bald dahin, dass viele meiner kindlichen Lieblingsspeisen auf die Verbotsliste kamen. Bei so vielen Göttern kam es natürlich auch vor, dass die Forderungen des einen Gottes in Widerspruch zu den Forderungen eines anderen Gottes standen.
Wer sich da gewissenhaft und treu nach allen Geboten und Verboten richten wollte, konnte ganz schön in Not geraten, wenn er mehr als einen Gott zufriedenstellen wollte.
Weil ich es so vielen Göttern recht machen und sie beschwichtigen wollte, war ich natürlich ein unruhiges, ängstliches Kind. Ich dachte mir ein allgemein gültiges Gebet aus, das für jeden Gott passte. Natürlich fügte ich noch besondere Bitten hinzu, die speziell dem Gott galten, an dessen Tempel ich gerade vorüberging. Jeden Morgen, sobald ich mich gewaschen hatte, richtete ich ein gemeinschaftliches Gebet an jede der vier Gruppen von Göttern, die in den vier Himmelsrichtungen wohnen. Besondere Aufmerksamkeit schenkte ich der östlichen Gruppe, weil die Aufgehende Sonne der größte aller Götter war.
Wo mehrere Tempel dicht beieinander lagen, war es eine ganz schreckliche Mühe, das gleiche Gebet so oft zu wiederholen. Deshalb machte ich oft lieber einen Umweg durch Straßen, an denen weniger Heiligtümer standen, um mir die Mühe mit meinen Gebeten zu ersparen, ohne dabei Gewissensbisse haben zu müssen.
Die Zahl der Götter, zu denen ich beten musste, wuchs von Tag zu Tag, bis es für meine kleine Seele total unmöglich wurde, ihnen allen zu gefallen. Doch schließlich kam die Erlösung.
Eine streng religiöse Erziehung hatte Uchimura nie erfahren, weder in der Familie noch in der Schule, noch sonst irgendwo. Aber eine „religiöse Sensibilität“, wie Uchimura selbst sagt, fühlt er schon als Kind, kann sie jedoch auf keinen in seiner Familie und schon gar nicht auf seinen Vater zurückführen.
Mein Vater hat über heidnische Götter jeder Art gelästert. Einmal warf er eine falsche Münze in den Geldkasten eines buddhistischen Tempels und sagte spöttisch zu den Götzen, sie würden noch so eine Münze bekommen, wenn sie ihm helfen würden, einen Rechtsstreit zu gewinnen, in den er gerade verwickelt war.
Unvorstellbar, dass ich jemals so etwas getan hätte!
Uchimuras „religiöse Sensibilität“ wird zusammen mit seiner Gelehrsamkeit und literarischen Begabung eine gute, kraftvolle Kombination ergeben, wie man an seinem weiteren Weg sehen kann.
Neue Erziehungsziele
Mit Beginn der neuen Zeit in Japan, der Meiji-Zeit, wird die alte Feudalherrschaft von einem neuen Gesellschaftssystem abgelöst.
Ein neues Zeitalter braucht neue Berufe, braucht also auch neue Ausbildungswege. Jetzt werden nicht mehr Schwerter gebraucht, sondern modernes Wissen ist gefragt. Natürlich geht dieser Übergang nicht ohne Probleme vonstatten, aber die Spitzenleute der Gesellschaft erkennen die Notwendigkeiten ihrer Zeit und sind bereit, sich den neuen Anforderungen zu stellen. Man staunt, mit welcher Geschwindigkeit die Schule auf die modernen Notwendigkeiten für die Ausbildung zuerst der Elite, dann des ganzen Volkes umgestellt wird. Uchimuras Leben wird von dieser Strömung erfasst.
Die Samurai-Familien verlieren nun zwar ihren standesgemäßen Dienst, aber ihre Söhne sollen trotzdem standesgemäß leben, d.h. sie sollen Verantwortung und einmal eine höhere Stellung in der neuen Regierung oder eine andere leitende Position im Dienst fürs Vaterland übernehmen.
Ziel des neuen Erziehungsprogramms ist es, den Anschluss an die westlichen Staaten zu erreichen. Dazu müssen westliche Wissenschaften studiert werden, Geistes- und Naturwissenschaft, Technik, Medizin und auch Militärwesen. Englisch ist die wichtigste westliche Sprache und so wird Englisch Schulfach. Damit wird Uchimuras Lebensaufgabe vorbereitet.
In Takasaki hatte er schon eine Englisch-Schule besucht und noch vor dem Umzug der Familie nach Tokyo (1876) wird der zwölfjährige Uchimura auf eine private Englisch-Schule geschickt.
Mit 13 Jahren wechselt er über an die staatliche Schule für ausländische Sprachen in Tokyo. Hier sollen die Schüler darauf vorbereitet werden, an der einzigen Universität damals, der heutigen Tokyo-Universität, zu studieren.
Es sieht so aus, als ob Uchimura eine steile Karriere beginne. Seine Lebensaufgabe wird jedoch nicht ein höheres Amt sein, jedenfalls nicht das geplante höhere Amt im Staatsdienst. Der Englischunterricht gibt ihm den Schlüssel zu zeitgemäßem Wissen in die Hand, für ihn wird Englisch aber vor allem der Schlüssel zum Christentum sein.
Sternstunde eines Lehrers
Im Norden von Japan liegt die Insel Hokkaido, die zu Beginn der Meiji-Zeit noch wenig entwickelt ist. Fähige Männer werden für die Erschließung und Modernisierung dieses Landesteiles benötigt. Für ihre Ausbildung errichtet die Regierung in Tokyo eine eigene Schule (April 1872), die später direkt nach Sapporo, der Hauptstadt dieser Nordinsel, verlegt wird und sich zur heutigen Hokkaido-Universität weiterentwickelt.
Wenn Neues aufgebaut werden soll, dann fachgerecht, zeitgemäß und zukunftsorientiert, sagt sich die Regierung und sucht in Amerika nach Fachlehrern. Dr. William Smith Clark wird nach Japan gebeten. Er nimmt die Einladung an und wird dabei wohl auch von finanziellen Erwägungen geleitet, aber er wird Unbezahlbares für die Zukunft von Japan, und nicht nur von Japan, leisten. Er ist einer von den Lehrern, die zwar Spezialisten auf einem Gebiet sind (Clark: Geologie, Mineralogie, Botanik, Chemie), die aber ihren Schülern in Japan nicht nur westliches Fachwissen beibringen, sondern sie auch in die dazu gehörenden geistigen Grundlagen der westlichen Kultur einführen.
Clark (1826 – 1886) bringt beste Voraussetzungen mit, um als Fachlehrer in Hokkaido zu arbeiten. Zuerst hatte er in Amherst, Massachusetts, studiert (1844 – 1848), dann in Göttingen Mineralogie und Chemie, wo er auch promovierte (1850 – 1852). Als er den Lehrauftrag für Japan bekommt, ist er Direktor am neu gegründeten College für Landwirtschaft in Massachusetts.
Er lässt sich beurlauben und übernimmt eine leitende Position an der Landwirtschaftshochschule in Sapporo. Er schafft die Grundlage, auf der die jungen Studenten ihr Leben für die Zukunft Japans aufbauen können. Und er bereitet den Weg für Uchimuras Aufgabe vor. Das ist die Sternstunde seines Lebens.
Clark kommt am 29. Juni 1876 in Yokohama an und fährt von hier aus mit dem Schiff nach Hokkaido weiter. Auf diesem Schiff reisen auch zehn Studenten für die erste Klasse mit und auch der Regierungsbeauftragte für die Entwicklung Hokkaidos, Kiyotaka Kuroda.
Kuroda hat eine kleine, aber weltbewegende Bitte an Clark. Ob es während dieser Schiffsreise war – so die weitverbreitete, allgemeine Überlieferung – oder erst nach der Ankunft in Hokkaido, ist nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass der japanische Regierungsbeauftragte den amerikanischen Lehrer bittet, den Studenten nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch ihren Charakter zu bilden. Eine kluge Bitte. Wissen und Charakter müssen zusammen ausgebildet werden. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein, ist es aber nicht und schon gar nicht, wenn man in damaliger Zeit einen westlichen Ausländer um diese Erziehung bittet.
Clark hat eine unerwartete Antwort. Und diese Antwort wird unerwartet viel bewegen. Er sagt, dass er keine höhere Moral kennt als die des Christentums.
Nun kann Kuroda in damaliger Zeit natürlich kein Unterrichtsfach „Christliche Moral“ offiziell ins Ausbildungsprogramm aufnehmen. Aber er lässt Clark freie Hand bei der Erziehung. Und Clark geht gleich an die Arbeit.
Er hat ein Talent für knappe, einprägsame Worte und da die Schule Schulregeln braucht, gibt er statt langer Paragraphen zwei Worte an die Studenten als Regel aus: „Be Gentlemen!“.
Er wird auch konkret und bereitet eine Schrift gegen Rauchen, Alkoholkonsum und profanes Schwören vor, die von Studenten und Lehrern (mit ihm waren noch zwei weitere Lehrer aus Amerika gekommen) unterzeichnet werden soll. Die jungen Leute gehen diesen Weg weiter und einer der Schüler, Kazutaka Ito, wird im Januar 1925 zum Präsidenten der Temperance-Bewegung in Japan gewählt.
Für den jungen Uchimura fordern diese Gebote keine große Gedanken- oder Praxisumstellung.
Wenn ich in meiner Kindheit auch kein Heim hatte, wo am Sonntag guter Einfluss mein innerstes Herz erhöht hätte, so blieb ich doch verschont von der Liebe zum Geld und vom furchtbaren Fluch des Alkohols, der in manch anderem „...tum“ mehr zum Alltag gehört als im „Heidentum“.
An Regeln sollen sich nicht nur die Untergebenen halten, sondern an erster Stelle die Vorgesetzten, die als Vorbild vorgesetzt sind. Clark weiß das. Er hatte einige Dutzend Flaschen Wein mit nach Sapporo gebracht. Der Wein wird dann aber nicht getrunken, sondern weggeschüttet. Dieses kleine Beispiel zeigt, wie man durch die Erwartung, die in einen gesetzt wird, und durch moralische Verantwortung, die einem übertragen ist, selbst wächst.
Clark wird Missionar, weil er einen Kurzauftrag in der Geschichte des Evangeliums bekommen hat. Er stammt aus einer puritanischen Familie, sein Schwiegervater war einer der ersten Missionare auf den Hawai-Inseln. Da Clark selbst von Beruf weder Pfarrer einer bestimmten Kirche ist noch als Missionar von einer bestimmten Missionsgesellschaft bezahlt wird, ist er bei seinem Unterricht ganz frei, steht nicht unter der Kontrolle einer ausländischen Organisation und hat sich an keine Auflagen und Erwartungen von ausländischen Geldgebern zu halten.
Die Lernsituation ist ideal. Clark bemüht sich, seinen Studenten etwas beizubringen, aber genauso wichtig ist der Wille der Studenten, etwas von Clark zu lernen. Sie sind durch ihre Vorbildung befähigt und durch ihr Ziel, so gut wie möglich dem Vaterland zu dienen, aufnahmebereit für alles Neue.
Außerdem kommen sie aus einer Kultur, in der Lehrer einem hochgeachteten Stand angehören. Wissen und Erfahrung der vorhergehenden Generation sind der Startpunkt der neuen Generation.
So blicken Clarks Schüler voll Vertrauen und Erwartung auf ihren Lehrer. Er kommt für sie aus einer unbekannten Welt, von der sie viel hören und lernen wollen. Sie können schon etwas Englisch und sind begierig, in dieser westlichen Sprache noch mehr Fortschritte zu machen, um noch mehr westliches Wissen zu erlangen. Um Sprache und gleichzeitig Moral zu lehren, wäre also eine englische Bibel ein ideales Lehrbuch.
Es ist erstaunlich, wie sich Wege auftun, wenn man wirklich danach sucht. Man findet Unterstützung, wenn man etwas wirklich will. So wird auch das Lehrbuchproblem gelöst und zwar durch den Besuch des Missionars Dr. Luther Halsey Gulick. Er schenkt Clark 30 englische Bibeln und sorgt dann auch noch für Nachschub.
Neues entwickelt sich in jeder Generation, aber ewige Werte bleiben ewige Werte und sind unveränderlich durch alle Zeiten hindurch. So wird in Clarks Sonntagsversammlung das „Vater unser“ gebetet. Ein kurzer Bibelabschnitt wird gelesen und erklärt. Die Studenten lernen so von Anfang an undogmatisches Denken und sie lernen, die Bibel intensiv und selbstständig zu lesen. Ansonsten wird die Versammlung je nach Situation frei gestaltet. Ein Programm, das so weiterlaufen kann, auch wenn Clark einmal nicht mehr dabei ist.
Die Kirche von Antiochia wird von besonderem Interesse für die japanischen Studenten, die im Norden Japans weit weg von den Hochburgen des Christentums leben.
Die Kirche in Antiochia war aus dem Heidentum hervorgegangen und hier herrschten nicht die Gesetze der Judenchristen in Jerusalem, sondern der Glaube an Jesus Christus. Das Wesentliche war sehr klar und so ist es kein Wunder, dass hier in Antiochia zum ersten Mal diejenigen, die an Christus glauben, „Christen“ genannt werden. Mit den Christen in Antiochia können sich die Studenten identifizieren. Später denken sie, dass es Clarks lang gehegte Hoffnung gewesen sein muss, ein neues Land zu finden, wo man Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten und nach dem eigenen Gewissen dienen kann.
Clark ist für die jungen Leute der Repräsentant des Christentums. Sie kennen weder Clarks Vorgeschichte, noch können sie seine Nachgeschichte kennen, noch denken sie viel über Clarks Kirche in Amerika und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kirchen im Westen nach. Wichtig ist der Mann, den sie in diesem Augenblick vor sich sehen. Aber Clark stellt sich nicht als Säule seiner Studenten-Bibelversammlung in den Mittelpunkt, sonst würde alles zusammenbrechen, wenn er weggeht. Und er geht schon bald. Er hat nicht einmal ein Jahr Zeit für seine Aufgabe.
Kurz bevor er nach Amerika zurückkehrt, übergibt er seinen Schülern einen Vertrag, einen Bündnisvertrag, der gleichzeitig ein Glaubensbekenntnis ist, geschrieben in englischer Sprache. Ein Vertrag muss unterschrieben werden und alle sechzehn Schüler der ersten Klasse unterschreiben am 5. März 1877 den „Bund der Bekenner Jesu“.
Bund der Bekenner Jesu
Wir, die Studenten der Landwirtschaftshochschule von Sapporo, unterschreiben hiermit, dass wir uns zu Christus nach seinem Befehl bekennen und in aufrichtiger Treue jede christliche Pflicht erfüllen wollen, um unsere Liebe zu unserem Heiland und unsere Dankbarkeit dafür zu zeigen, dass er durch seinen Tod am Kreuz für unsere Sünden gesühnt hat.
Wir wünschen aufrichtig, zu seiner Ehre und zur Rettung aller, für die er gestorben ist, sein Königreich unter den Menschen wachsen zu lassen.
Darum schließen wir einen Bund mit Gott und miteinander, von jetzt an seine treuen Jünger zu sein und seine Lehren dem Buchstaben und dem Geist nach genau zu befolgen, und wir versprechen, dass wir, sobald sich eine passende Gelegenheit bietet, die Prüfung ablegen, uns taufen lassen und in eine evangelische Kirche eintreten.
Wir glauben, dass die Bibel die einzig direkte, den Menschen von Gott gegebene Wortoffenbarung und der einzig vollkommene und unfehlbare Weg zu einem herrlichen zukünftigen Leben ist.
Wir glauben an den einzigen, ewigen Gott, unseren barmherzigen Vater, unseren gerechten und allmächtigen Herrscher, der einst unser Richter sein wird.
Wir glauben, dass alle, die aufrichtig Buße tun und durch den Glauben an Gottes Sohn die Vergebung ihrer Sünden erlangen, vom Heiligen Geist gnädig durch dieses Leben geführt werden, dass sie von der wachsamen Vorsehung des himmlischen Vaters beschützt werden und so schließlich vorbereitet sind auf die Freuden und Arbeiten der Erlösten und Heiligen; dass aber alle, die sich weigern, die Einladung zum Evangelium anzunehmen, in ihren Sünden sterben müssen und für immer aus der Gegenwart Gottes verbannt sind.
Wir versprechen, uns folgende Gebote immer vor Augen zu halten und ihnen in allem Auf und Ab unseres irdischen Lebens zu gehorchen.
Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, aus allen Kräften und von ganzem Gemüt lieben und deinen Nächsten wie dich selbst.
Du sollst kein Götzenbild anbeten oder sonst ein Bild von irgendeinem Wesen oder Ding.
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.
Denk daran, den Sabbat heilig zu halten. Vermeide an ihm alle unnötige Arbeit und widme ihn soviel wie möglich dem Studium der Bibel und dafür, dich selbst und andere für ein heiliges Leben vorzubereiten.
Du sollst deinen Eltern und Vorgesetzten gehorchen und sie ehren.
Du sollst nicht töten, nicht ehebrechen oder sonst eine Unreinheit begehen; du sollst nicht stehlen und nicht betrügen.
Du sollst deinem Nächsten nichts Böses tun.
Bete ohne Unterlass.
Zur gegenseitigen Hilfe und Ermutigung gründen wir hiermit eine Freundesvereinigung mit dem Namen „Bund der Bekenner Jesu“ und versprechen fest, solange wir zusammen leben, wöchentlich eine oder mehrere Versammlungen zu besuchen, um die Bibel oder andere religiöse Bücher oder Schriften zu lesen, um Besprechungen zu halten und um gemeinsam zu beten.
Wir wünschen von Herzen, dass der Heilige Geist in unseren Herzen sei, um unserer Liebe immer neuen Auftrieb zu geben und unseren Glauben zu stärken und uns zur rettenden Erkenntnis der Wahrheit zu führen.
Sapporo, den 5. März 1877
Clark hat seinen Schülern als sein Vermächtnis nicht westliche Kulturprodukte hinterlassen, sondern die Bibel und das Glaubensbekenntnis. Und er hat klare und konkrete Worte gebraucht, um zu zeigen, worauf es ankommt und was zu tun ist.
„Wir unterschreiben ... , wir wünschen ... , wir schließen einen Bund ... , wir glauben ... , wir versprechen ... , wir gründen ... .“
Die acht Monate in Sapporo sind Clarks Sternstunde. Er war wohl nicht so eine strahlende Persönlichkeit, wie es seinen Schülern schien und wie man durch seine Wirkungsgeschichte in Japan vermuten könnte.
Aber hier in Japan hat er seine große Stunde, seine große Aufgabe, und so kann auch ein gewöhnlicher Mann in einer ungewöhnlichen Situation über sich selbst hinauswachsen, bzw. durch seine großen Schüler selbst groß werden.
Das Schwierige bei Sternstunden ist, dass man sie nicht als einmalige Sternstunde annimmt, sondern immer wieder dieses Leuchten erleben will, danach richtig süchtig werden kann. Aber Sucht bedeutet Untergang. Eine Sternstunde ist genug, man darf dafür sein ganzes Leben lang dankbar und zufrieden sein. Seine eigene Sternstunde hat wohl jeder Mensch einmal, dauert sie nun eine Stunde oder mehrere. Clark will auch nach seiner Sternstunde, nach seiner Rückkehr nach Amerika, noch etwas Besonderes vollbringen. Er fängt vieles an, aber nichts gelingt mehr richtig. Bei einem Rückblick auf sein Leben und seine verschiedenen Tätigkeiten befriedigt ihn dann auch am meisten die Tatsache, dass er japanische Jugend zu Christus geführt hat.
Clark hat guten Samen in guten Boden gesät. Das war seine große Aufgabe, mehr nicht. Aber viel genug, um in Zukunft Frucht zu bringen.
Ohne es selbst zu wissen und geplant zu haben, hat er das Leben für einen Schüler der nächsten Klasse, der auch eine besondere Berufung bekommen hat, für Kanzo Uchimura vorbereitet. Das war Clarks Sternstunde.
„Boys, be ambitious!“
Noch etwas hinterlässt Clark, bevor er am 16. April 1877 Sapporo verlässt. Noch ein Sternchen leuchtet auf und funkelt bis heute. Das sind drei seiner Abschiedsworte. Sie sind eingemeißelt auf dem Sockel einer Clark-Statue in Sapporo (Hitsujigaoka Tenbodai) „Boys, be ambitious!“
Heute wenden sich diese Worte natürlich auch an „girls“ und an alle, deren Herz dafür offen ist.
Die Worte sind noch immer in Japan allgemein bekannt, werden gerne zitiert und in englischer Sprache in Schulbüchern und auf Abschlussalben der Schulen abgedruckt.
Clarks direkte Studenten brauchen diesen Aufruf eigentlich gar nicht mehr, denn sie sind „ambitious“. Sie haben hohe Ziele für ihre und Japans Zukunft und ihr Herz brennt darauf, gemäß des „Bundes der Bekenner Jesu“ zu leben.
Der Regierungsbeamte Kuroda kann mit der hohen Moral, die Clark seinen Studenten vermittelt hat, zufrieden sein. Clarks Schüler, einige Schüler der zweiten Klasse und dann die Schüler der Schüler werden die neue Geschichte Japans mitgestalten. Man braucht nur ihre Namen im Internet zu suchen.
Für den jungen Uchimura, einen Schüler der zweiten Klasse, führt der Weg nach dem Studium allerdings zunächst in eine schwere Krisenzeit. Wie alle großen Männer macht er eine besondere Ausbildungszeit durch und bei ihm ist es eine besonders harte. Er geht einen langen, aber den besten Weg, um seine Aufgabe als Christ für sein Land und für die Welt zu erfüllen.
So hat der amerikanische Lehrer, der nur für kurze Zeit von der japanischen Regierung angestellt worden war, im Endeffekt eine viel weitere Wirkung, als er und seine Auftraggeber je gedacht hätten. Er hat nicht nur für die Entwicklung Hokkaidos gearbeitet, sondern auch für die Entwicklung Uchimuras und damit für den christlichen Weg, der auch in unserem Jahrhundert weitergegangen wird.
Clark tut einen ersten kleinen Schritt. Er hat eine klare Grundlage, wie er sie im „Bund der Bekenner Jesu“ ausdrückt, und reagiert auf die konkrete Situation in Sapporo. Dieser Schritt zur richtigen Zeit, den die richtigen Leute mitgehen, führt nicht nur in ein neues Zeitalter der japanischen Geschichte, sondern auch in eine neue Zeit der Evangeliumsgeschichte.
Ein Schritt in die Zukunft, das Neue, das die Herzen und damit die Welt verändert, bedeutet in der Geschichte des Evangeliums immer, dass es ein Schritt weg ist von den Irr- und Umwegen der Zeit zurück zum Zentrum, zum Evangelium von Jesus Christus.
Studentenmissionare
Clark war ein großer Lehrer, d.h. sein Werk geht auch ohne ihn weiter und die Zukunft wird noch besser als der Anfang. Die Unterschriften seiner Schüler unter den „Bund der Bekenner Jesu“ sind noch frisch, als er abreist, und die Schüler brennen darauf, das Versprechen einzulösen, das ihr Lehrer ihnen als sein Vermächtnis hinterlassen hat. Dazu gibt es bald Gelegenheit.
Schon ist wieder ein Schiff mit Schülern aus Tokyo nach Sapporo unterwegs. Am 3. September 1877, einen Tag, bevor die Studenten der zweiten Klasse eintreffen, wollen einige von Clarks Schülern ein konkretes Versprechen aus dem „Bund“ erfüllen: „ ... und wir versprechen, dass wir, sobald sich eine passende Gelegenheit bietet, die Prüfung ablegen, uns taufen lassen und in eine evangelische Kirche eintreten.“ Diese „passende Gelegenheit“ ist jetzt da, d.h. am Abend, bevor die neuen Schüler eintreffen. Sieben von Clarks Schülern lassen sich von Merriman Colbert Harris, einem amerikanischen Missionar der methodistischen Kirche, taufen.
Die Missionsstation von Harris ist in der Hafenstadt Hakodate, die zwar auch auf der Nordinsel Hokkaido liegt, aber weit von Sapporo entfernt ist. Er kann deshalb nur gelegentlich zu Besuch kommen. Ein Nachteil, der für die Studenten zum Vorteil wird. Ist kein beruflicher Missionar da, muss man selbst Missionar werden. Also ist klar, was die gerade getauften Clark-Schüler tun werden, wenn die Schüler der nächsten Klasse eintreffen. Sie werden zu Missonaren für die Neuankömmlinge; ein brennendes Studentenherz muss sein Feuer weitergeben, es kann gar nicht anders.
Jung, „ambitious“, voller Verantwortungsgefühl für ihr Land und mit missionarischem Sendungsbewusstsein erfüllt, so erwarten die Clark-Schüler die zweite Klasse und so wird der sechzehnjährige Uchimura in seiner neuen Schule empfangen – und er ist wenig begeistert davon.
Aber unter den Neulingen war einer, der sich einbildete, er könne diesem geschlossenen Sturmangriff der oberen Klasse widerstehen (in diesem Fall stürmte die obere Klasse mit der Religion, nicht mit dem Stock auf die untere ein). Und nicht nur das. Dieser Neuling dachte, er könne die Schüler der oberen Klasse zu ihrem alten Glauben zurückbekehren.
Vorurteil
Ein Regierungsbeamter hatte in Tokyo an der Tokyo-Englisch-Schule für die Sapporo-Schule geworben und drei Schüler konnten am Tag nach dieser Rede die Zustimmung ihrer Eltern bringen: Kanzo Uchimura, Inazo Ota (später: Inazo Nitobe) und Kingo Miyabe.
Uchimura und Miyabe werden lebenslange Freunde. Leider hat Uchimura die Briefe seines Freundes nicht aufgehoben, aber glücklicherweise haben wir noch viele wertvolle Briefe von Uchimura an Miyabe, die uns Einblicke in Uchimuras Leben geben.
Uchimuras Weg ins Christentum beginnt also hier in Sapporo. Aber schon in Tokyo war er mit dem Christentum in Berührung gekommen.
Eines Tages, es war Sonntag Morgen, fragte mich ein Schulfreund, ob ich nicht mit ihm „an einen Platz im Ausländerviertel“ gehen wolle, „wo man hübsche Frauen singen hören kann und wo ein großmächtiger Mann mit langem Bart auf einem Podest schreit und brüllt, mit den Armen herumfuchtelt und seinen Körper in ganz bizarrer Weise verdreht. Und für das alles braucht man keinen Cent Eintritt zu bezahlen.“
So beschrieb er mir einen christlichen Gottesdienst, der in einer Sprache stattfand, die für mich damals noch neu war. Ich begleitete meinen Freund an diesen Ort und es gefiel mir gar nicht so schlecht dort. Also ging ich Sonntag für Sonntag wieder hin und hatte keine Ahnung, was das für schreckliche Folgen haben würde. Eine alte Engländerin, bei der ich meinen ersten Englischunterricht hatte, war hocherfreut, dass ich jeden Sonntag in die Kirche ging. Sie wusste nicht, dass ich meine „Sonntagsausflüge in die Siedlung“, wie ich es nannte, nur deshalb unternahm, weil es Interessantes zu sehen gab, und nicht deshalb, weil ich die Wahrheit suchte.
Das Christentum war für mich eine recht erfreuliche Angelegenheit, solange man nicht von mir verlangte, es anzunehmen. Die Musik, die Geschichten, die Freundlichkeit, mit der die Christen mich behandelten, das alles gefiel mir sehr.
Ein tieferes Interesse für das Christentum und die Bibel hatte er bis zu seinem Studienbeginn in Sapporo zwar nicht, aber seine Sonntagsausflüge in die Kirche zu den Christen waren unterhaltsam und etwas Neues und es gab keinen Grund dagegen.
Aber als ich fünf Jahre später in aller Form dazu aufgefordert wurde, das Christentum anzunehmen und dazu noch strenge Gesetze einhalten und viele Opfer bringen sollte, da empörte sich meine ganze Natur dagegen. So einer Lebensweise wollte ich mich nicht unterwerfen. Von den sieben Tagen der Woche sollte ich einen Tag speziell für religiöse Zwecke aussondern und müsste an diesem Tag auf alle meine anderen Studien und Vergnügungen verzichten! So ein Opfer zu bringen erschien mir fast unmöglich.
Uchimura hatte wie auch viele seiner Landsleute so einige Vorurteile gegenüber dem Christentum. Es war für ihn eine westlich-fremdartige Religion, ganz nett, aber für ihn als Japaner unpassend und unannehmbar.
Ich hatte von klein auf gelernt, mein Volk höher als alle anderen zu achten und nur die Götter meines Volkes und keine anderen anzubeten. Ich glaubte, nicht einmal der Tod selbst könnte mich dazu zwingen, meine Untertanentreue anderen Göttern als denen meines Landes zu geloben. Ich würde ja mein Land verraten und vom Glauben meines Volkes abtrünnig werden, wenn ich einen Glauben annehmen würde, der aus einem fremden Land kommt. All meine hohen Ziele, deren Grundlage meine bisherige Auffassung von Pflicht und Vaterlandsliebe war, müssten durch eine solche Annäherung an eine fremde Religion zerstört werden.
Eine schreckliche Lage
In Sapporo wird der junge Uchimura nun bedrängt und soll auch ein „Bekenner“ werden, d.h. er soll dem „Bund der Bekenner Jesu“ beitreten. Nein, das kann und das will er nicht, auch wenn sich seine gleichaltrigen Kameraden schon den älteren Studenten anschließen.
Ich erinnere mich noch gut an meine schreckliche Lage und die Einsamkeit, in der ich mich damals befand.
Eines Nachmittags ging ich zu einem nahen Tempel, dessen Gott mit Regierungserlaubnis, wie man sagte, der Schutzgott dieser Gegend war. In etwas Entfernung von dem heiligen Spiegel, der die unsichtbare Gegenwart der Gottheit darstellte, warf ich mich auf das raue, trockene Gras nieder und brach in ein Gebet aus, das so aufrichtig und ernst war wie nur irgendein Gebet sein konnte, mit dem ich mich später an meinen christlichen Gott wandte. Ich flehte den Schutzgott an, schnell die neue Begeisterung an meiner Hochschule zu ersticken und die zu bestrafen, die sich hartnäckig weigerten, den fremden Gott zu verlassen. Ich bat, mir bei meinen bescheidenen Bemühungen für die Sache des Vaterlandes beizustehen.
Nach dem Gebet ging ich in den Schlafsaal des Studentenwohnheims zurück und zu meiner Qual versuchten die andern schon wieder, mich zu dem neuen Glauben zu überreden.
Aber welcher Junge kann schon dem starken Druck seiner älteren Kameraden lange Widerstand leisten.
Die öffentliche Meinung an der Hochschule war zu stark gegen mich, sie war größer als meine Widerstandskraft. Sie zwangen mich, den „Bund“ zu unterschreiben, so etwa, wie wenn überzeugte Abstinenzler einen unverbesserlichen Trunkenbold dazu überreden, ein Enthaltsamkeitsgelübde zu unterschreiben. Aber schließlich willigte ich doch ein und unterschrieb.
Ich frage mich oft, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn ich mich einem solchen Zwang nicht gefügt hätte. Aber damals war ich erst sechzehn Jahre und die anderen, die mich zwangen „hineinzukommen“, waren alle viel größer als ich.
Wie man sieht, habe ich meinen ersten Schritt ins Christentum gezwungenermaßen gemacht, gegen meinen Willen, und ich muss gestehen, irgendwie auch gegen mein Gewissen.
Uchimura unterschreibt den „Bund der Bekenner Jesu“ am 11. Dezember 1877. Aber durch diese Unterschrift wird er kein Heuchler, der sich äußerlich anpasst, innerlich jedoch ganz anders denkt. Wenn schon, denn schon! Er versucht nun, konsequent nach dem zu leben, wofür er sich verpflichtet hat, und das scheint erst einmal gar nicht so schwer zu sein. Die puritanischen Gedanken, wie sie an der Hochschule durch Clark eingeführt worden waren, stehen keineswegs in Widerspruch zu seiner Erziehung als Sohn einer Samurai-Familie und sie wirken sogar wohltuend auf seine geistige und körperliche Gesundheit.
Der praktische Gewinn des neuen Glaubens
Der praktische Gewinn, den mir der neue Glaube brachte, war mir sofort klar. Ich hatte ihn geahnt, selbst damals schon, als ich ihn noch mit allen Kräften von mir abwehren wollte.
Man lehrte mich, dass es nur einen Gott im ganzen Universum gebe und nicht viele – über acht Millionen, wie ich früher geglaubt hatte. Der christliche Monotheismus legte seine Axt an die Wurzel all meines Aberglaubens. Auf alle Gelübde, die ich gemacht hatte, und auf die verschiedenen Arten der Anbetung, mit denen ich meine zornigen Götter beschwichtigen wollte, konnte ich nun verzichten, da ich diesen einen Gott hatte. Mein Verstand und mein Gewissen sagten „Ja“ dazu.
Ein Gott und nicht viele, das war wirklich frohe Botschaft für meine kleine Seele. Nun brauchte ich nicht mehr jeden Morgen den vier Gruppen von Göttern in den vier Himmelsrichtungen meine langen Gebete aufzusagen. Ich brauchte keine langen Gebete mehr an jedem Tempel, an dem ich vorüberkam, zu wiederholen; ich brauchte nicht mehr an diesem Tag diesem Gott und an jenem Tag jenem Gott Gelübde zu halten und für den einen auf dies und für den anderen auf jenes zu verzichten.
O wie stolz ging ich nun erhobenen Hauptes an Tempel für Tempel vorbei. Ich hatte ein reines Gewissen und vertraute ganz darauf, dass keiner der Götter mich mehr bestrafen könne, weil ich mein Gebet nicht gesprochen hatte. Ich hatte den Gott der Götter gefunden, der mich schützte und stützte.
Meine Freunde merkten bald, dass sich meine Stimmung geändert hatte. Während ich sonst die Unterhaltung abgebrochen hatte, sobald ein Tempel in Sicht kam, denn ich musste in meinem Herzen ja ein Gebet sprechen, setzte ich jetzt meinen Schulweg fröhlich lachend fort. Ich bedauerte nicht, dass man mich gezwungen hatte, den „Bund der Bekenner Jesu“ zu unterschreiben.
Der Monotheismus hatte mich zu einem neuen Menschen gemacht. Ich begann, wieder Bohnen und Eier zu essen. Ich dachte, ich verstehe schon das ganze Christentum, so hat mich der Gedanke begeistert, dass es nur einen Gott gibt.
Die neue geistliche Freiheit, die mir der neue Glaube brachte, hatte einen heilenden Einfluss auf meinen Geist und meinen Körper. Ich betrieb meine Studien mit höherer Konzentration, freute mich der neu gewonnenen Aktivität meines Körpers und streifte durch Wald und Feld, beobachtete die Lilien im Tal und die Vögel in der Luft und suchte durch die Natur das Zwiegespräch mit dem Gott der Natur.
Als „Bekenner Jesu“ hat Uchimura nun also eine neue und nützliche Moral als Hilfe für seinen Alltag und für die weitere Lebensperspektive gefunden. Er blüht geistig und körperlich auf und erhofft sich durch das Christentum ein glückliches Familienleben, politische Freiheit und die geistige und moralische Grundlage, um sein Land so stark wie Europa oder Amerika zu machen.
Auch der Sonntag als studien- und arbeitsfreier Tag tut ihm gut. Sechs Tage Arbeit, an denen man tut, was man tun soll, und dann der eine absolute Ruhetag mit der geistlichen Orientierung (5.Mose 5,15) erweisen sich als göttlicher Rhythmus, als großes Geschenk, als besondere Schöpfung Gottes (Genesis 2, 2.3; Exodus 20,8-2-11).





























