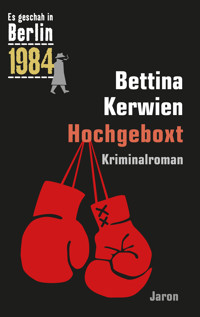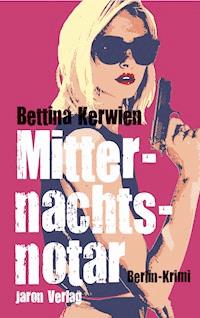Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron
- Kategorie: Krimi
- Serie: Es geschah in Berlin
- Sprache: Deutsch
Berlin, April 1986: Ein Killer mordet sich nachts durch West-Berlin. Er hat eine Vorliebe für einsame Straßen und russische Babuschkas. Jedenfalls glaubt Kommissar Peter Kappe, dass es sich um eine Mordserie handelt – bislang als einziger. Kurz darauf bricht der Novosti-Fotograf Schenja Brost im Foyer des Axel-Springer-Hochhauses zusammen. Er war aus Kiew über Schönefeld nach West-Berlin eingereist und radioaktiv verstrahlt. Brost hatte eine internationale Pressekonferenz verlangt und ansonsten geschwiegen. Jetzt, zwei Tage später, ist er tot. Ist Brost für die Morde an den alten Frauen verantwortlich? Oder ein Spion? Dann findet sich im Schuh des toten Russen ein Fotonegativ – und darauf sieht Kappe etwas Unvorstellbares, das sich dennoch als wahr entpuppt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bettina Kerwien lebt in Berlin. Sie studierte Amerikanistik und Publizistik, war viele Jahre Geschäftsführerin eines Stahlbauunternehmens und arbeitet derzeit für einen Stadtplanverlag. In jeder freien Minute widmet sie sich dem Schreiben. In der Reihe «Es geschah in Berlin» erschienen von ihr 2019 «Au revoir, Tegel», 2020 «Tod im Teufelssee», 2022 «Tiergarten Blues», 2023 «Agentenfieber» und 2024 «Hochgeboxt».
Bettina Kerwien
Katzenkopp
Ein Kappe-Krimi
Jaron Verlag
«Denjenigen, die die Welt gerettet haben»
Inschrift am Denkmal für die Liquidatoren, die gefallenen Ersthelfer und die Feuerwehrmänner vor der Feuerwehrstation in Pripyat, Tschernobyl, Ukraine
Originalausgabe
1. Auflage 2025
Jaron Verlag GmbH, Erdmannstraße 6, 10827 Berlin
[email protected], www.jaron-verlag.de
© 2025 Jaron Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin
Satz: Prill Partners|producing, Barcelona
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
ISBN 978-3-95552-087-8
«Why worry about something that isn’t going to happen?»
Chernobyl, HBO-Miniserie
«Es gibt allerlei Arten, einen Menschen zu morden oder wenigstens seine Seele, und das merkt keine Polizei der Welt. Dann genügt ein Wort, eine Offenheit im rechten Augenblick. Dann genügt ein Lächeln.
Ich möchte den Menschen sehen, der nicht durch Lächeln umzubringen ist oder durch Schweigen.»
Max Frisch, Stiller
Inhalt
Prolog Großsiedlung Obstallee, Spandau, West-Berlin,
Eins Montag, 21. April
Zwei Dienstag, 22. April
Drei Mittwoch, 23. April
Vier Donnerstag, 24. April
Fünf Freitag, 25. April
Sechs Samstag, 26. April
Sieben Sonntag, 27. April
Acht Montag, 28. April
Neun Dienstag, 29. April
Zehn Mittwoch, 30. April
Elf Donnerstag, 1. Mai
Zwölf Freitag, 2. Mai
Fakt & Fiktion
Es geschah in Berlin …
PROLOGGroßsiedlung Obstallee, Spandau, West-Berlin, 1972
DIE FAMILIE SITZT am Wohnzimmertisch und frühstückt. Es gibt labbriges Toastbrot mit Rama.
«Kinder», sagt der Stiefvater. «Ihr wisst ja, Andi hat heute Nacht wieder eingepullert. Er ist nutzlos, dumm und kann nichts richtig machen. Jetzt muss Mutti alles waschen. Und Vati muss alles neu beziehen.»
Andi lächelt. Er ist zehn Jahre alt. Das viertälteste von sieben Kindern. Sie wohnen im Neubau, Hochhaus, drei Zimmer, 16. Stock. Bis dahin reicht keine Feuerleiter. Deshalb ist die Wohnung so billig.
«Du bist gar nicht mein Vati», sagt Andi voller Inbrunst und lächelt und lächelt und lächelt.
Die Mutter steht auf und verpasst Andi ansatzlos einen Katzenkopp. Das ist Mutters Spezialität. Ihre Fingerknöchel bollern gegen Andis Schläfe. Kurz wird alles unscharf. Es klingelt in seinem Kopf. Ein bisschen schlecht ist ihm auch.
Die Mutter trinkt ihr Glas Frühstücksrotwein aus. Ihre dünnen, spitzen Zähne sind blaugraugelb vom vielen Wein. Die Kinder nennen den Alkohol «Muttis besten Freund». Mutti selbst weiß, dass Wein gut fürs Herz ist. Hat in der Zeitung gestanden.
«Heute Abend, wenn ich von Arbeit komme», zischt sie ihn an, «dann setzt’s was mit dem Hosengürtel, Andreas. Direkt auf den Nackten. Kannst du dich schon drauf freuen. Ich will mir nachher nicht vorwerfen lassen, wir hätten dich nicht erzogen.»
«Wir spielen Familiengericht, Kinder», verkündet der Stiefvater fröhlich. «Der Andi wird ja sowieso mal Berufsverbrecher.»
Er steht auf und zieht seinen Nietengürtel langsam aus den Laschen. Demonstrativ legt er ihn auf den Tisch. «Andi war sehr ungezogen. Was meint ihr, wie viel Haue auf den Po hat er verdient? Na los, schlagt mal was vor.»
Ein lustiges Spiel. Die kleinen Brüder schlagen vor, die Mutti solle heute Abend einmal zuschlagen.
«Aber der Andi hat doch im Schlaf … da kann er doch nichts für», sagt Andis zwei Jahre älterer Bruder Michael. Zack. Katzenkopp.
«Du entschuldigst mir den Spasti nicht immer!», brüllt die Mutter ihn an. Micha duckt sich weg.
«Zweimal Haue! Zweimal!», schlägt Andis Schwester vor, die verwöhnte Familienprinzessin. Ihre Augen leuchten vorfreudig.
Der älteste Bruder steht auf und schließt sich im Klo ein. «Komm du mal wieder raus, dann kannste dir gleich deinen Katzenkopp abholen!», schreit ihm die Mutter hinterher.
«Ich bin der Vorsitzende Richter!», freut sich der Stiefvater. «Andi, das Gericht befindet dich für schuldig, heute Nacht ins Bett, das du dir mit deinen beiden kleinen Brüdern teilst, eingenässt zu haben. Im Namen der Familie ergeht folgendes Urteil: Der Angeklagte erhält für jedes Lebensjahr einen Schlag mit dem Gürtel auf den nackten Hintern.»
«Hurra!», jubelt die Familienprinzessin. «Andi kriegt den Arsch voll! Andi kriegt den Arsch voll!» Andi ist es egal. Das wird vorbeigehen. Es ist immer vorbeigegangen.
«Zehn Schläge?» Die Mutter seufzt genervt. «Aber nur, wenn du ihn festhältst, Vati.»
Danach kann Andi zwei Tage nicht mehr sitzen.
Am dritten Tag pullert er in der Schule in die Hose. Er hat ein Diktat zurückbekommen, dem man ansieht, dass es im Stehen geschrieben worden ist.
Am vierten Tag, den Kopf noch ganz taub von den Katzenköppen, wartet Andi abends auf dem Balkon im 16. Stock. Irgendwann muss die Mutti doch von der Arbeit kommen.
EINSMontag, 21. April 1986
WIRD DIE WELT WIRKLICH untergehen? In den Räumen des Referats Verbrechensbekämpfung in der Keithstraße 30 bläst ein wilder schwarzer Wind durch den Kopf von Kriminaloberkommissar Peter Kappe. Seine Gedanken huschen wüst hin und her. Gestern ist er mit Rosi im Kino gewesen, When the Wind blows. Originalfassung, lief nur im Odeon in Schöneberg.
Kappe hält sich nicht für zimperlich, aber der Film war verdammt harter Tobak. Ein Zeichentrickfilm mit Musik von David Bowie und Roger Waters, da geht man doch rein! Noch dazu, wenn die Protagonisten ein reizendes älteres Liebespaar sind (wie Rosi und er, das hat Kappe tatsächlich kurz gedacht). Die niedlichen Alten leben idyllisch in einer wunderschönen Landschaft im ländlichen England. Aber dann explodiert eine Atombombe. Ein schwarzer Wind weht. Die beiden tapferen Eheleute machen sich Tee im Keller, und dann krepieren sie langsam, aber unausweichlich an der Strahlenkrankheit.
Kultur ist gefährlich. Aufwühlend. Kappe hat heute trotz Kaffee und Zigaretten noch nicht zu seiner Konzentration gefunden. Er weiß gar nicht, warum ihn der Film so anfasst. Ist doch fiktiv. Dass Unschuldige sterben, hat er doch jeden Tag auf dem Tisch. Trotzdem hört er noch immer die Radiodurchsagen aus dem Film: «Keep away from windows. Cover your head and eyes. Do not look at the sky.» Als ob das etwas nützen würde.
Seine Nackenhaare stellen sich auf. Mit leerem Blick stapelt er von halb acht bis halb fünf Akten. Das kann er sich im Moment leisten. Zurzeit bearbeitet die sechste Mordkommission Altfälle. Ansonsten bist du ja die ganze Zeit in Habachtstellung. Immer mit dem Transponder am Mann. Da liegst du in deinem Daunenbett und träumst von Sonnenuntergängen und schönen Frauen, und dann jagen dich die fiesen Piepstöne des Selektivrufs hoch: «Bitte Dienststelle anrufen!» oder «Bitte Lagedienst anrufen!». Da bist du sofort hundert Prozent da, springst auf, egal, wer im Bett neben dir liegt. Das Adrenalin schießt ein, du rufst den Lagedienst an, bekommst die Ansage «KHK Engländer möchte Sie am Tatort sehen!», gefolgt von der Adresse. Du springst in die Klamotten und los. Das ist wirklich nur was für junge Leute.
Jetzt also Altfälle. Na ja, nicht gerade steinalte. Aber halb alte. Kappe bekommt die Akten aller offenen Mordfälle aus den anderen Mordkommissionen auf den Tisch. Bis drei Jahre geht das zurück. Viel zu lesen. Offene Fälle machen irgendwie auch Spaß. Wenn man einen Ansatzpunkt findet. Wenn man sich konzentrieren kann. Wenn man nicht immerzu denken muss: Irgendwann werden die Russen irgendein NATO-Manöver für einen atomaren Erstschlag halten und dann zack: Die Welt, wie wir sie kennen, wird untergehen. Kappe kommt nicht drüber hinweg.
Vielleicht, wenn Kappe an einem der brandaktuellen Fälle sitzen würde. Zum Beispiel am Attentat vom 5. April: Kurz vor zwei Uhr morgens ist in der Friedenauer Hauptstraße 78 die Diskothek La Belle in die Luft geflogen. Aber bei Kappes Chef Harry Engländer hat das Telefon einfach nicht geklingelt. Trotz Splitterbombe und großem Tatütata. Trotz der 500 jungen Leute, die sich in der Diskothek aufgehalten haben. Das La Belle war ein beliebter Treffpunkt für amerikanische Soldaten gewesen. Ein Amerikaner war sofort tot, ebenso eine türkische Frau. Ein zweiter Amerikaner ist im Krankenhaus gestorben. Die jungen Leute hatten feiern wollen, und «dann kam der Tod», wie der Berliner Blitz titelte. Dazu hat es 229 Verletzte gegeben.
Jeder bei der Mordkommission weiß, dass die K6 über Rosis Ex-Freund Big Bill Bukowski beste Verbindungen zu den Amis hat. Kappe hat sogar Familie in Amiland. Harry Engländers Telefon hätte klingeln müssen.
«Hier, es steht in der Zeitung», hatte Kappe dem Chef vorgehalten. «Der Regierende Bürgermeister Diepgen bezeichnet den Anschlag als hinterhältigen Mord. Wir sind zuständig!»
«Sie wissen ja», hatte der Chef zu erklären versucht. «Das mit der Soko macht der Dienststellenleiter in Abstimmung mit dem Staatsanwalt. Da kann ich nichts machen.» Die Kriminalpolizei hatte sofort eine Soko gebildet – aus den Mordkommissionen 1 bis 4. Die K5 hat Bereitschaft. Und die K6 schaut in die Röhre. Beziehungsweise in alte Akten. Denn sämtliche ungeklärten Fälle müssen sie übernehmen, weil die Kollegen mit der Soko ausgelastet sind. Kappe redet sich ein, dass die anderen sich mit diesem politischen Attentatskram beschäftigen müssen, während die K6 weiter Mörder suchen darf.
Insgeheim würde er schon gerne wieder mit den Amis zusammenarbeiten. Andererseits ist es eine heiße Kiste. Schließlich geht es hier um libyschen Staatsterrorismus. Sagt der Flurfunk. Und als Krönung hat die Staatssicherheit der DDR wohl auch noch ihre Finger im Spiel.
Aber jemand muss sich ums Tagesgeschäft kümmern. Und Kappe hat sich gekümmert. Er sitzt im Besprechungsraum in Klausur. Offiziell wegen der Pinnwand, die hier hängt. Inoffiziell kann er hier so viel Currywurst zu Mittag essen, wie er will, ohne wegen des Geruchs von jemandem angemault oder mit Rosis Weihrauchstäbchen ausgeräuchert zu werden. Nur Bürohund Rocky hat sich zu Kappes Füßen zusammengerollt. Er schläft, schnarcht leise und verdaut seine Hälfte der Currywurst.
Wenn er ehrlich ist: Es gibt noch einen zweiten Grund für seine Unkonzentriertheit. Seine Kollegin und Lebensabschnittsgefährtin Roswitha Habedank hat heute Morgen dem Chef ganz unauffällig einen Briefumschlag zugesteckt.
Kappe will Rosi nicht fragen, was in dem Umschlag war. Er will auch den Chef nicht fragen. Er will erwachsen sein und einfach eine Weile ganz allein vor sich hin friemeln.
Nun hängen sie also vor ihm an der Pinnwand, die Opferfotos der sieben offenen Fälle, die Kappe aus den Akten ausgeheftet hat. Von jeder Mordkommission mindestens ein Fall. Nur die K2, eine Art polizeiinterner Friedhof der Kuscheltiere, hatte sogar zwei dieser Fälle auf dem Tisch. Alle Opfer sind ältere Frauen. Alle aus den letzten drei Jahren. Die Taten haben immer nachts oder in den frühen Morgenstunden stattgefunden. In und um Spandau. Kann es wirklich sein, dass das den Kollegen durchgerutscht ist? Da braucht man doch kein Profiler zu sein, um das auffällig zu finden. Kappe muss dringend seinen Chef Harry Engländer fragen, warum das in den wöchentlichen Kommissariatsleitersitzungen nicht aufgefallen ist. Er hat sich die Fälle nach Datum sortiert.
Es beginnt am 2. Februar 1983 mit der 60-jährigen Krankenschwester Melitta Matthes, die auf einem Spielplatz in Spandau vergewaltigt und mit Tritten und Schlägen zu Tode misshandelt wird. Und in der Nacht zum 4. Februar 1983 wird die verwirrte und hilflose Frieda Mitscherlich, 82, auf einem Lagerplatz des Oberstufenzentrums Bautechnik überfallen und ausgeraubt und zwischen Schutthaufen liegen gelassen. Todesursächlich war Erfrieren. Diesen Fall hatte die K2 als Unfall zu den Akten gelegt.
Am 1. Juli 1984 steigt die 62-jährige Putzfrau Josefine Mauz frühmorgens um 4.30 Uhr am Südparkteich aus dem Bus und wird dort vergewaltigt, geschlagen, gewürgt und ertränkt.
Vier Tage später wird Anna Grein, 71, überfallen, als sie gerade ihren Zeitungsladen in der Spandauer Altstadt öffnet. Der Täter reißt ihr die Kleider vom Leib, versucht, sie zu vergewaltigen und zu würgen. Er wird durch einen Kunden gestört und lässt von seinem laut schreienden Opfer ab. Anna Grein kann den Täter nicht beschreiben. Er habe es von hinten machen wollen.
Am 24. November 1985 hat nachts an der Heerstraße in Höhe Stößensee die 68-jährige Gerlinde Petri eine Autopanne. Erst hilft ihr der Täter beim Schieben, dann vergewaltigt und erwürgt er sie und legt sie anschließend im Flachwasser am Rupenhorn ab.
Dann Elisabeth Möller, 69: Sie steigt in der Nacht auf den 3. Januar 1986 am Kladower Hottengrund aus dem Nachtbus. Vergewaltigung und massive Gewalt gegen den Hals, Bruch des Zungenbeins – und das ist nicht mit dem Leben vereinbar.
Und schließlich am 5. März 1986 Hella Lenz, 77: in ihrer Wohnung an der Obstallee erwürgt und um 100 Mark beraubt.
Das macht einen hilflos. Aber es soll ja jetzt bald etwas Neues geben. In England hat ein Genetiker einen sogenannten genetischen Fingerabdruck entwickelt. Der Mann kann aus Spermaproben ein Profil erstellen, das nur einem einzigen Menschen zuzuordnen ist. Man nennt das DNS-Probe: Desoxyribonukleinsäure ist wohl ein Molekül, das sich in jeder Zelle findet und das die Erbinformationen der Lebewesen trägt. Und die kann man so analysieren, dass es aussieht wie ein Strichcode. Kappe staunt, dass er sich das alles gemerkt hat. Mithilfe dieser neuen Methode hat der englische Wissenschaftler auch schon einen Mordfall der Leicestershire Police aufgeklärt, stand letztens in der Zeitung. Verbrecher gehen also keinen rosigen Zeiten entgegen.
Fallanalyse ist Teamarbeit. Kappe trinkt den Rest seines lauwarmen Nescafé Gold aus dem zerbeulten Alcatraz-Gefängnisinsassen-Blechnapf. Seine Tochter hat ihm den vor ein paar Jahren zu Weihnachten aus Amerika geschickt. Kappe denkt jeden Tag an seine Tochter. Es sind intensive Gedanken, die er von innen durch seine Schädeldecke nach außen zu drücken versucht, damit sie auf ein Staubteilchen aufspringen können, das hoch in die Atmosphäre getragen wird, über den Atlantik segelt, die 15-jährige Tabea bei einem Basketballspiel in einem Park in Kenilworth, Union County, New Jersey findet und sich in ihren blonden Locken verfängt. Kappe weiß, dass das nicht genügt, um ein guter Vater zu sein. Aber alles andere hat er aufgegeben. Er ist ein unguter Vater. Punkt.
Was soll er nun tun mit diesen ganzen toten Frauen? Soll er versuchen, die ehemals zuständigen Ermittler auf dem Flur anzuquatschen? Nein. Kappe spürt einen Rest von Ermittlerstolz. Ich sehe was, was du nicht siehst. Darum geht es doch letztendlich immer. Er schnappt sich ein Telefon und ruft in der Rechtsmedizin an.
«Menschenskinda, Kappe!», begrüßt ihn Dr. Doreen Niedergesäß. «Die Sonne scheint! Heute schon ’n Killer jefangen?» Kappe ist versucht, wieder aufzulegen – die Rechtsmedizinerin ist ihm zu wach und zu gut gelaunt.
«Hallo Doreen», muffelt er zurück. «Hast du wieder an den Feuchtpräparaten genippt?»
«Igitt! Is dir langweilich? Denn könnteste mir hier mit ’n paar Präparaten helfen. Mit Ethanol fühlst du dir wohl, wie wir hier sagen.»
«Spaß beiseite, Frau Doktor. Du musst leider deine Körperspenden später weiter einlegen. Ich hab hier was.» Er gibt ihr die Namen der Opfer durch. «Schau dir doch nochmal deine Obduktionsberichte an. Gibt es Überschneidungen, Ähnlichkeiten?»
«Kappe! Die Fälle gehen über einen Zeitraum von über drei Jahren! Ich hör imma ‹deine Obduktionsberichte, deine Obduktionsberichte› – sind die Berichte nich in den Akten?», mault Doreen. «Ich mach hier doch ooch nich allet alleine! Du weißt ja, ich war schon mal in der Türkei, im Skiurlaub oder uff Fortbildung.»
Kappe legt den Kopf in den Nacken und lässt seine verspannte Halswirbelsäule knacken. «Wenn du da was finden würdest, könntest du deinem liebsten Fachkommissariat wirklich helfen. Ich wollte dich dafür nur mal sensibilisieren. Also ran. Schönen Tag noch!»
Er hört sie nach Luft schnappen und legt lieber schnell auf.
Vielleicht sollte er nachher auch noch mit Josef Bolp telefonieren, dem ewigen Chefreporter vom Berliner Blitz. So eine Schlagzeile aus der Abteilung «Stadt in Angst» macht zuverlässig Druck auf Täter und Öffentlichkeit. Natürlich vorausgesetzt, der Täter kann lesen.
ZWEIDienstag, 22. April 1986
EVGENIJ BROSTS HÄNDE ZITTERN. Der 40-jährige Fotograf, den alle nur Schenja nennen, zündet sich eine billige Belomor Papirossy an. Er wird heute zum ersten Mal Vater. Glaubt er.
Das Krankenhaus von Pripyat, der Trabantenstadt des Atomkraftwerks «W. I. Lenin», Tschernobyl, Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik, liegt etwas außerhalb, an der Straße der Völkerfreundschaft. Es hat sechs Stockwerke. Das Atomkraftwerk kann man von hier aus nicht sehen.
Der Flur der Geburtsstation ist lang, weiß, leer, steril. Blickt man den Gang entlang, scheint sich ein Türrahmen unendlich oft in den anderen zu schachteln, als würde man mit einem Spiegel in der Hand in einen weiteren Spiegel blicken.
Brost steht vor der Milchglastür, die zum Kreißsaal führt. Er hat an die Tür geklopft, bittend, fordernd, zuletzt verzweifelt. Aber niemand öffnet ihm. Durch das Milchglas schimmern die hellblauen Wandfliesen wie ein geheimnisvolles Licht. Brost weiß, er kann nichts tun.
Die Unruhe schmerzt ihn körperlich. Er hat Katja hergebracht. Nun übernimmt das System. Das Gesetz schreibt vor: zehn Tage strenge Quarantäne für Gebärende und Säuglinge. Es ist, wie es ist.
Brost geht auf und ab, raucht, schaut auf die Uhr. Liegt Katja noch in den Wehen? Wird alles gut gehen? Wird es ein Junge sein, so wie Katja es sich wünscht? Oder ist das Kind schon da?
Kein Laut dringt durch die Milchglastür.
Schenja Brost ist mit seiner Frau aus Kiew nach Pripyat gekommen, weil er den Fortgang des Kraftwerksbaus fotografisch begleiten soll. Sie sind aus der Stadt ins Grüne gekommen, aus einer verrotteten kommunalen Wohnanlage mit morgendlicher Schlange vor den Waschräumen in eine Neubauwohnung mit eigenem Bad. Ein ordentlicher Schritt vorwärts. Und jetzt endlich die Schwangerschaft. Mit fast 30 ist Katja für sowjetische Verhältnisse schon recht alt fürs erste Kind.
Draußen liegt alter Schnee. Der Himmel hat dieselbe Farbe. Es ist eiskalt. Auch hier auf dem Flur sind die Heizkörper nur lauwarm.
Brosts Blick bleibt am einzigen Objekt hängen, das auf dem kahlen, leeren Stationsflur steht: einer ausladenden, hochmodernen Kühltruhe. Es ist ein deutsches Fabrikat der Firma Miele. Der Deckel geht nach oben auf, nicht nach vorne wie bei den sowjetischen Modellen. So etwas hat Brost noch nie gesehen. Beim Fotografen meldet sich der Reporterinstinkt.
Der Deckel der Kühltruhe schnappt auf wie von allein.
Ein Schwaden Frostnebel quillt heraus.
Die Kühltruhe ist voller länglicher Objekte in der Größe russischer Milchweißbrote. Brost macht einen Schritt rückwärts. Ihm ist, als rutsche er auf unsichtbarem Eis. Dort vor ihm in der Kälte ruht etwas, eingeschlagen in Tüchern, umwickelt mit Folie und Klebeband. Mumien, denkt Brost. Matrjoschka-Puppen. Kaum so lang wie sein Unterarm. Es sind gespenstisch viele, die Truhe ist mehr als halb voll. Aus dem Nichts zieht sein hilfloses Gehirn noch einen anderen Vergleich. Einen, der hier an diesem Ort für einen Mann in seiner Situation viel zu naheliegt. Einen, den er niemals wieder vergessen wird.
Brost lässt den Deckel der Kühltruhe los. Der schließt sich wie in Zeitlupe. Deutsche Qualitätsarbeit.
Langsam geht er hinüber zum Fenster. Er starrt auf den Schnee. Er will das nicht denken. Sicherlich gibt es eine gute Erklärung. Es gibt immer eine gute, linienkonforme, parteikonforme Erklärung. Eine, an der ein braver Genosse wie er sich festhalten kann. Brosts Gesicht brennt, während ihm das bloße Wissen um die Anwesenheit der Kühltruhe wie Frostnebel über den Rücken streicht.
Kurz darauf kommen vier Männer in Arbeitskleidung den Gang herunter. Schweigend befestigen sie Tragegurte an der Kühltruhe, heben sie mühelos hoch und tragen sie die Treppe hinunter.
Ein Lastwagen fährt davon, und mit ihm verschwindet etwas aus Brosts Leben, das für immer hätte da sein sollen. Der Glauben an den Fortschritt vielleicht, Vertrauen. Er kann es nicht genau benennen. Er will zu seiner Frau. Er friert.
Stunden später. Früher Abend, draußen ist es schon dunkel, seine Zigaretten sind längst alle, sein Hals ist rau, seine Lunge schmerzt. Eine Krankenschwester erscheint.
Sie fasst Brost mit diesem Griff an den Oberarm, mit dem man eine Welt anhält. Dann sagt ihre gedämpfte Stimme, es habe Komplikationen gegeben. Man habe getan, was man konnte.
Was soll dieser weiche Beschwichtigungsblick?
«Was ist mit Katja?», stößt Brost hervor, obwohl er die Antwort bereits kennt. «Lassen Sie mich durch», keucht er und schiebt die Krankenschwester beiseite.
Im Besprechungsraum der K6 riecht es nach Rosis frischem Yogi-Tee. Vor jedem Kollegen steht eine dampfende Tasse.
«Das ist die Handschrift eines einzigen Täters», sagt Kappe und zeigt auf die Pinnwand. «Die spezifischen Merkmale in der Tatausführung gleichen sich.»
«Aber die Opfer haben alle unterschiedliche Hintergründe», wendet Landsberger ein, streckt die langen Beine aus und spielt mit seinem mitternachtsblauen Seidenschal.
«Alles ältere Frauen.» Kappe zuckt mit den Schultern. «Zufallsopfer.»
«Das können wir nicht mit Sicherheit sagen», mahnt Harry Engländer, der Kommissariatsleiter. «Dazu wissen wir noch zu wenig. Ich meine, dieser Spandau-Bezug …»
«Das ist schon auffällig», sagt Rosi.
«Haben Sie denn diese Fälle nicht besprochen auf den Kommissariatsleitersitzungen?», fragt Kappe den Chef.
Dem tritt gleich wieder der Schweiß auf die Stirn. «Das sind jetzt nicht so die spektakulärsten Fälle», sagt Harry Engländer peinlich berührt. «Und über einen Zeitraum von drei Jahren! Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mal an alle erinnern. Noch dazu wurden die Fälle von verschiedenen Sachbearbeitern bearbeitet, da können wir den Kollegen jetzt auch keinen Vorwurf machen. Da waren ja auch viele mal krank. Und die ganzen Urlaubsvertretungen! Da kann das schon mal … also, falls da überhaupt etwas dran sein sollte.»
«Wir tauschen uns wirklich zu wenig aus», bemerkt Rosi.
«Ich gehe davon aus, dass wir hier eine Serie haben.» Kappe lehnt sich einfach mal aus dem Fenster. «Als Arbeitshypothese.»
«Let’s get ready to rumble!», lacht Landsberger und reibt sich die Hände. «Endlich was Sinnvolles zu tun!»
Der Chef winkt ab. «Da halten wir mal den Ball ganz flach», sagt er.
«Aber was ist, wenn ich richtig liege, Herr Engländer?», widerspricht Kappe. «Dann läuft da draußen einer rum …»
«Kappe, ich will das nicht!», schimpft Engländer. «Ich will nicht, dass wir uns hier über die anderen erheben und denen zeigen –»
«… wo der Frosch die Locken hat?», fällt Kappe ihm ins Wort.
«Das würde wieder ein wenig Pep in den Arbeitstag bringen», lächelt Rosi.
«Nein! Ich will nicht, dass Sie sich da auf was versteifen!» Harry Engländer läuft rot an. «Wie stehe ich denn dann da? Wie der Kapitän vom Piratenschiff, oder wie stellen Sie sich das vor? Nee, nee! Finger weg von Ihren Serienfantasien! Nehmen Sie sich einen Fall nach dem anderen vor, und dann sehen wir weiter.»
«Aber …»
«Kappe, Landsberg, Frau Habedank – Sie nehmen sich jetzt mal jeder einen Fall vor.» Der Chef kann auch Befehlston. «Und wenn Sie wirklich so viel draufhaben, wie Sie von sich selbst glauben – und natürlich auch ich als Ihr Vorgesetzter –, dann sollten Sie ja einen Fall nach dem anderen lösen können, nicht wahr? Wenn wir Ihrer Logik folgen, dann müsste der erste Täter, den Sie dingfest machen, dann ja auch … also, quasi: Haste einen, haste alle! Und wenn Sie dann hieb- und stichfeste Beweise für eine Serie haben, dann kommen Sie zu mir. Das ist was Politisches. Das müssen wir dann – wenn es feststeht – ganz vorsichtig kommunizieren. Sonst heißt es noch, wir wollten uns hier auf Kosten der Kollegen profilieren.»
«Wollen wir ja auch», sagt Kappe. Warum drumherum reden?
Landsberger tauscht einen schnellen, funkelnden Blick mit ihm. Dann streicht er sich abenteuerlustig die Fönfrisur aus dem Gesicht.
«Immer langsam mit den jungen Pferden», sagt Harry Engländer. «Ihre Stunde wird kommen, meine Herren. Aber immer einen Fall nach dem anderen! Haben wir uns verstanden?»
Stille. Engländer schaut in die Runde und schnipst mit seinem Kugelschreiber. Kappe spürt, wie der Druck in seinem inneren Dampferzeuger steigt.
«Jetzt trinken wir erstmal einen schönen Tee und atmen in die Chakren.» Rosi lächelt und sieht dabei mit ihren Locken und der runden Brille so süß aus wie eine gut gealterte Janis Joplin.
Der Chef steht auf, nimmt seinen Tee und knallt im Hinausgehen mit der Tür.
Kappe verspürt auf einmal einen ungeheuren, ungebührlichen Ehrgeiz. «Also, ich sehe da eindeutig eine Serie», brummt er. «Wer noch?»
Sie prosten sich verschwörerisch mit ihren Teetassen zu.
DREIMittwoch, 23. April 1986
BMW-WERK 3.1, AM JULIUSTURM, Spandau. Die Chefin hat ihn einbestellt zum Personalgespräch. Reine Zeitverschwendung. Aber da muss er jetzt durch. Und ruhig bleiben dabei. Was auch immer diese Frau von ihm will, er wird es hinzunehmen versuchen.
Er hat eine harte Woche hinter sich. Immer Nachtschicht. Nachtschichten müssen sein. Er lässt die Menschen zu den Maschinen. Die Maschinen dürfen nicht stillstehen.
Er legt seinen Mantel über den Stuhl, setzt sich und zieht die Bügelfalten. Er hat sich nochmal frisch rasiert, dann fühlt er sich freier. Er erträgt es nicht, unrasiert zu sein. Frau Gasmann hat ein rosiges Gesicht und ein Riesenmaul, aus dem ein Schwall von Belehrungen strömt. Es nimmt kein Ende. Er hört gar nicht mehr zu, stattdessen hakt sich sein Blick an den roten Strähnen in ihrem schwarzen Haar fest. Will sie auf jugendlich machen? In ihrem Alter?
Plötzlich sagt Frau Gasmann: «Ist alles in Ordnung? Sie wirken so unbeteiligt. Als seien Sie innerlich erfroren.»
Die Formulierung geht ihm durch und durch. Er fragt zurück: «Haben Sie etwas an meiner Arbeit auszusetzen?»
«Nein», sagt sie ganz und gar rosig. «Ich mache mir Sorgen.»
Aber wie sie seinem Blick ausweicht. Sie weiß, dass es ihr nicht zusteht, sich Sorgen um ihn zu machen. Sie will ihn wohl manipulieren. Das muss es sein. Warum würde sie sonst ihre Energie auf die Empfindungen anderer Menschen verschwenden?
«Werden Sie nicht dafür bezahlt, dass Sie die Arbeit beaufsichtigen?», fragt er.
Sie guckt aus den Augenwinkeln, als ob ihm diese Bemerkung nicht zustünde, und blättert in seiner Akte. Aber er ist nun einmal Praktiker, er ist es gewohnt, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und man kann nicht «innerlich erfrieren». Die Körpertemperatur eines Menschen darf über den Tag maximal um zwei Grad schwanken, zwischen 35,8 und 37,2 Grad. Ansonsten muss er das untersuchen lassen. Eine Unterkühlung liegt ab 33 Grad vor, ab 27 Grad stirbt man. Das sind messbare Fakten. Außerdem ist die Temperatur an der Körperoberfläche für gewöhnlich geringer als im Körperinneren, nicht umgekehrt.
Ganz oben auf seiner Akte liegt sein Arbeitsvertrag als Pförtner im Werk 3.1, der alle Regeln enthält, die er mit der Firma vereinbart hat. Warum belässt es Frau Gasmann nicht dabei? Sie geben ihm Geld, damit er sich Nahrung kauft. In einem Stoffwechselprozess wandelt sein Körper die Nahrung in Energie um. Diese Energie setzt er für die Arbeit ein. Entsprechend dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik wird bei allen Energieumwandlungen immer ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt. Somit ist es unmöglich, innerlich zu erfrieren, solange man isst und arbeitet. Und für die Arbeit gibt es wiederum Geld und immer so weiter, bis Frau Gasmann oder er den Vertrag auflöst. Wozu also sentimental werden.
«Ja, dann danke ich Ihnen für das Gespräch», sagt Frau Gasmann. Und dann kommt noch ganz beiläufig eine Schönfärberei: «Wenn Sie nicht immer die Nachtschichten übernehmen würden, dann würde hier alles zusammenbrechen.»
Das rührt an etwas ganz Altem. Als würde ihm der Schorf von einer heilenden Wunde gerissen. Was weiß sie von ihm? Frau Gasmann redet von Dingen, die sie sich einbildet – und nennt es «sich Sorgen machen». Er merkt sofort, dass sie ihn mit ihrer Schmeichelei emotional manipulieren will. Warum will sie ihn mit einem Lob mobilisieren, obwohl er doch schon von selbst tut, was sonst niemand tun will, nämlich Nachtschichten übernehmen? Wozu darüber reden? Als ob die Firma nicht an jeder Ecke jemanden finden könnte, der Namen von Werksausweisen in Listen schreibt und Schranken öffnet. Nein, darum geht es der Gasmann nur vordergründig. Tatsächlich geht es ihr um Macht. Aber ihn wird sie mit ihrer vorgetäuschten Empathie nicht um den Finger wickeln. Ihn nicht. Er macht nur, was er machen muss.
Bei der Kripo in der Keithstraße 30 läuft auch am Nachmittag noch die Zentralheizung auf Hochtouren. Die sechste Mordkommission hat sich in ihr gemütliches Büro zurückgezogen, in dem es nach Lavendel, Salbei und Beifuß riecht. Eine Räucherstäbchenmischung gegen schlechte Energien. Rosi hat noch schnell ein zweites Räucherbündel angebrannt und verglimmen lassen. Der Rauch löst energetische Blockaden und schafft eine harmonische Arbeitsatmosphäre von tiefgehender Klarheit. Findet sie. Die Meinungen darüber gehen auseinander. Harry Engländer scherzt regelmäßig, dass Rosi das Dienstgebäude abfackeln wolle. «Das sind so die Methoden der weiblichen Kriminalpolizei», ätzt er. Rocky, der Bürohund, beniest den reinigenden Rauch und sieht dabei niedlich aus.
Kappe mag Rosis Rituale. Er mag alles an Rosi. Fast alles. Ihre Selbstständigkeit irritiert ihn manchmal. Gut, sie ist zehn Jahre älter als er, sie sind nicht verheiratet, Rosi ist nicht nur bei der Kripo, sondern nebenbei auch eine exzellente Bluesgitarristin. Also eine Künstlerin.
Es berührt Kappe peinlich, aber er wünscht sich schon manchmal, sie würde sich mehr mit ihm abstimmen. Vielleicht hat er nicht richtig zugehört? Jedenfalls hat er genau gesehen, wie sie dem Chef heute früh unauffällig ein Papier zugesteckt hat. Und jetzt hockt sie drüben bei Harry Engländer im Büro.
Neugier ist bei der Kripo ja eine Berufskrankheit. Und deshalb drückt Kappe sich jetzt auf dem leeren Flur im dritten Stock des Dienstgebäudes herum. Auf für einen altgedienten Beamten entwürdigende Art und Weise hat er sich hinter einen Aktenschrank neben der offenen Bürotür seines Chefs geschlichen. Wenn er den Hals lang genug macht und um den Türrahmen linst, kann er Rosis Locken, das Hippie-Blümchenkleid und die Hanfsandalen sehen. Vom Chef sieht er nur das Knie. Es wippt nervös.
«Also, Frau Habedank, habe ich Ihren Antrag richtig verstanden? Sie möchten sich vom Dienst befreien lassen?», keucht Engländer. «Das ist ja – das ist ja – da weiß ich jetzt nicht. Also – nein.»
Kappe hält die Luft an und krallt sich am Aktenschrank fest. Will Rosi weg aus Berlin?
«Schauens», hört er ihre ruhige, angenehme Stimme mit dem Hauch eines bayerischen Akzents sagen. «Ich bin ja jetzt scho 30 Jahre bei unserm Verein.»
Es knallt. Wahrscheinlich hat Engländer auf den Tisch gehauen. «Genau, meine Liebe, und beim Mord brauchen wir erfahrene Beamtinnen wie Sie.»
«Denkens nicht auch manchmal, wie das wär, ein erfülltes und rundum erfolgreiches, glückliches Leben zu führen?», sagt Rosi. Wow, analysiert Kappe als gelernter Psychologe. Jetzt geht’s richtig tief rein.
«Was gefällt Ihnen bei uns denn nicht, liebe, sehr verehrte Frau Habedank», schleimt Engländer. «Wir sind doch ein super Team hier, Sie und KOK Kappe sind sogar ein Paar und tun trotzdem gemeinsam Dienst, und sogar einen furchterregenden schwarzen Schäferhund habe ich Ihnen als Bürohund erlau–»
«Ich weiß, dass Sie hier Ihr Bestes geben, Herr Engländer», fällt Rosi ihm ins Wort, «und das spürt man auch als Mitarbeiterin. Ich fühle mich da scho geborgen. Ich backe Kekse für alle und koch Tee, des wissens ja. Sie sagens ja immer im Spaß: Was die weibliche Kriminalpolizei halt so macht.»
Harry Engländer räuspert sich nervös. Kappe ist ein bisschen stolz auf Rosis Arbeitsmoral. Das ist dem Chef wahrscheinlich auch noch nicht vorgekommen, dass eine Mitarbeiterin sich über zu wenig inhaltliche Aufgaben beschwert.
«Wir als K6 sind in der La-Belle-Sache außen vor geblieben», ergänzt Rosi. «Dabei hat Kappe jetzt vielleicht sogar eine Serie aufgedeckt.»
Kappe hört Harry Engländers Stöhnen. «Bitte hören Sie auf mit diesem Quatsch! Ich habe mich heute früh so dermaßen aufgeregt, dass nur noch Ihr Yogi-Tee mich vor einem Herzkasper bewahrt hat», sagt er. «Sie sehen also, Sie sind für mich un-abkömm-lich.»
Rosis Stimme wird sehr weich. «Ich kann den Kollegen Landsberger ins Ausräuchern und Teemachen einweisen. Kein Problem.»
«Ja, aber was wollen Sie denn mit so viel Freizeit, Frau Habedank? Ein Jahr Beurlaubung ohne Dienstbezüge? Sie, die Stütze unseres Kommissariats!?»
«Passens auf: Es geht um die Kultur.» Kappe, der schon einen Nebenbuhler gewittert hat, atmet in seinem Versteck tief durch. «Nächstes Jahr, 1987, wird in Berlin doch das 750-jährige Bestehen der Stadt gefeiert», fährt Rosi fort.
«Ja», stöhnt Engländer. «Uns bleibt auch nichts erspart! Was hatten wir schon alles hier in unserer Stadt – die Pest, die Cholera, die Hohenzollern, die Nazis, die Russen! Und jetzt, meine Liebe, jetzt auch noch so ein obskures Jubeljahr!»
«Das wird doll», freut sich Rosi. «Was es da alles an Veranstaltungen gibt!»
«Ach, Frau Habedank, das muss man aber kritisch sehen!», regt Engländer sich weiter auf. «Der Geburtstermin unserer Stadt wurde ja völlig willkürlich von Goebbels festgelegt! Auf irgendeiner Urkunde aus vergammelter Tierhaut soll im Jahr 1237 ein Pfarrer aus Cölln erwähnt worden sein. Cölln war ja im Mittelalter die Schwesterstadt von Berlin. Und da hat sich der Gauleiter gedacht: Super, 1936 hatten wir die Olympischen Spiele, da feiern wir 1937 gleich weiter, nämlich 700 Jahre Reichshauptstadt. Dann merkt das Volk gar nicht, was wir eigentlich Irres vorhaben.»
«Ach, das Datum kommt von den Nazis? Wusste ich gar nicht.» Rosi scharrt mit den Hanfsandalen.
«In Ost-Berlin kommt Gorbatschow zu Besuch und bei uns Ronald Reagan», sagt Engländer fest. «Das gibt wieder Ärger. Da brauchen wir Sie hier, Frau Habedank.»
«Keine Feier ohne Befreier!», lacht Rosi unsicher.
«Ich habe gehört, der neue Innensenator will jetzt endlich Nägel mit Köpfen machen. Das Festprogramm ist mit heißer Nadel gestrickt. Unter Heinrich Lummer stand ja noch nicht mal die Finanzierung, dem kamen die Geldschieber von Antes & Co. dazwischen und haben potenzielle Gönner verschreckt.»
«Geld zu uns nach Berlin zu geben, ist gerade wirklich nicht mehr in», seufzt Rosi.
«Ja, liebe Frau Habedank, beim Thema Berlin hat man in Bonn Angst vor Sumpfgeruch, aber auch Schamgefühle wegen der aufgedeckten Bestechungsskandale und Subventionsschwindeleien. Man hört, Diepgen will sich nicht mehr schämen müssen! Ein Witz, wenn Sie mich fragen. Die 750-Jahr-Feier ist zwar ein dubioses Fest, aber uns bleibt gar nichts anderes übrig, als das gut zu machen! Ost und West feiern ja quasi um die Wette. Ein Jahr Feuerwerk und Friedenstauben, dazu Turnfeste und Militärparaden, Jahrmärkte und Kunst en gros, aber auch Sackhüpfen für die Kleinen, es muss ja alles reibungslos ablaufen. Das abzusichern, ist ein gewaltiger Personalaufwand für die Polizei.»
Draußen hinter seinem Aktenschrank hört Kappe das Knistern von Zeitungsseiten. «Hier!», sagt Engländers Stimme. «Hier steht es in der Zeitung: ‚Der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen hat für die 365 Feiertage die Durchhalteparole ausgegeben, West-Berlin müsse 1987 brillieren und offerieren, animieren und musizieren, diskutieren und organisieren, räsonieren und sich strapazieren, koordinieren, konzentrieren, improvisieren und tolerieren, ein wenig renommieren, viel repräsentieren und schließlich triumphieren. ‹Wir wollen›, sagt er, ‹dass die Feier selbst ein historisches Ereignis wird, denn 750 Jahre Berlin sind nun mal mehr als 2.000 Jahre Posemuckel.› Da muss immer etwas los sein, meine Liebe! Sie wollen doch nicht etwa Heimaturlaub in Bayern machen?»
«Nein! Genau darum geht’s mir! Ich will dazu beitragen, dass immerzu was los ist», erklärt Rosi. «Sie wissen doch, dass ich in meiner Freizeit Gitarre spiele in der Outpost Blues Band.»
«Na, und wie Sie spielen, geradezu himmlisch, Frau Habedank!», antwortet Engländer. Kappe kann förmlich hören, wie der Chef seine Rosi anstrahlt.
«Ja, und da habens auch schon des Problem benannt, Chef: Wir sind gestern von Atze Brauner persönlich für seinen Opernball mit internationaler Schickeria gebucht worden – da liegen die Eintrittspreise bei 500 bis 1000 Mark!»
«Und jetzt wollen Sie sich freistellen lassen, weil Sie üben wollen oder wie, Frau Habedank? Das brauchen Sie nicht, Sie sind schon gut!»
«Ich bin einfach überfordert, Herr Engländer. Das geht über ein Hobby hinaus. Die Band ist das ganze nächste Jahr so gut gebucht, manchmal zweimal am selben Wochenende. Ende Juli zum Beispiel spielen wir bei der Grundsteinlegung für das Deutsche Historische Museum, anschließend beim Wasserkorso auf der Spree. Und dann zum Start der Tour de France auf dem Kurfürstendamm.»
«Darüber könnte ich mich auch aufregen», schnauft Engländer, und Kappe denkt zuerst, er meint Rosis angemeldete Nebentätigkeit. Aber weit gefehlt.
«Tour de France! Ein Skandal, dieses Radgefahre! Vier Millionen Mark lässt sich der Senat diesen Prolog kosten. Und wie finden wir Berliner das? Ein Rechtsanwalt hat schon im Auftrag von sieben Anwohnern beim Verwaltungsgericht eine einstweilige Anordnung gegen die Durchführung der Tour de France am 2. Juli in Kladow/Gatow beantragt. Stand gerade in einem internen Rundschreiben. Dieser Bereich muss nämlich drei Stunden vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Unter den Antragstellern sollen vier Ärzte sein, die befürchten, dass wegen der Abriegelung eine ärztliche Versorgung besonders in lebensbedrohlichen Situationen nicht möglich sein wird.»
«Da wollen wir immer Weltstadt sein, verhalten uns aber wie Kleinkleckersdorf», sagt Rosi.
«Ach, Kollegin Habedank, da müssen wir dann wieder ran, wir müssen einen Notfahrdienst einrichten, darauf läuft es doch hinaus! Ha, und dann müssen diese Pedaleure nach nur zwei Halbetappen zwischen dem Brandenburger Tor und den Havelauen ihre Tretmühlen wieder einpacken und zum Weiterstrampeln per Luftbrücke nach Karlsruhe geflogen werden – die Ossis verwehren ihnen nämlich die Durchfahrt. Da kommt man doch in Feierlaune!»
«Ein bissel was von den vier Millionen bekommt ja auch die Outpost Blues Band ab», erinnert Rosi den Chef. «So viel Aufmerksamkeit bekommt meine Band nie wieder. Das muss ich machen! Bitte verstehen Sie das doch, Herr Engländer!»
Kappe hört, wie der Chef überlegt und dabei mit dem Kugelschreiber schnipst und seinen Schuhabsatz hochfrequent auf das Laminat unter seinem Schreibtisch tippt. «Frau Habedank, ich sehe ja schon das Interesse der Stadt. Natürlich muss jemand die Musik machen bei der 750-Jahr-Feier. Aber Ihrem Antrag darf eigentlich nur entsprochen werden, wenn wir Ersatz für Sie finden.»
«Das schaffen Sie, Chef.»
«Das muss an höherer Stelle besprochen werden. Das müssen Sie bitte auch verstehen. Na gut, ich gebe den Antrag weiter, und dann geht es seinen geordneten Gang.»