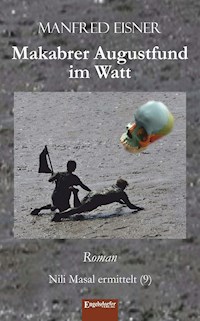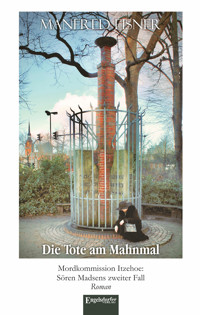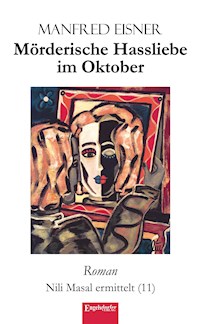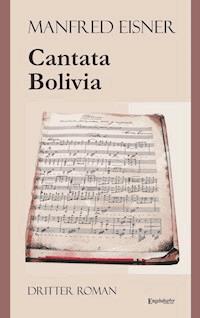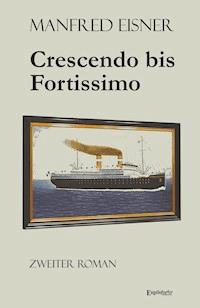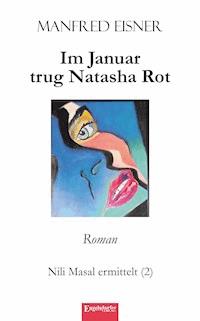Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
LKA-Sonderermittlerin Nili Masal und ihr Lebensgefährte Waldi Mohr – die eigentlich längst ihren Italienurlaub antreten wollten, jedoch aufgrund einer dort grassierenden Epidemie daran gehindert werden – verdingen ihre Ferienzeit in der Elbmarschen-Kleinstadt Oldenmoor, um ihre Kieler, Itzehoer und die örtlichen Kollegen bei der Aufklärung eines geheimnisvollen Doppelmordes in einem Jagdrevier zu unterstützen. Indizien führen in die obskure Welt der organisierten Kriminalität im Dunstkreis der Pharmaindustrie. Dank Nilis sprichwörtlichem Spurensinn vermag sie die Ermittler – nach zunächst im Sande gestrandeten Spuren – wieder auf Kurs zu bringen. Dieser nimmt die Leserinnen und Leser bis ins benachbarte Nordschleswig nach Dänemark mit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ai cari ed inolvidabili amici
Maria Carini ed Angioletto Aicardi a Canneto (Prelà)
comme ricordo
dei bellissimi tempi passati insieme nella
bella Liguria.
Manfred Eisner
KEIN SEPTEMBERURLAUB IN LIGURIEN
Roman
Nili Masal ermittelt (10)
Engelsdorfer VerlagLeipzig2021
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Das Foto auf dem Titelumschlag hat der Autor im Jahr 2010 im kleinen ligurischen Dorf Borghetta Canneto Soprano inmitten der Taggiasca-Olivenhaine im Valprino oberhalb von Imperia-Porto Maurizio aufgenommen – in freudiger Erinnerung an zwölf glückliche Jahre, die wir in unserem schönen Urlaubshäuschen in dieser idyllischen Gegend mit unseren lieben italienischen und deutschen Nachbarn verbringen durften. Wie schon des Öfteren an dieser Stelle erfolgte dankenswerterweise die fototechnische Bearbeitung durch Frau Rachel Hirsch, Ramat Gan, Israel. www.rachelhirsch-photography.com. Der Autor verdankt außerdem Herrn Helmut Vaic aus Tschechien – www.outfit4events.de – die freundliche Überlassung der Replik des in der Abbildung eingefügten antiken Stilettos.
Copyright (2021) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
»Die Habgier der Menschen ist schier unersättlich: Bestünde der Erdball aus purem Gold, würden sie sich um eine Handvoll Erde bekriegen.«
[Unbekannte Quelle: Der Autor erinnert sich, den Aphorismus irgendwann in seiner Jugendzeit aufgeschnappt zu haben.]
»Niemand ist durch Zufall gut.
Die Tugend muss erlernt werden.«
[Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr. bis 65 n. Chr.), römischer Philosoph, Schriftsteller und Politiker. Selbsttötung auf Geheiß seines ehemaligen Schülers, Caesar Nero.]
»Zu spät ist es, in der Gefahr Rat zu suchen.«
[Pubilius Syrus (um 90–40 v. Chr.), römischer Moralist, Aphoristiker und Possenschreiber.]
»Die Management-Ebene in den Polizeibehörden kann sich nicht darauf berufen, dass nur einzelne Polizisten rechtsextremistische Einstellungen haben. Das Problem ist vor allem die Tatsache, dass sich Gruppen bilden könnten, wie etwa Chatgruppen. ›Ich gehe aber davon aus, das ist gefährlich, weil es Gruppendruck gibt und der Einzelne sich genötigt fühlt, mitzumachen.‹ Daher müssten Vorgesetzte wachsam sein. Zum Beispiel, indem sie Ton und Wortwahl in den Amtsstuben genau verfolgen – und dann gegebenenfalls eingreifen.«
[Hans Gerd Jaschke (* 1952), Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus – WDR-Interview 19.09.2020.]
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorwort: Unheilbarer Kontrapunkt
1. Morbus Chagas
2. Dreifacher Blattschuss
3. Ermittlungen
4. Erste Schlussfolgerungen
5. Aus Nilis Tagebuch
6. Alias Valentin Lazàr
7. Betriebsamer Urlaub
8. Apenrade
9. Schwarzer Freitag
10. Bingo!
11. Der Tatort
12. Scharade
13. Des Pudels Kern
Kulinarisches
Danksagung
Der Autor
Vorwort
Unheilbarer Kontrapunkt1
»Manfred Eisner, Jahrgang 1935, geboren in München, erlebte Kindheit und Jugend als Emigrant in Bolivien.« So lautet der Beginn des verkürzten Lebenslaufs, mit dem ich mich als Autor am Ende dieses Romans meinen Leser*innen vorstelle. Zu den unvergesslichen Höhepunkten meiner Kinderzeit gehören die auf der Hacienda Guayrapata meines Nennonkels in den subtropischen Yungas nahe La Paz verbrachten Schulferien, die ich gebührend im letzten Roman meiner Trilogie2 thematisiert habe. Ich muss acht oder neun Jahre alt gewesen sein, als mich während der Nacht eine Vinchuca – eine hinterlistige, drei bis vier Zentimeter lange tropische Wanzenart – biss und eine blutende Wunde auf meinem Arm hinterließ. Als ich dies in der Früh meldete, eilte Luisa Saavedra, eine unserer einheimischen Küchenangestellten, in mein Schlafzimmer und machte sich auf die gewissenhafte Suche nach der bösartigen Verursacherin. Tatsächlich gelang es ihr, das unheilvolle Ungeziefer nach einigem Stochern in den zahlreichen Rissen der gekalkten Adobewand auszumachen, es daraus hervorzuholen und sogleich zu zerdrücken, wobei seine aus mir geschröpfte Beute als großer roter Erinnerungsfleck auf dem weißen Hintergrund verblieb. Sogleich wurde der Leichnam der Übeltäterin in die Küche überführt und dort in einer Tonschale auf dem offenen Feuer zu Asche kremiert. Nachdem die Bisswunde mit Wasserstoffsuperoxyd gereinigt worden war, drückte Luisa ein wenig Blut heraus, verstreute darauf die Asche und setzte mir einen Verband, den ich während der nächsten drei Tage trug. Obwohl der brasilianische Arzt Carlos Chagas die nach ihm benannte Krankheit und deren Erreger Trypanosoma cruzi – der durch den Biss der blutgierigen Raubwanze auf Mensch und Tier übertragen wird – bereits 1909 entdeckt hatte, blieben sowohl dessen Erkenntnis als auch die Krankheit der davon am meisten gefährdeten südamerikanischen Bevölkerungen zur damaligen Zeit überwiegend unbekannt.
Ich weiß nicht, ob ich nur Glück hatte und besagte Vinchuca zufälligerweise keine Keimüberträgerin oder ob es Luisas couragierter Intervention zu verdanken war, dass ich vor dem Ausbruch der Morbus Chagas bewahrt wurde. Jedenfalls erfuhr auch ich erst viele, viele Jahre später bei einer meiner ersten Geschäftsreisen nach Brasilien Anfang der Achtzigerjahre des vorigen Jahrhunderts von der millionenfachen Erkrankung und den Zigtausend, die jährlich daran sterben. Denn eines steht leider fest: Obwohl heute bereits zwei Arzneimittel existieren, die zumindest eine Linderung der Symptome versprechen, gibt es bislang keine gezielte Therapie, die dem Erreger mit Sicherheit den Garaus macht. Man darf sich reinweg fragen, weshalb das so ist. »Honi soit qui mal y pense«3, könnte man durchaus antworten, denkt man an die betont üppige Kalkulationsmentalität der Pharmaindustrie und deren Gegenüberstellung von (ehrlich: tatsächlichem?) Forschungsaufwand versus Nutzen (sprich: den zu erwartenden Verkaufszahlen beziehungsweise dem Vermögensstand der betroffenen Behandlungszielgruppe). Da in den meist mit Chagas befallenen tropischen Regionen Südamerikas überwiegend bittere Not und Armut herrschen, bietet sich hier wohl kaum eine Chance für Serumhersteller, sich damit eine goldene Nase zu verdienen. Es sei denn …
Ja, die gegenwärtige Corona-Pandemie hat doch just bewiesen, dass es auch anders geht! Stehen potente Mäzene oder Behörden dahinter, die die Schaffenskraft der Arzneihersteller mit erheblichen, meist aus unseren Steuergeldern finanzierten Geldspritzen aktivieren, schaffen diese es sogar innerhalb unglaublich kurzer Zeit, wirksame Impfstoffe und wahrscheinlich ebensolche behandlungseffektive Medikamente aus den Forschungslaboren herbeizuzaubern! Hätten wir in Westeuropa nicht stets gut fundierte, aber leider ebenso von Irrglauben hervorgebrachte Bedenken und Scheinvorbehalte gegen eine ethisch sinnvolle, wissenschaftlich orientierte Genforschung, wäre es sicherlich noch schneller gegangen (siehe China und Russland!). Dennoch bleibt dieses Mirakel den potent-liquiden westlichen oder diktatorisch regierten östlichen und asiatischen Mächten vorbehalten, die entsprechend über die erforderlichen Geldmittel und/oder Machtbefugnisse verfügen. Gleiches bleibt wiederum jenen Ländern versagt, in denen sich Regierende und Regierungen lediglich turnusgemäß durch Wahlen oder Putsch ablösen, um sich an den öffentlichen Kassen selbst zu bereichern. Da verbleibt naturgemäß kein Geld, um kommerziellen Anreiz bei der Pharmaindustrie zu generieren.
Morbus Chagas erwähne ich hier nur als stellvertretendes Musterbild, denn kaum anders geschieht es mit einer endlosen Liste von aussichtslosen Krankheiten wie beispielsweise Dengue-Fieber, Morbus Crohn, Marburgsche Krankheit und zig anderen, bei denen – wenn überhaupt – Beschwerden zwar gemildert werden können, deren Ursachen jedoch bislang unheilbar bleiben.
Dennoch sollte man nicht nur den Stab der Gerechten über diese viel gescholtene Branche brechen. Seien wir vor allem froh und dankbar, dass diese heute für uns überhaupt existiert und – wie auch immer – Apotheken uns mit den von ihnen erzeugten, erforderlichen Medikamenten versorgen. Nicht zuletzt tragen Pharmaka auch erheblich zu der sich stets weiterentwickelnden Langlebigkeit bei. Undenkbar, wenn, wie bereits im Laufe der Menschheitsgeschichte des Öfteren geschehen, eine Pandemie ausgebrochen wäre, ohne dass wir auf ein rettendes Serum hätten hoffen dürfen! Und all jene, die so etwas gar nicht gerne hören mögen, aufgepasst: Den ersten zugelassenen Impfstoff und das bei uns bisher am häufigsten verabreichte Vakzin mit dem höchsten Wirkungsgrad verdanken wir dem Forschungsgeist eines Ehepaars mit Migrationshintergrund!
Umso ärgerlicher ist es, dass die besonders in Deutschland zugelassenen Gewinnmargen an vielen Arzneimitteln einen beachtlichen Sektor der organisierten Kriminalität dazu anlockt, diese nachzuahmen oder gar zu fälschen, um sie dann illegal in den Verkehr einzuschleusen. Ganze Fabriken in Ländern wie China, Pakistan, Bangladesch und Indien, aber auch in Osteuropa wurden mit mafiösen Geldern aus dem Boden gestampft, mit dem alleinigen Ziel, die akkreditierte Pharmabranche mit ihren falsifizierten Pseudomedikamenten zu infiltrieren.
Diese in letzter Zeit wiederholt aufgeflogenen Umtriebe – die nicht zuletzt bösartigen Anschlägen auf unser aller Gesundheit gleichkommen – habe ich als Leitmotiv für diesen Roman gewählt. Allerdings, wie im Vorworttitel angedeutet, gepaart mit einem genauso üblen Begleitthema, das eine eher noch bedrohlichere Gefahr für unsere Demokratie darstellt.
Als 1945 die siegreichen Alliierten das Naziregime niederwalzten und einige von deren Haupttätern – beileibe nicht alle! – ihre unmenschlichen Verbrechen infolge des Nürnberger Prozesses am Galgen büßten, hegte die restliche Welt die illusorische Hoffnung, dass damit der üble nationalsozialistische Ungeist besiegt und für alle Zeiten in einem ehernen Verlies gebannt sei. Doch bereits kurz nach der Kapitulation ließ man den überwiegenden Rest der Übeltäter ungeschoren davonkommen, untertauchen oder gar, nach einer lächerlichen, ›Entnazifizierung‹ genannten Gesinnungs-Reinwaschung wieder gewähren, meinte man doch, aus ehemaligen Mitläufern nun ehrbare Bürger gemacht zu haben. Zu all denen kamen jene ›nützlichen Täter‹, die zwar über blutige Hände, gleichzeitig aber über besondere Fähigkeiten und einiges an Wissen verfügten und die sich die nun feindlich gesinnten Sieger im folgenden Gegeneinander zunutze machen wollten. Aber auch in unserer neu geschaffenen Bundesrepublik infizierten diese Elemente Justiz- und Beamtenapparat oder bildeten jene rechtsextremen politischen Parteien und Gruppierungen, die trotz deren wiederholter Namensänderungen bis zum heutigen Tage ihr elendes völkisches Gedankengut pflegen.
Was mich zu der grundsätzlichen Frage führt, weshalb eigentlich die semantisch widersinnige Einteilung in links- beziehungsweise rechtsorientierte Ideologien und Parteien auch heute noch allgemeingültig sein soll. Ursprünglich führt sie zurück auf die Sitzordnung der französischen Abgeordnetenkammer der Nationalversammlung von 1814: Von der Mittelachse aus betrachtet – dem Sitz des Präsidenten –, befanden sich rechts jene (konservative) Parteien, die die gegenwärtigen Verhältnisse beibehalten wollten. Ihre (progressiven) Opponenten, die gesellschaftliche und/oder politische Veränderungen im Sinn hatten, saßen links davon. Von der Linguistik her erscheint diese Rechtslinks-Einteilung überhaupt nicht mehr zeitgemäß: ›Recht‹ bedeutet seit jeher ›Gesetzmäßigkeit‹ und heißt demnach, man folgt strikt den demokratisch formulierten Vorschriften der Verfassung, also unserem Grundgesetz. Aber genau dies haben sogenannte ›Rechte‹ Ultras weder in der Vergangenheit je getan, noch befolgen sie es in der Gegenwart: Mit unlauteren Manövern und bösen verbalen Verunglimpfungen nebst Hasstiraden im Internet nötigen sie aufrichtige Demokraten und streuen absurde Verschwörungstheorien nebst perfiden Unwahrheiten, mit dem Ziel, die Bevölkerung zu verunsichern und unseren Staat zu destabilisieren. Da sind also ›Rechts-Extreme‹, die das Ziel verfolgen, gewaltsam linkische politische Veränderungen herbeiführen zu wollen! Hierzu begnügen sie sich neuerdings nicht mehr mit ernsthaftem Schikanieren und Verprügeln von Migranten und Kippaträgern; sogar vor Brandschatzung, kaltblütiger Ermordung von erklärten politischen Gegnern und gewaltsamen bewaffneten Überfällen auf Synagogen und Dönerläden wird nicht Halt gemacht!
Sicherlich hat nach Ende des furchtbaren Krieges eine überwiegende Mehrheit der anständigen Deutschen irgendwann sogar ihre Irrleitung durch die Perfidie von Hitler, Goebbels & Co. – wenn auch nach einer sehr langen Verdrängungsphase – zwar spät, aber immerhin erkannt und sogar bereut, ein Rest von schätzungsweise fünfzehn Prozent hingegen offensichtlich nicht. Wie sehr hatten wir darauf gesetzt und gehofft, dass mit dem Absterben der Nazigeneration auch der Morbus hitleriensis aus den Köpfen verschwunden sei und im Müllhaufen der Geschichte versenkt werde. Dies traf bedauerlicherweise nicht zu. Durch halbherzige Gesetze niedergedrückt und wohl auch wegen der allzu lang hinausgezögerten Bestrafung von KZ-Mördern – man stelle sich vor: Erst kürzlich (75 Jahre danach!) wurden einige über neunzig Jahre alte Täter vor Gericht gestellt – überlebte das latent bösartige Virus und fand erneut willkommenen Einlass in jene Hirne, in denen ein Vakuum von Anstand und Menschlichkeit überwiegt. Ja, zugegeben, die Bösewichter sind beileibe nicht nur unter uns, und auch ja, in der restlichen Welt gibt es sie ebenso, diese unverbesserlichen Nazis! Dies entschuldigt aber keineswegs die bisweilen nachlässige und leider auch gleichgültige Attitüde unserer Behörden und vor allem der Justiz, mit der sie bis vor Kurzem so manchem eklatanten Angriff begegnet sind. Sogenannte ›wissenschaftliche Studien‹ oder parlamentarische Untersuchungsausschüsse wegen Rechtsextremismus sammeln lediglich Beweise für einen weiß Gott allgemein bekannten lamentablen Zustand: Das gelegentlich eklatante Versagen von Geheimdiensten und Polizei in Sachen Bekämpfung von Terroristen, aber ebenso Prävention vor deren Attentaten, ist in der Tat besorgniserregend. Wie heißt es so schön? Wehret den Anfängen! Ein geflügelter Ausspruch, der in letzter Zeit aus vieler Munde gehört, auf Protestplakaten und Demos gezeigt sowie in zahlreichen Artikeln zitiert wurde. Die leidliche Erfahrung, dass die abgedroschene ›Beobachtung durch den Verfassungsschutz‹ einem erwiesenermaßen unwirksamen ›dolce fare niente‹ gleicht, bedeutet doch, dass hartes Zugreifen eher das Gebot der Stunde wäre! Erfreulicherweise scheinen dies neben unserer couragierten Verteidigungsministerin auch einige Landesinnenminister kapiert zu haben: Die längst fällig gewordene Auflösung der rechtslastigen zweiten Kompanie der KSK in der Bundeswehr sowie die über Bundesländer hinweg koordinierten Aushebungen von Unterkünften und Nestern dieser extremistisch radikalisierten Gefährder unserer Demokratie haben durch die mannigfaltigen Waffen-, Munitions- und Sprengstofffunde erwiesen, wie dringend notwendig solche Aktionen sind.
Weil allerdings, wie in den letzten Monaten wiederholt bekannt geworden, sogar unsere Ordnungshüter mit solch abartigen Individuen infiltriert sind, ist höchste Eile geboten, diesen Ungeist auszumerzen. Dennoch schließe ich mich voll und ganz den Worten unserer schleswig-holsteinischen Innenministerin an, die in einem Zeitungsartikel äußerte: »Ich bin überzeugt, dass sich unser Bild der weltoffenen Bürgerpolizei in den Werten und der Grundhaltung unserer Polizistinnen und Polizisten widerspiegelt.« Und es ist auch in diesem Sinne, in dem ich meine Krimis mit Nili Masal und ihren Mitstreitern verfasse. Dennoch sind, ebenso wie in den vorangegangenen neun Ermittlungsfolgen, auch die nachstehend geschilderten Geschehnisse sowie sämtliche darin vorkommende Namen und Positionen fantasiegeschuldet und von mir frei erfunden. Eine etwaige Übereinstimmung mit real existierenden Personen, deren Berufen, Dienstgraden oder den geschilderten Begebenheiten wäre rein zufällig.
Manfred Eisner, im Herbst 2021
1. Morbus Chagas
Ahnungslos schläft, inmitten von Bananenbäumen und den mit Cocasträuchern überwucherten Terrassen der Hacienda in den subtropischen Yungas, die kleine indigene Familie Pomacahua in der ärmlichen, strohgedeckten Adobehütte auf den direkt auf dem Erdboden liegenden, traditionellen grell gestreiften Teppichen aus Lama-Schurwolle. Mühelos und unbemerkt verschafft sich die hungrige Vinchuca 4 zwischen den Strohhalmen Einlass und krabbelt die Wand herunter, um ihren Stachel in der Wange des kleinen Ch’ama zu versenken und gierig dessen Blut zu saugen. Nachdem sich die Raubwanze satt gesogen hat, lässt sie von ihrem Opfer ab und verschwindet ebenso lautlos und verdeckt, wie sie eingedrungen ist. Als Reaktion tritt lediglich eine kleine entzündete Schwellung mit Rötung um die vom Insekt erzeugte Stichwunde auf, deren fatale Folgen zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen kann. Der Dreijährige leidet seit seiner Geburt an Unterernährung und Rachitismus. Wie bei zahlreichen Indiokindern in den ländlichen Regionen Boliviens ist dies der bittersten Armut sowie dem Mangel an ordentlichen Möglichkeiten zur adäquaten Lebensmittelversorgung geschuldet. Wegen der daraus resultierenden Abwehrschwäche tritt bei dem kleinen Jungen schon bald eine akute Phase mit hohem Fieber, Atemnot- und Krampfanfällen, Bauchschmerzen sowie Durchfall auf.
Hilflos und verlassen, sozusagen inmitten vom Niemandsland, ist die Familie Pomacahua, ebenso wie alle anderen Peones, jene geschundenen Landarbeiter, die für den in der neunzig Kilometer entfernten Großstadt La Paz residierenden Gutsherrn dessen Besitz beackern und für ihn die gewinnbringenden Cocablätter ernten, um sie anschließend in der Sonne zum Trocknen auszubreiten. Zuletzt pressen sie die Blätter in 25 Kilo schwere ›Taques‹, die Großsäcke, in denen sie vermarktet werden. Drei anstrengende Stunden Muli-Weg trennen sie dann von der mörderischen, einspurigen ungepflasterten Landstraße, die sich aufgrund der alljährlich wiederkehrenden Erdlawinen und zahlreicher abgestürzter Lkws und Busse ihren makabren Beinamen ›Camino de la Muerte‹ blutig verdient hat.
Die Straße verbindet die Regierungsresidenzstadt Boliviens La Paz mit dem Hauptort Chulumani in den südlichen Yungas, in dem sich die einzige klinische Einrichtung der Region befindet. Nach einigen Tagen entsetzlichen Leidens beschließen die Eltern, den schwer erkrankten Ch’ama in das dortige Hospital Municipal zu bringen. Liebevoll legt Mutter Josefa ihren Sprössling in einen mit einem wollenen Gewebe ausgelegten Korb, den Vater Mariano schließlich auf dem Satteldeckel seines Mulis mit roh gegerbten Rindlederriemen befestigt. Nachdem Josefa sich den zunächst mit Windeln und Reiseproviant gefüllten Aguayo5 um die Schultern gebunden und diesen vorn an der Brust fest verknotet hat, machen sie sich auf die lange Wanderung. Diese führt sie in langgezogenen ständigen Serpentinen auf holprigem Boden stets bergabwärts. Im Tal des wild fließenden Rio Tamampaya angelangt, folgen sie noch etwa achthundert Meter der Straße, bis sie an der kleinen Hütte Casa Blanca in Puente Villa angelangt sind, in der die Witwe Quispe die Pulpería, einen kleinen Kolonialwarenladen, betreibt. Hier lädt Mariano seinen Sohn vom Sattel ab und Josefa wickelt den abgemagerten und jammernden Kleinen neu, bevor sie ihn in ihren Aguayo einhüllt und sich diesen um die Schultern schwingt. Sie müssen nicht lange warten, bis sich der erste Camión nähert und auf ein Zeichen Marianos hin anhält. Zäh verhandelt der Vater mit dem Lkw-Chauffeur um einen möglichst niedrigen Fahrpreis. Ein junger Mann steigt vom Beifahrersitz, um Josefa und ihrem Ch’ama Platz zu machen, und klettert geschwind auf die Ladefläche. Traurig winkend verabschiedet sich Josefa von ihrem Ehemann, der sodann in der Pinte einkehrt, um sich einige Gläser Pisco hinter die Binde zu gießen.
Erst kurz vor Sonnenuntergang torkelt er auf die Straße und schwingt sich mühevoll auf den Sattel seines Mulis, um nach Hause zu reiten. Puente Villa ist sumpfiges Malariagebiet und er muss sich beeilen, so rasch wie möglich in höhere Regionen zu gelangen, in denen die Anofelesmücke nicht herumschwirrt.
*
Glubda Patak, ein kleines, dürres Männchen Mitte fünfzig mit einem weißen Haarkranz rund um die Glatze, ist Doktor der Chemie und hat an der Universität in Delhi promoviert. Er leitet das Versuchslabor in der Mumbai-Niederlassung der deutschen Firma Pharmasalutem, die in Indien ihr ›Wunderheilmittel‹ Haemodioxy für den Weltmarkt herstellen lässt und es von hier aus weltweit vertreibt, da es in der Bundesrepublik Deutschland nicht zugelassen ist. Hierzulande dürfen als Arzneimittel Produkte nur dann in den Handel gelangen, wenn durch ein behördliches Zulassungsverfahren ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis bestätigt wird. In Wahrheit ist die dubiose Substanz jedoch nichts anderes als MMS: ein kontrovers diagnostiziertes und viel diskutiertes Pseudomedikament, in der Fachwelt üblicherweise als ›Miracle Mineral Supplement‹ – frei übersetzt: ›Wunder-Mineralergänzung‹ – bezeichnet. Weltweit von mehreren Unternehmen mit zweifelhaftem Ruf hergestellt, erfolgt der Verkauf dieses bedenklichen Präparates und dessen Vertrieb zumeist über unqualifizierte Versorger und Spam-E-Mails im Internet. Was wird nicht alles diesem fragwürdigen Allheilmittel zugedichtet: Für AIDS, Hepatitis A, B und C, Malaria, Herpes, Tuberkulose, chronische Infektionen, die meisten Krebsformen und viele andere ernste Erkrankungen verspricht es eine Lösung; all diese sowie andere Virenkrankheiten lassen sich damit angeblich erfolgreich bekämpfen. Dabei ist der Wirkstoff kein anderer als das hochriskante Natriumchlorit – nicht zu verwechseln mit Natriumchlorid, unserem alltäglich verwendeten Kochsalz!
Aus Natriumchlorit und einer hinzugefügten verdünnten Säure entsteht Chlordioxid, das auf Haut und Schleimhaut je nach Konzentration reizend bis ätzend wirkt. Die Anwendung kann zu erheblichen Gesundheitsgefahren führen, einen nachweislichen Heileffekt hat sie allerdings nicht. Anders als ihre Mitbewerber, die das flüssige MMS üblicherweise in Zwei-Komponenten-Fläschchen vertreiben, ist es Pharmasalutem dank eines eigenen Verfahrens gelungen, die Substanz durch Zugabe eines besonderen, geheim gehaltenen Wirkstoffs als Pulver in einer einzigen Kapsel mit Langzeitwirkung zu vereinen. Es gibt sie in Dosierungen von 5, 10 und 20 Milligramm, ebenso aber auch als fertige Infusionsbeutel für den klinischen Betrieb.
Doktor Patak bereitet sich an diesem Tag auf hohen Besuch aus Bolivien vor: Der Oficial Mayor – vom Rang her ähnlich wie ein Staatssekretär – des Gesundheitsministeriums ist extra in Begleitung einiger enger Mitarbeiter aus La Paz angereist, um den Kaufvertrag mit der Pharmasalutem für die Lieferung einiger Zehntausend Kapselpackungen und Infusionsbeutel des Präparates abzuschließen. Dr. Dr. Alfred Pahl, Geschäftsführer, und Dr. pharm. Kurt Eisenmann, Vertriebsleiter der Kieler Muttergesellschaft, hatten dem bolivianischen Gesundheitsministerium das Produkt vor einigen Monaten als unfehlbares Heilmittel gegen die vorwiegend in den subtropischen Regionen der Republik grassierende Chagas-Krankheit angepriesen und deren Wirksamkeit zugesichert. Gegen die unter der Hand geleistete Zusage über die ›nützliche Beigabe‹ eines Nobelmarken-Cabrios für die Ehefrau des Herrn Minister wurde schließlich ein ›bilateral vorteilhaftes Geschäft‹ angebahnt.
Um die umständlichen EU-Ausfuhrmodalitäten für Arzneimittel zu umgehen, hatte man sich heimlich darauf geeinigt, das Haemodioxy aus der Produktion im indischen Zweigbetrieb zu liefern. In Wirklichkeit existiert überhaupt keine Herstellung dieser Arznei im Hauptwerk Bredenbeker Gewerbepark, denn hier fabriziert die Pharmasalutem andere, eher harmlose, aber ebenso zweifelhafte Nahrungsergänzungsmittel und fantasievolle Heilungserzeugnisse, die in vielversprechenden Anzeigen in der Regenbogenpresse beworben werden. Um jedoch den wahren Ursprung des Mittels zu verschleiern, sollten die Verpackungen für Bolivien den Aufdruck ›Produced in the EU‹ erhalten. Für das Vermeiden der in Deutschland anfallenden satten Gewinnversteuerung hatte die Muttergesellschaft ebenfalls vorgesorgt. So sollten die fälligen Euro-Zahlungen von einer Briefkastenfirma im steuergünstigeren irländischen Cork fakturiert und auf eines von deren Konten überwiesen werden – eben EU.
Die hochkarätige bolivianische Delegation – Staatssekretär Vicente Amaru Mamani, der Leiter des nationalen Gesundheitsamtes, Dr. med. Alejandro Pacheco Ruiz, die Direktorin der bolivianischen Agentur für die Indigene Gesundheitsversorgung, Licenciada Rosa Angélica Choque de Rojas sowie ein Sicherheitsbeauftragter der politischen Polizei, Coronel Juan Carlos Bravo Cornejo, – wird am Flughafenterminal in Mumbai von den beiden deutschen Geschäftsleuten persönlich in Empfang genommen und in einer Stretchlimousine zum Taj Mahal Palace Hotel gefahren. Hier sollen sie sich erst einmal von dem langen und strapaziösen Flug erholen, bevor sie am nächsten Tag ein imposantes Pharmawerk im Chemie-Industriepark der gigantischen Metropole Indiens besichtigen – ein von den listigen Pharmasalutem-Bossen gemietetes Schauobjekt, das sie den Gästen als ihr eigenes vorgaukeln. Nach der feierlichen, von blumigen Reden begleiteten und mit einem Champagnerfrühstück gekrönten Vertragsunterschrift – beigesellt von der obligaten Übergabe von mit allerhand Barem gefüllten Umschlägen an die Käufer – wird am Abend der hocherfreuliche Anlass mit einem üppigen Galadiner im renommierten Peshawri-Restaurant gebührlich gefeiert.
Am nächsten Vormittag verabschieden Eisenmann und Patak die Gäste am Flughafen und fahren anschließend zu einem unscheinbar wirkenden kleineren Betrieb in Raingad, etwa 100 Kilometer von Mumbai entfernt. Der Werkleiter des Subunternehmens Maharashda Pharmaceuticals führt sie durch das eher prekär anmutende Fabrikgebäude, das inmitten eines Grünackers gelegen ist. Neben der überwiegend manuell durchgeführten Herstellungsprozedur beherbergt es einen in die Jahre gekommenen Maschinenpark, in dem die Dosierung und die Mischung der Komponenten für Haemodioxy sowie die Abfüllung des Pulvers in kleine, dunkelgrünweiße Kunststoffkapseln erfolgt. Diese werden dann in Zehnerblister geschweißt. Hier erfolgt zudem die Mischung der Infusionslösungen, die in 500 Milliliter fassende Kunststoff-Ecobags gefüllt und versiegelt und anschließend in dampfbeheizten Schränken sterilisiert werden. Deren Etikettierung und Endverpackung soll schließlich in einem Verpackungsbetrieb in Mumbai erfolgen. Bevor Kurt Eisenmann vier Stunden später ebenfalls seinen Rückflug nach Frankfurt antritt, erinnert ihn Patak an die baldige Zusendung der spanischen Textvorlage für die Beipackzettel, damit diese hier gedruckt und den Schachteln beigefügt werden können. Der erste Container mit der Lieferung soll in zwei Monaten im Hafen von Mumbai verladen werden.
*
Ayrton da Silva Santos hat seine vor drei Wochen an der Chagas-Krankheit verstorbene Ehefrau gerade noch mit dem letzten Ersparten beerdigen können. Und jetzt hat auch noch seine Hündin erneut einen Wurf von acht Nachkommen zur Welt gebracht. Der verarmte und zurzeit mal wieder arbeitslose Witwer und Vater von vier Kindern haust in einer Favela6 am Stadtrand des brasilianischen Recife. Nun weiß er sich und seiner darbenden Familie nicht anders zu helfen, als sieben der Welpen in einen Sack zu stecken und diesen in den Tragekorb seines Fahrrades zu legen. Mühevoll radelt er bis zum fünfzig Kilometer entfernten Strand von Muro Alto, um die jungen Hunde im Meer zu ertränken. Auf dem Fußweg zum Meeresufer fällt ihm einer der Welpen aus dem Sack. »Lass ihn einfach liegen«, murmelt Ayrton, erschöpft von der langen Fahrt, »der krepiert auch so.« Schritt für Schritt begibt er sich mit dem an der Hand herunterhängenden Sack den seicht abfallenden Sandstrand hinunter in das achtundzwanzig Grad warme Wasser. Als es ihm bis zur Taille reicht, verharrt er, den Blick starr auf den Horizont gerichtet, bis der letzte Jammerlaut verklungen ist. Dann entledigt er sich der toten Last, faltet den Sack zusammen und macht kehrt. Im Schatten einiger hochwachsender Palmen legt sich Ayrton in den Sand, bis die sengende Mittagshitze etwas abgeklungen ist. Dann macht er sich auf den langen Nachhauseweg.
*
Leise winselt der kleine Mischlingswelpe im dreißig Grad heißen Sand und ist kurz vor dem Verdursten.
»Schau mal, Papi, wie niedlich! Ist das nicht ein süßes Hündchen?« Ohne auf die Warnrufe des Vaters zu achten, rennt die achtjährige Isabel zu dem im Sand liegenden hilflosen Welpen, hebt ihn auf und streichelt ihn liebevoll.
Fluchend läuft ihr Vater, Achim Reiter, ihr hinterher. »Um Gottes willen, lass das doch, Kind! Wer weiß, was der für Krankheiten hat!« Er kommt zu spät, um den Kontakt zu verhindern. Bestürzt angesichts der Feststellung, dass das arme Tier kurz vor dem Verenden ist, keimt in ihm Mitleid auf. Rasch zieht er sein T-Shirt aus, greift nach dem Welpen und wickelt ihn darin ein. Dann sagt er: »Komm, Mausi, schnell! Wir müssen ihn zum Tierarzt bringen, sonst stirbt er!«
Eilig laufen beide zurück zur Straße, wo der gemietete Wagen steht. Achim Reiter wählt mit dem Handy das Pernambuco-Ressort an, die luxuriöse Pousada, in dem die Familie ihren dreiwöchigen Urlaub verbringt. Mit seinen wenigen Brocken Portugiesisch fragt er nach der Anschrift der am nächsten gelegenen Tierarztpraxis und gibt sie ins Navi ein. Nach kurzer Fahrt erreichen sie eine kleine Tierklinik am Rande der Stadt. Die Veterinärin nimmt sich des stark dehydrierten Welpen liebevoll an und setzt ihn an den Tropf. Bald öffnet er mühsam die Augen und wimmert leise.
Als ihr Achim Reiter radebrecht, dass sie das ausgesetzte Tier am Strand gefunden hätten, meint die Senhora Doctora: »Die Arme ist ja fast verhungert! Es ist ein kleines Mädchen und wurde viel zu früh von der Mutter getrennt. Ich gebe ihr jetzt erst einmal einige Spritzen, um sie wieder aufzupäppeln. Danach könnten wir sie mit Ersatzmilch ernähren, bis sie kräftig genug ist.
Wollen Sie tatsächlich die Kosten dafür übernehmen, Senhor Reiter? Ich meine, Sie sind doch hier im Urlaub und ich glaube nicht, dass Sie das Tier wirklich mit nach Deutschland nehmen wollen, oder? In diesem Fall kämen weitere Kosten für notwendige Schutzimpfungen und Gesundheitsatteste auf Sie zu. Das summiert sich leicht auf einige Hundert Euro. Dann müsste die Kleine auch noch einen Gesundheitschip implantiert bekommen. Wir können aber gern, wenn Sie mögen, all dies in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Tierheim für Sie erledigen.« Achim Reiter zuckt zusammen, als die Senhora Doctora ihm den geschätzten Endbetrag mit etwa fünfzehn- bis achtzehnhundert Euro nennt. Das übersteigt die veranschlagte Urlaubskasse erheblich.
»Bitte, Papi, wir können das süße Hündlein doch nicht so einfach wieder weggeben!«, fleht ihn Isabel mit dicken Tränen in den Augen an, nachdem er ihr berichtet hat, was da alles auf sie zukäme, wenn sie den Welpen behalten wollten. Dass man das Hundebaby ansonsten einschläfern würde, hat er ihr sorgfältig vorenthalten. Brasilianische Tierheime, so hat ihm die Tierärztin erzählt, sind mit wahren Horden von herrenlosen und streunenden Tieren überfüllt, da sei kein Platz mehr.
»Bitte, bitte! Ich will meine kleine Mona mit nach Hause nehmen! Ich verspreche dir, mich um sie zu kümmern.« Als Isabel bemerkt, dass ihr Vater im Begriff ist, ihr eine Absage zu erteilen, fährt sie verzweifelt weinend fort: »Auch Heiner wird sich sicher freuen, denn er wollte doch immer schon einen Hund haben!«
»Also gut«, lenkt Achim Reiter ein, »ein Vorschlag zum Kompromiss, Mausi. Ich sehe, du hast ihr schon einen hübschen Namen gegeben. Wir lassen Mona jetzt erst einmal hier, damit sie gut versorgt ist, und fahren zurück ins Hotel. Dort besprechen wir alles mit Mami; mal sehen, was sie meint. Wir müssen auch noch bei der Reiseagentur nachfragen, wie das mit dem Rückflug werden soll, nicht wahr? Und dann kommen wir morgen wieder und berichten der Frau Doktor, einverstanden?«
Isabel nickt erleichtert.
Ihr Vater will ihr gerade die Tränen aus den Augen wischen, da interveniert die Ärztin. Sie folgen zugleich ihrer Empfehlung und waschen sich zunächst gründlich die Hände mit medizinischer Seife und desinfizieren sie anschließend.
»Das Shirt lassen Sie am besten hier, Senhor, das ist gesünder!«, sagt sie mit einem vielsagenden Lächeln und wirft Achim Reiters T-Shirt in den Abfalleimer. Mit der Zusicherung, am nächsten Tag endgültig Bescheid zu geben, was aus dem Welpen werden soll, hinterlässt er der Ärztin nebst ihrer Adresse in der Pousada Pernambuco die vier Fünfzig-Euro-Scheine, die er im Portemonnaie bei sich trägt.
*
»Hilfe, Karl-Friedrich, komm bitte sofort runter, hier ist etwas Furchtbares passiert!«, kreischt Margarethe, Ehefrau des Stararchitekten Wedekind. Beim Betreten der Küche hat sie soeben ihre peruanische Haushaltshilfe Felipa regungslos auf dem Boden vorgefunden. Ein kleines Blutrinnsal fließt ihr aus dem Mund, starke Zuckungen verkrampfen ab und zu den mageren, kleinwüchsigen Körper. Mit lautem Gepolter stürmt der wuchtige Mann die Treppe herab und durchquert eilig Salon, Esszimmer und den breiten Flur der geräumigen Nobelvilla in Hamburg-Volksdorf. Bestürzt blickt er über die Schulter seiner Frau, die sich augenblicklich in seine Arme flüchtet.
»Beruhige dich, Margarethe, ich rufe gleich die 112. Der Notarzt wird sich schon um sie kümmern.« Als er versucht, sich aus ihrer Umarmung zu lösen, um in der Tasche nach seinem Handy zu greifen, bremst ihn seine Frau, indem sie ihn noch fester umklammert. »Halt«, schreit sie, »das kannst du nicht machen! Die werden unangenehme Fragen stellen. Filipa ist doch eine Illegale und nicht ordnungsgemäß bei uns gemeldet. Bestimmt kriegen wir großen Ärger!«
»Was willst du denn sonst tun? Du siehst doch, die stirbt uns gleich unter den Händen weg! Denkst du nicht, das wäre noch viel schlimmer?« Ohne eine Reaktion abzuwarten, spricht er weiter. »An derartige Konsequenzen hättest du vorher denken müssen. Ich war immer dagegen, sie einzustellen und noch dazu bei uns wohnen zu lassen, aber du wolltest ja nicht auf mich hören!« Mit sanftem Druck befreit er sich aus der panikartigen Umklammerung seiner Frau und geht hinaus, um den Rettungswagen zu rufen. Wenig später kehrt er mit Sitzkissen und einer Decke für die Notleidende in die Küche zurück. Margarethe hat Felipa inzwischen mit einem feucht-kalten Handtuch das Gesicht gesäubert.
Die junge Frau öffnet mit dankbarem Blick für einen Moment die Augen, um sogleich wieder in tiefe Bewusslosigkeit zu versinken.
Eine Viertelstunde später legen zwei Sanitäter und der Notarzt die kranke Frau auf eine Trage, nachdem sie die ersten Untersuchungen durchgeführt und ihr einen Venentropf angebracht haben.
»Es scheint sich um starke innere Blutungen zu handeln, die sehr wahrscheinlich von einer zunächst hier nicht so leicht identifizierbaren Virusinfektion verursacht wurden«, diagnostiziert der Notarzt, ein äußerst sympathischer jüngerer Mann mit offensichtlichem lateinamerikanischem Migrationshintergrund. Während die beiden Sanitäter, die sich auf seine Anordnung hin im Vorfeld besondere Schutzkleidung überziehen mussten, die Trage mit der Erkrankten zum Rettungswagen hinausbringen, stellt er sich vor: »Mein Name ist Doktor med. Angelino Mendez Pizarro. Ich stamme aus Paraguay und lebe seit meinem zweiten Lebensjahr in Deutschland, wo meine Familie Ende der Achtzigerjahre aufgrund der politischen Verfolgung durch den Diktator Alfredo Stroessner Asyl gewährt wurde. Ebenso wie mein Vater, der ein leidenschaftlicher Arzt war, studierte ich an verschiedenen medizinischen Fakultäten in Deutschland und Spanien und promovierte am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Ohne die Patientin genauer untersucht und die notwendigen Analysen durchgeführt zu haben, kann ich keine endgültige Diagnose stellen. Sie wird deswegen vorsorglich in die Isolierstation ins Universitätskrankenhaus Eppendorf gebracht. Allerdings vermute ich angesichts ihrer Herkunft und des vorgefundenen Krankheitsbildes, dass sie sehr wahrscheinlich seit Längerem mit dem Parasiten Trypanosoma cruzi infiziert ist. Dabei handelt es sich um den Erreger der südamerikanischen Chagas-Krankheit. Ist Ihnen womöglich aufgefallen, dass Ihre Haushaltshilfe in der letzten Zeit des Öfteren unter Durchfall litt?« Als keine Reaktion kam, sprach Dr. Pizarro weiter. »Nein? Vielleicht war es ihr unangenehm, darüber zu reden. Jedenfalls müsste ich Sie vorerst ebenfalls unter Quarantäne stellen, bis man Sie entsprechend untersucht hat, um festzustellen, ob Sie sich angesteckt haben. So, jetzt brauche ich der Vollständigkeit halber noch die Daten der Patientin. Hätten Sie ihren Personalausweis oder einen Reisepass parat? Und können Sie mir sagen, wo sie krankenversichert ist?«
»Danke für Ihre umfassende Information, Herr Doktor«, sagte Karl-Friedrich Wedekind. »Sehen Sie, es gibt in der Tat ein ernsthaftes Problem, das wir besprechen sollten.« Verlegen fährt der Architekt fort: »Ich hoffe, Sie haben etwas Zeit für eine ausführliche Geschichte.«
Nachdem sich der Arzt beim Zentralen Gesundheitsdienst gemeldet und erfahren hat, dass momentan kein akuter Notfall vorliegt, willigt er ein und nimmt den Sesselplatz sowie die ihm angebotene Tasse Tee im Wohnzimmer dankend an. Wedekind erzählt ihm sodann, dass Felipa vor ungefähr sechs Monaten an ihrer Tür gestanden und um Hilfe gebettelt habe. Da er und seine Frau häufiger auf den Kanaren Urlaub machen, könne er einige Brocken Spanisch, sodass eine Verständigung mit dem Mädel möglich war. Sie baten sie herein und gaben ihr, weil sie offenbar ausgehungert war, zu essen und zu trinken. Total erschöpft sei sie über ihrem Teller eingeschlafen. Am nächsten Tag nannte sie ihren Namen, Felipa Gonzalez, und erzählte, sie sei zweiundzwanzig Jahre alt und stamme aus Iquitos, einer peruanischen Stadt am Amazonas. Schon in ihrer frühen Kindheit zur Waise geworden, war sie bei einer Tante aufgewachsen, die sie aber nicht in die Schule gehen ließ, sondern als Aschenputtel ausnutzte. Eines Tages sei sie aus dem Haus geflohen und irgendwie in die Fänge eines der vielen Sklavenschleuser geraten, die einen Haufen Geld mit Menschenschmuggel nach USA und Europa verdienten. In einem speziell mit einfachen Holzpritschen und Belüftung ausgerüsteten Container sei sie dann auf einem peruanischen Schiff zusammen mit zwei Dutzend anderen Leidensgenossen in sechsunddreißig Tagen von Callao in das spanische Algeciras gebracht worden. Ebenso wie die Zöllner in beiden Ländern war auch die Schiffsbesatzung bestochen worden, sodass sie in den Nachtstunden den Container für einige Stunden verlassen durften, um Bad und Toiletten zu nutzen und ihre Mahlzeiten einzunehmen. Nachdem der Container im Hafen von Algeciras abgeladen und auf einem Lastwagen in das 330 Kilometer entfernte Cordoba gebracht worden war, wurden dort die illegal ins Land gebrachten und praktisch anonymen Personen nach und nach ihren neuen Ausbeutern zugeführt. So sei sie als Kindermädchen zu einer reichen Familie in Sevilla gekommen. Dort habe man sie zwar nicht schlecht behandelt – sie bekam sogar ein kleines Zimmer auf dem Dachboden, Kleidung und ausreichend zu essen –, wurde aber praktisch wie eine Sklavin gehalten, erhielt also weder Gehalt oder freie Tage, noch durfte sie allein ausgehen. Als das ältere Zwillingspaar in den nahe gelegenen Kindergarten kam, musste Filipa die Kleinen dort morgens hinbringen und sie mittags wieder abholen. In der verbliebenen Zeit kümmerte sie sich auch noch um den jüngeren, zweijährigen Sohn der Familie. Bei ihren täglichen Wanderungen mit den Zwillingen lernte sie Luisa Espinoza, eine Leidensgenossin, kennen, die den Sprössling ihrer Herrschaft ebenfalls hin und her zu bringen hatte. Da beide in etwa den gleichen Weg hatten, freundeten sie sich mit der Zeit an und teilten sich gegenseitig ihr Leid mit. Irgendwann verriet Luisa der neuen Freundin, dass sie jemanden kennengelernt habe, der ihr die Flucht nach Deutschland ermöglichen wolle, damit sie ihren dort lebenden Bruder wiedersehe. Na ja, so meinte sie, der Preis dafür sei eine ›kleine Gefälligkeit‹, die sie ihm zu erweisen habe. Luisa fügte hinzu, sie habe schon mit so vielen Männern geschlafen, auf einen mehr oder weniger käme es ihr nicht an. Hauptsache, sie käme weg von hier. Da habe Felipa sie angebettelt, mitkommen zu dürfen, und Luisa versprach, mit ihrem Bekannten zu sprechen. Wenige Tage danach erhielt sie die erhoffte Nachricht, Luisas Amigo hätte zugesagt. Als der ersehnte Tag gekommen war, zog sie sich doppelte Kleidung an. Nach der ordnungsgemäßen Ablieferung ihrer Schützlinge am Kindergarten stiegen sie in den dort auf sie wartenden alten Seat ein und Alberto brachte sie zunächst zu einer hundert Kilometer entfernten Zitrusplantage, wo sie die Nacht im Arbeiterlager verbrachten. Auch Felipa musste als Fahrpreis eine ›kleine Gefälligkeit‹ entrichten. Um fünf Uhr morgens, während drei Lkws mit Orangen- und Clementinensteigen beladen wurden, kletterten sie in eine besonders präparierte Kiste, die äußerlich vom Rest der Ladung kaum zu unterscheiden war. Diese wurde zwischen die übrige Ladung gestellt. Neben zahlreichen Wasserflaschen, Brot und Wurstproviant mussten die beiden jungen Frauen darin die fünfundvierzig Stunden dauernde Fahrt zumeist im Sitzen verbringen. Nur während der gelegentlichen nächtlichen Stopps konnten sie sich zwischen der engen Ladung hindurchquetschen, um Luft zu schnappen und ihre Notdurft zu verrichten. Zwei Ländergrenzen inklusive der fälligen Zollkontrollen brachten sie hinter sich, ohne entdeckt zu werden. Als sie in Hamburg eintrafen, fuhr der Lastwagen zunächst in eine Lagerhalle am Stadtrand, wo die Tarnkiste entladen wurde, bevor der Wagen zum Großmarkt fuhr. Was den beiden blinden Passagieren allerdings entging, war, dass im Innern jener Sitze, auf denen sie während der gesamten Fahrt Platz gefunden hatten, fast hundert Kilo Kokain verborgen mitgereist waren. Diese waren turnusmäßig von Marokko nach Deutschland geschmuggelt worden. Das wurde jedoch erst einige Wochen später publik, nachdem die Hamburger Zollbehörde bei einer Routinedurchsuchung des Lkws fündig geworden war. Dabei waren ihnen zwei illegale Mitreisende aus Mali ins Netz gegangen.
Nachdem Luisa per Handy den Weg zur Wohnung ihres Bruders in Erfahrung gebracht hatte, machten sich die beiden jungen Frauen auf den Weg. Felipa kam dort zunächst unter, bis Luisas Bruder andeutete, dass sie sich um eine andere Bleibe bemühen müsse. Eine seiner Bekannten hatte auf die gleiche Weise in Eppendorf eine Familie gefunden, die sie einstellte. Felipa brauchte drei Tage, bis sie bei den Wedekinds läutete und ihr Margarethe aus »purem Mitleid und christlicher Nächstenliebe«, wie sie tunlichst am Rande bemerkte, Unterschlupf, Kost und Logis gewährte.
»Um Ihre letzte Frage zu beantworten, Herr Doktor, habe ich vorsorglich die wenigen Daten, über die ich verfüge, notiert: Felipa Gonzalez, zweiundzwanzig Jahre alt, geboren in Iquitos, Perú. Selbstverständlich komme ich für sämtliche Heil- und Medikamentenkosten auf. Hier haben Sie meine Visitenkarte.«
»In Ordnung, Herr Wedekind, das gebe ich so weiter. In Deutschland findet derzeit kein systematisches Screening bei Menschen mit einem epidemiologischen Risiko für eine Chagas-Infektion statt. Nur etwa ein Viertel der Infizierten zeigt akute Symptome wie Fieber, Durchfall und Lymphknotenvergrößerung, wie es bei Filipa der Fall ist. Im weiteren Verlauf kann es jedoch zu chronischen Schädigungen verschiedener Organe kommen. Dabei handelt es sich insbesondere um kardiale Komplikationen wie Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen sowie Herzkammervergrößerung. Wegen der geringen medizinischen Behandlungsmöglichkeiten ist die gesundheitliche Vorsorge besonders wichtig. Deswegen muss ich Sie auch inständig bitten, ab sofort das Haus nicht zu verlassen. Ich informiere das Gesundheitsamt entsprechend, das ist meine Pflicht. Man wird gegebenenfalls in Kürze auf Sie zukommen, um geeignete Maßnahmen zwecks Desinfektion zu treffen. Und vermeiden Sie bitte ab sofort jeden Kontakt mit anderen Menschen und auch Tieren, bis wir Gewissheit haben. Am besten, Sie waschen sich sofort sehr sorgfältig und ziehen sich um. Die getragenen Kleidungsstücke sollten Sie, sofern möglich, sehr heiß waschen oder in die chemische Reinigung geben. Zudem besprühen und reinigen Sie bitte alle Gegenstände, mit denen Felipa möglicherweise in Berührung gekommen ist, mit diesem Mittel.« Doktor Mendez stellt eine Sprayflasche auf den Tisch. Als sein Handy brummt, blickt er auf das Display und erhebt sich. »Also, ich muss dann mal wieder! Ich lasse Ihnen meine Karte da für den Fall, dass Sie noch Fragen haben. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen!«, sagt er, während er hinauseilt.