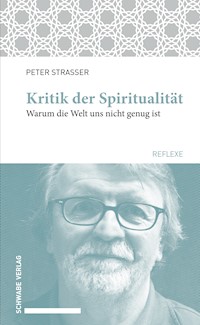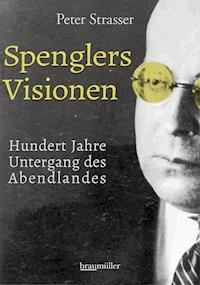Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Unruhe bewahren
- Sprache: Deutsch
Alle Philosophie beginnt damit, dass man sich ungesunde Gedanken macht. Dabei ist unser Philosoph kein freischaffender Irrwisch. Nein, er ist Beamter und lebt in einer bescheidenen Beamtenwohnung, im bereits historischen Status der Pragmatisierung. Als solcher wird er nicht müde, den jungen Menschen das Wesen seines Faches zu vermitteln: "Philosophieren heißt, sich erleichtern lernen!" Mit seinen Wegbegleitern, dem Vollmops Paul, den Meerschweinchen Fritzi & Fratzi und seinem Freund, dem Trottel, stolpert unser Liebhaber der Weisheit durch das Leben, verzittert, aber fest entschlossen, den täglichen Weltuntergängen die Stirn zu bieten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Strasser
Kein Tag ohne Erleichterung
Vorletzte Dinge,zusammengestellt von Astrid Kury, mit Zeichnungen von Fritz Panzer
Aus der Reihe »UNRUHE BEWAHREN«
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2012 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:
978-3-7017-4326-1
ISBN Printausgabe:
978-3-7017-1589-3
Inhalt
Vorwort
Kapitel I
Mein Leben aus den Löchern
Meine akuten Nobelpreissorgen
Was vor der Endzeit kommt
Der Jahreslauf meiner Kekse
Vorfälle der Besinnlichkeit
Kapitel II
Meeting der Christoholiker
Glaube – eine ignorierte Sucht?
Tschüss tschüssi tschüssilein
Die Posaunen von Mistelbach
Abbitten an Mistelbach
Meine Hoffnung: LO-Feng Shui
Ginggong im Haus der 5 Chakren
Das Humpeln des Dozenten
Der Untergang im Sommergarten
Festplatte mit Großem Bruder
Minarett mit Sahnehäubchen
Vom Elend, ein Humanist zu sein
Mehr höheres Deppentum!
Dienstag ist Hasitag
Denn Freitag ist Wiegetag!
Von Keksen und lachenden Kerlen
Kapitel III
Die Fussel von meiner Jacke
Morgengrausen des Beamten
Darf man Tauben Handys füttern?
Sicherheit? Nein, Sicherheut!
Medikamente kaufen, jetzt!
Familienrecht für Windelfurzer
Kapitel IV
An meiner Türe klopft man nicht!
Eiernudeln oder Padre-Pio-Teller?
Strasser, aber nicht der!
Warum der Teufel nicht schläft
Topfengolatschen des freien Willens
Herbstidyll mit Bus & Ego-Tunnel
Warum ich wen alles nicht lese
Die Innenministerin – eine Asylantin?
Kapitel V
Morgenstillleben mit Fettäuglein
Gott denkt uns immer noch
Vom Festhalten des Glücks
Glücksvogerln & Schutzengerln
Super, hoffen kann ich selber auch!
Abschiebung ins Zuckerlparadies
Pengpeng! Paffpaff! Brumsbrums!
»Wia des Liacht von obn owa durch de buntn Fensta follt«
Kapitel VI
Getuschel hinter meinem Rücken!
Wo vermutlich noch niemals jemand wirklich gewesen ist
Fragt sich nur, ob überhaupt noch etwas passieren könnte
Beantwortung der Frage, warum ich ein Meilenstein bin
Das hyperliberal verstopfte Wutbürger-Syndrom
»Du stehst auf was, und schon steht dir was«
Gelassenheit? Sofort zubeißen!
Zur Frage der Herkunft des Homo sapiens mopsiensis
Ich wär gern ein Lobbyist für saubere Hände
Liebet und vermehrt euch!
Friede den Vollmöpsen auf Erden
Erstes Opfer der adventlichen Reichenhatz
Wer alles hat eine Seele?
Kapitel VII
Warum ich im neuen Jahr schon glücklich gewesen bin
Adorno, Jelinek und meine getigerten Schmetterlinge
Keine Angst vor Staunässe beim Weltuntergang
Meine intimen Lichtwinkel des ganzen Welttumults
Vorwort
Als ich vor Jahren begann, wöchentlich Aufzeichnungen unter dem Titel Die vorletzten Dinge zu publizieren1, da dachte ich zunächst an eine Art Minima Moralia Austriaca – kleine Kommentare eines Österreichers zu österreichischen Moralitäten des Tages. Wir wissen ja, dass solche Tagesmoralitäten, wenn sie wirklich und wahrhaftig österreichisch sind, zugleich weltösterreichisch sein müssen, um nicht zu sagen: ewigkeitsösterreichisch.
Das wahrhaft Österreichische lässt sich gar nicht anders als unter dem Blickpunkt der Ewigkeit einigermaßen korrekt auf den Begriff bringen. Warum das so ist, wissen nur wir selber, und wir selber tun scheinheilig so, als ob wir keine Ahnung hätten. Wir sind eben ein kleines Land, aber ein A.E.I.O.U.-Land, eines von Gottes Gnaden und nicht, wie die Zeitgeschichtler seit 1955 kurzsichtig behaupten, eines von der Gnade irgendwelcher Alliierten.
Der Österreicher, um den es sich beim Autor der Vorletzten Dinge handelt, ist ein Beamter, der einen Amtsstatus beanspruchen darf, auf den das österreichische Beamtentum seit jeher besonders stolz war: die Pragmatisierung. Was das ist, lässt sich einem Nichtösterreicher kaum erklären, aber dazu besteht ohnehin kein Grund. Na, jedenfalls lehrt dieser Beamte in seiner Eigenschaft als Pragmatisierter an der Universität das Fach Philosophie. Er ist also, genau genommen, ein pragmatisierter Philosoph oder philosophisch Pragmatisierter. Damit verkörpert er einen Menschentyp, wie er österreichischer gar nicht sein könnte.
Ich rede von mir, und damit komme ich schon zum schlichteren Teil meiner einleitenden Petitessen. Als Kommentator und Moralist des Weltösterreichischen, das von Jeannine Schiller bis hinauf zum lieben Gott reicht, verschwand meine Person mehr und mehr hinter meinem – um diese großtuerische Formel ein einziges Mal zu bemühen – literarischen Ich. Der Autor der Vorletzten Dinge entwickelte zusehends ein Eigenleben, dessen Eigenbröteleien, vom Morgengrausen bis zu seiner Verehrung des Gesamtwerks von Rosamunde Pilcher (aber auch desjenigen von Heimito von Doderer), einen nachhaltigen Effekt auf die Leser zu haben schienen: Sie mochten das. Sie wollten mehr. Oder sie mochten das ganz und gar nicht, worüber hier kein weiteres Wort verloren werden soll.
Natürlich hätte sich dieser Sonderling, der darauf Wert legt, in einer bescheidenen Beamtenwohnung zu leben, nicht in die Herzen seiner Leser einschmeicheln können, wäre es ihm nicht gelungen, ihr Mitleid – und, wie leider zu vermuten, auch ihre Schadenfreude (aber, sei’s drum, ihre gutmütige) – zu erregen: Immer wieder muss er sich auf dem Notbett seines begehbaren Medikamentenschranks von den Strapazen des Alltags erholen, nicht ohne Unmengen von Tabletten, Zäpfchen, Tropfen und Salben zu konsumieren, namentlich ein famoses Produkt namens »Prontopax Forte«.
Vor allem aber stehen seinem besorgten Leben verlässlich einige liebenswerte Geschöpfe zur Seite, allen voran sein Vollmops Paul (der sich, schenken wir dem Gerücht Glauben, irgendwann aus einem Rollmops entwickelte), seine beiden Meerschweinchen Fritzi & Fratzi und, natürlich, sein Freund, der Trottel.
So also breitet sich das Leben vor ihm aus: als eine Zitterpartie. Verzittert, wie auf seifigen Dachgiebeln balancierend, begegnet er mitten im tiefen Österreich, trotz plötzlichen Harndrangs, Morgengrausens und gelegentlicher Vergessensattacken (»das wird mir gleich wieder einfallen«), dem Menschlich-Allzumenschlichen mit der immerwährenden Hoffnung des Nervenschwachen: Kein Tag ohne Erleichterung! Wenn das keine österreichische Vision ist …
(Graz, im Mai 2012)
1 Die erste Lieferung der gesammelten Vorletzten Dinge, meiner allwöchentlichen Feuilleton-Kolumne in der Zeitung Die Presse, erschien 2006 im Wiener Molden Verlag mit dem nicht übertriebenen Untertitel Weltuntergänge aus Österreich.
Kapitel I
Mein Leben aus den Löchern
Frage ich ihn, wer er sei, dann sagt er, er sei Erinnerungslochstopfer. Ich brauche ihn nur zu rufen, dann komme er. Er sei einer, auf den man sich verlassen könne. Immer habe er Nadel und Zwirn bereit, sozusagen. Sozusagen, das soll wohl heißen, bildlich gesprochen, oder? Frage ich ihn, was das sei, wofür er sozusagen Nadel und Zwirn benötige, dann antwortet er ohne Umschweife kryptisch: »Sie wissen es, rufen Sie mich bloß!«
Nun, eigentlich bestehe ich aus Löchern, Erinnerungslöchern, zwischen denen sich, kunterbunt durcheinander gewürfelt, selten schön zusammengefügt nach Vorher und Nachher, Ursache und Wirkung, kleine Ansammlungen von Erinnerungshäufchen finden. Manchmal schwebt da auch, mitten in einem riesigen Erinnerungsloch, wie ein schwaches Irrlicht im Dunkel der Nacht, eine insulare Reminiszenz. Ich habe keine Ahnung, woher sie kommt. Ich zermartere mir mein Gehirn, in welchem verflixten Zusammenhang ich sie mir eingefangen haben könnte: nichts, nur das Schweigen des Loches rundum.
Das kennen Sie doch, oder? Sie denken über Ihre Vergangenheit nach. Sind Sie etwa, in Ihren wilden jungen Jahren, für Väterchen Stalin gewesen? War Ihr Pferd beim BSA? Haben Sie den Schuh, den Sie seit Jahrzehnten vermissen, in einem Sumpf bei Hainburg verloren, als Sie das Mao-Lied Den Djinggangschan wieder hinauf intonierten? Fragen über Fragen und ein schier endloses Patchwork an Erinnerungslöchern, in die Sie hinein- und herausfallen. Das erinnert Sie, zack, an den Nowhere Man. Spielte den nicht Jürgen Prochnow in dem Film Das Hausboot? Oder war’s doch Yellow Submarine, die Serie über Japans U-Boot-Krieg? Während Sie so hin und her grübeln – ist jener Fluss damals wirklich der Djinggangschan gewesen? –, kommt Ihnen vor, Ihr verlorener Schuh sei irgendwann irgendwie irgendwo aufgetaucht.
Wo war das gleich? Jetzt kramen Sie in Ihren Erinnerungshäufchen, Schulzeit, Beruf, Ehe, Karriere, Kinder, Karriere, Freundin, Scheidung, Alimente, andere Freundin, andere Kinder, Lebensabend. Ach, wie die Zeit verfliegt! Und da ist er wieder, dieser verflixte Schuh. Er heißt jetzt, schenken Sie einer verlöschenden Erinnerungsspur am Rande eines superschwarzen Gedächtnisloches Glauben, der Schuh des Manitu. Ach, der gute alte Apachenhäuptling Abahachi! Sie wissen gar nicht, woher Sie den kennen. Das macht Sie stutzig, aber auch glücklich …
So ist es immer, sage ich mir und sage ich jetzt Ihnen. Am Ende kommt uns unser Leben so unglaublich, ja geradezu kosmisch einmalig vor, so überraschend, als ob wir’s gleich noch einmal angehen sollten. Wie herrlich alles kreuz und quer liegt. Nichts passt zusammen, und das, dieses Verquere, ergibt den hintergründigen Vorschein eines unvorstellbar abgründigen Sinns, der uns in allem, woran wir uns nicht erinnern, zauberhaft umstrickt. Und eben das ist der Grund, weshalb ich ihn nicht rufe, den Erinnerungslochstopfer. Seine Nadel und sein Zwirn, sie wären das Ende meiner Hoffnung, dass jemals etwas tiefer ging in meinem Leben als die kürzeste Naht von A nach B – sozusagen.
(6. September 2006)
Meine akuten Nobelpreissorgen
Andere lieben ihre Bibliothek, ich liebe meinen Medikamentenschrank. Das ist doch krank, oder? Deshalb würden mich meine verständnisvollsten Freunde, wenn sie mich heute sehen könnten – was sie hoffentlich nicht können –, dabei ertappen, wie ich in meinem Medikamentenschrank wühle, um meine Tabletten gegen meine akute Bibliotheksallergie zu finden. Meine Bibliothek ist ja eine meiner alten Lieben. Aber da ich nicht anders kann, als mir alle Bücher aller Nobelpreisträger zu kaufen, quillt meine Bibliothek seit Jahren mit Büchern über, die ich alle noch lesen muss.
Und dabei bin ich dauernd schrecklich im Verzug, ohne dass ich im Augenblick meine Tabletten gegen meine Nervosität wegen des dauernden Schrecklich-im-Verzug-Seins finde. Ich bin erst bei Jelineks Lust, ich bitte Sie, auch so eine Marotte, weil ich die Nobelpreisträger von vorne nach hinten lese, ich meine, zeitlich gesehen. Während alle ihren Grass schon seit Jahren durchhaben, weiß ich nur, dass er, nach einer ganz, ganz kurzen, fast vollständig bewusstlosen Zeit bei der Waffen-SS, das geniale Buch Die Rohrtrommel, nein Die Blechbommel – oder heißt es Die Rohrdommel? – geschrieben hat.
Egal, ich habe auch Tabletten gegen das Nobelpreisbüchertitelvergessen, nur finde ich sie gerade nicht. Stattdessen habe ich eben zwei Salben gegen die Vogelgrippe gefunden. Wo ist die übrigens geblieben? Die Salben sollen völlig wirkungslos sein, sagte mir erst neulich mein Lieblingssalbenarzt, weil ihr Ablaufdatum angeblich schneller ablief, als sie die Post befördern konnte. Ich habe keine Muße, das jetzt nachzuprüfen, denn alle Ablaufdaten sind auf allen Medikamenten so winzig aufgedruckt, dass ich sie nur mit meiner Medikamentenablaufdatumslupe, die mir irgendwo zwischen meine Nobelpreisbücher gerutscht ist, lesen kann.
Da ich im Moment außerstande bin, irgendwelche Tabletten, die zu meinen Leiden passen – ich bin mir ohnehin unsicher, um welche es sich zurzeit genau handelt –, in meinem Medikamentenschrank aufzustöbern, reibe ich mich prophylaktisch (Prophylaxe schadet nie, sagt mein Lieblingsprophylaxearzt) mehrfach abwechselnd mit der einen und der anderen Salbe gegen die Vogelgrippe ein, vor allem am Kopf. Aber ich verstehe noch immer nicht, wie die Heldin in Jelineks Lust, die von einem Lustgebirge an Mann über dem Badewannenrand immerfort aufs Lebensgefährlichste misshandelt wird, die ersten fünfzig Seiten des Buches überlebt.
Ich bin jetzt auf Seite 51. Wenn es gegen diese männlichen Lustgebirgsmisshandlungen nicht irgendwelche Medikamente gibt, wird die Heldin auf Seite 52 tot sein. Das ist eine meiner fixen Ideen, ach, so kann man doch nicht Jelinek lesen, oder? Ich habe noch 200 Seiten Heldinnenleid vor mir, das halte ich nicht aus, mein Entschluss steht fest: Ich lasse mir in meine bescheidene Beamtenwohnung einen begehbaren Medikamentenschrank einbauen, auch wenn ich dann, aus Platzgründen, meine Nobelpreisträgerbibliothek verschenken müsste!
(18. Oktober 2006)
Was vor der Endzeit kommt
November 2006, ich stehe am Fenster. Am Himmel das Abendrot, was hat das zu bedeuten? »Das bedeutet, Gott ist im Kommen«, sagt ohne hinzuschauen Walter Wittmann, der, obwohl schwer kurzsichtig, sich bei mir eingenistet hat, ich weiß gar nicht, wie. Wahrscheinlich so, dass er, seitdem er mit den Worten »Grüß Gott, ich bin Walter Wittmann, der Gottseher« durch meine Tür getreten ist, pausenlos meine Nahrungsvorräte dezimiert, während er in allem, was er verzehrt, angeblich mühelos Gott sieht, zuerst in meinem Frühstückskipferl samt Häferlkaffee, dann in meiner Mittagsvollkornpizza mit Diätmilch und jetzt in meinen Haferkeksen zum Nachmittagspfefferminztee.
Keine Frage, ich hätte ihn längst vor meine dreifach verriegelte Tür gesetzt, wäre nicht in dem Moment, in dem ich sie weit aufriss – eine unbedachte Handlung –, Fritz Nitschke grußlos schreiend über meine Schwelle geeilt, und zwar mit den Worten: »Ich bin Fritz Nitschke, der Antichrist!« Ja lebe ich denn im Irrenhaus? Seither sitzen der immerfort schreiende Nitschke, der zweifellos taub ist wie eine Nuss, und Wittmann, der maulwurfsblinde Gottseher, kauend und schluckend an meinem Tisch, vorausgesetzt, sie plündern nicht gerade meinen Kühlschrank. Und während Nitschke, der Antichrist, in den mir noch verbleibenden Lebensmittelreserven nichts weiter sieht als die ewige Wiederkehr des Immergleichen, das schreiend zu verzehren er sich keineswegs ziert, sieht Wittmann im Immergleichen die Fülle der Realpräsenz Gottes. »Mühelos«, sagt er.
Na schön, denke ich, herinnen das Irrenhaus und draußen das Abendrot. Was hat das zu bedeuten? »Das Kommen Gottes«? »Die Wiederkehr des Heiligen«? So lauten die Endzeittitel der Endzeitsymposien, auf denen ich demnächst referieren soll. Wird der Messias, zur letzten Schlacht gegürtet, aus den letzten Sonnenstrahlen brechen, um das Große Mahl Gottes zu vollziehen – ehrlich gesagt, mit reichen schon Wittmann und Nitschke –, oder ist der Endzeithimmel da draußen nur eine Mischung aus Smog und Föhn?
Zum Glück brauche ich diese Frage nicht zu beantworten. Denn während Paul, mein bewegungsarmer Vollmops, sich auf seinem Samtpolster schlafend stellt (er will zum Äußerlngehen nicht vor die Tür gehoben werden) und meine Meerschweinchen Fritzi & Fratzi in Erwartung ihres Abendhäppchens (frische Petersilie, in lauwarmem Wasser geschwenkt) aus ihrem vollen Futternapf heraus freudig quieken, sehe ich die samtweißen Blütenblätter meiner Orchidee am Fensterbrett im Gegenlicht rosa schimmern. Das ist schön, punktum.
Und als ich mich dann umdrehe, sind Wittmann und Nitschke verschwunden. Spurlos. Hell glänzt die Teekanne auf dem Tisch, meine Haferkekse ruhen still in sich. Auch das ist schön. Ich denke: »Es ist wie es ist, und es ist gut.« Gut genug jedenfalls für meinen Entschluss, weder über die Wiederkehr des Heiligen noch über das Kommen Gottes zu referieren. Denn vor der Endzeit kommt die Teezeit, und die ist jetzt. Und jetzt, so kommt mir jetzt vor, ist immer.
(22. November 2006)
Der Jahreslauf meiner Kekse
Bitte, wer sich für Sprengstoffattentate, schleppende Regierungsverhandlungen oder die kolportierten 800 000 Euro interessiert, die ein Grazer Exfußballvereinspräsident innerhalb eines Jahres am Rouletttisch verspielt haben soll, der kommt möglicherweise zur Ansicht, meine Bemühungen um meinen begehbaren Medikamentenschrank seien weltgeschichtlich belanglos. Was soll’s? Ich bin für das Häusliche.
Außerdem rennen mir jetzt, vor Weihnachten, Hellsichtige die Tür ein, um mich über Gott und das Ende der Welt zu informieren. Terror, Politik, Roulette, angeblich lauter Papperlapapp! Da ist ein gewisser Walter Wittmann, der, obwohl blind wie ein Maulwurf, in allen Dingen mühelos Gott sieht. Darauf kommt’s an, sagt er und setzt sich an meinen gedeckten Tisch. Er langt herzhaft zu, und zwar im Wettstreit mit einem gewissen Fritz Nitschke, der, über meine Schwelle eilend, sich mir als Antichrist zu erkennen gab. Zwischen Kauen und Schlucken schreit Nitschke – er ist taub wie eine Nuss –, die Endzeit stehe schon um mein Haus. Was soll’s, denke ich, ich habe nur eine biedere Beamtenwohnung.
Nachdem meine Nahrungsvorräte verschlungen sind – Wittmann sah in ihnen mühelos Gott, Nitschke hingegen nichts weiter als die ewige Wiederkehr des Immergleichen –, sind die beiden spurlos verschwunden. Ich denke vorschnell, ich sei sie los. Es ist gerade Teezeit, das macht mich übermütig, ich notiere mir mental den ersten Lehrsatz meiner Theologie der Häuslichkeit: »Vor der Endzeit kommt die Teezeit.« Doch dann höre ich Wittmann und Nitschke in meinem begehbaren Medikamentenschrank rumoren. Dort sind sie also unterkrochen, der blinde Gottseher und der taube Antichrist, um das »große Mahl Gottes« (Offb 19,17) zu vollziehen: eine Medikamentenverschlingung, na danke vielmals.
Was soll’s, denke ich, ich sitze bei meinem Nachmittagspfefferminztee und knabbere an meinen Haferkeksen. Paul, mein Vollmops, knabbert an seinem Hundetörtchen mit den lustigen Schlagobersöhrchen, während Fritzi & Fratzi, meine Meerschweinchen, an ihrer in lauwarmem Wasser geschwenkten Kräuselpetersilie knabbern. Das ist es, denke ich, wir knabbern. Was sich in meinem Medikamentenschrank abspielt, dieses apokalyptische Dramolett, was geht es mich an? Und erst die großen Dramen in der großen weiten Welt!
Ich habe ohnehin keine Ahnung, was das Ganze bedeutet. Ist es eine Komödie, ist es eine Tragödie? Der Anfang vom Ende oder das Ende vom Anfang? So sitze ich zu Hause in meiner Tee-Ecke und freue mich darauf, dass bald Weihnachten kommt. Zur Adventszeit glüht meine Ofenröhre. Ich backe Mürbteigkekse, denn die Haferkekse, die ich zu Ostern gebacken habe, stauben mir seit Allerheiligen bei den Ohren heraus. Die Mürbteigkekse (beliebte Ausstechmuster: Sterne, Engel, Mond) knabbern wir zu Heiligabend gemeinsam, mein Vollmops, meine Meerschweinchen und ich. In einer Dose gut verschlossen, bleiben sie dann weit übers Neujahr hinaus mürbe und beliebt, bis mich zu Ostern wieder der Hafer sticht …
(29. November 2006)
Vorfälle der Besinnlichkeit
Gerade habe ich meine dreizehnte Lage Weihnachtskekse aus dem Ofenrohr genommen, um sie bei einer Tasse dampfenden Pfefferminztees noch backwarm zu verkosten, da klingelt es an meiner Tür. Ich öffne, draußen steht ein mir völlig Unbekannter, dem die Augäpfel aus dem truthahnroten Kopf herausstehen, als ob sie mir gleich entgegenspringen wollten. Der Fremde schreit, dass mein Tinnitus, der bis jetzt adventlich vor sich hingezischt hatte, vor Aufregung mitkreischt: Besinnlichkeit! »Besinnlichkeit?«, denke ich, das muss eine neue Wohltätigkeitsorganisation sein, und zücke mein Geldbörsel.
»Wieviel?«, frage ich rasch, denn ich habe kein gutes Gefühl. Möglicherweise trifft den Besinnlichkeitsschreihals gleich der Schlag. Der aber reißt den Mund noch weiter auf, ich schaue in einen Abgrund, so wie der Mieter in Roman Polanskis Der Mieter, als er im Spital seine Vormieterin besucht, die aus dem Fenster gesprungen ist und nun, um den Kopf gewickelt, einen Totalverband trägt, der nichts freilässt außer ihrem Mund. Und aus dem Abgrund kommt dieser eine Schrei: Besinnlichkeit!