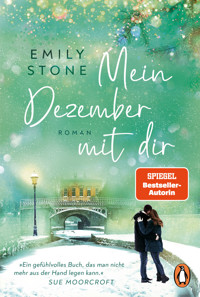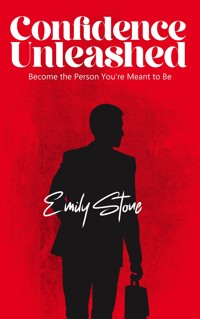9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein einziger Tag, der alles verändert. Eine Liebe, die allen Schicksalsschlägen trotzt.
An einem verschneiten Vormittag kurz vor Weihnachten begegnen sich Holly und Jack zum ersten Mal in einem kleinen Café. Holly spürt auf Anhieb diese besondere Verbindung zu dem Mann mit den undurchdringlichen braunen Augen. Eine Verbindung, die es nur einmal im Leben geben kann. Doch nur Stunden später bricht ein schrecklicher Schicksalsschlag über Holly und ihre Familie ein, und aus dem schönsten wird plötzlich der schlimmste aller Tage. Alles, was sie danach noch möchte, ist vergessen. Auch Jack und dieser wundervolle Moment mit ihm verblasst zu einer Erinnerung. Bis Holly ein Brief erreicht, dessen Zeilen ihre Zukunft für immer verändern könnten.
Ein hochemotionaler Roman, über die unvorhersehbaren Wendungen des Schicksals und eine Liebe, die immer einen Weg findet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Emily Stone lebt und arbeitet in Chepstow, Wales. Ihr gefühlvoller Debütroman Für immer im Dezember eroberte nicht nur die Herzen ihrer Leser*innen, sondern ebenfalls die SPIEGEL-Bestsellerliste. Auch ihr Roman Kein Winter ohne dich ist eine hochemotionale Lektüre über die große Liebe.
Begeisterte Stimmen über die Bücher von Emily Stone:
»Ein herzergreifendes, lebensbejahendes Buch, das sich wie eine Umarmung anfühlt.« Josie Silver
»Ein wirklich unvergesslicher und herzergreifender Roman.« USA Today
»Ein Winter-Bestseller zum Einkuscheln und einfach Dahinschmelzen.« Cellesche Zeitung
Außerdem von Emily Stone lieferbar:
Für immer im Dezember
Jedes Jahr im Winter
www.penguin-verlag.de
Emily Stone
Aus dem Englischen von Juliane Zaubitzer
Die Originalausgabe erschien 2023
unter dem Titel The Christmas Letter
bei Headline Review, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 der Originalausgabe by Emily Stone
Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Hanne Hammer
Covergestaltung: © Favoritbüro
Covermotive: © Shutterstock / Aleksandra Kossowska, lazyllama, f11photo, Woskresenskiy, FabrikaSimf, Di Studio, PROSKURINSERHII, Alexey Mumlev, Songquan Deng
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31774-4V002
www.penguin-verlag.de
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
Kapitel Eins
Kapitel zwei
3 Jahre später Dezember
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
März
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Juni
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
August
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Oktober
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreissig
Kapitel einunddreissig
Kapitel zweiunddreissig
Dezember
Kapitel dreiunddreissig
Kapitel vierunddreissig
Kapitel fünfunddreissig
Ein Jahr später
Kapitel sechsunddreissig
Dank
Sie wollen gleich weiterlesen? Unsere Empfehlungen für Sie…
Newsletter-Anmeldung
Serendipität
(Substantiv) glückliche Fügung des Schicksals – das zufällige Stolpern über etwas Gutes, ohne danach gesucht zu haben.
Kapitel Eins
Holly hielt den Blick auf die Straße gerichtet, die durch Nord Devon führte, während ihre Schwester den Kopf ans Fenster lehnte, die Augen geschlossen. Dabei sollte Lily sie eigentlich wach halten auf der langen Fahrt von London zu dem kleinen Ferienhaus im Nirgendwo, das ihre Eltern über Weihnachten gemietet hatten. Und gerade war Holly sehr müde. Trotz des kalten, feuchten Wetters war es im kleinen Fiesta ihrer Eltern mollig warm, die Dauerschleife der Weihnachtslieder im Radio lullte sie ein, und ihr traditionelles Wer bin ich?-Autospiel hatte sich längst erschöpft.
Und was war das überhaupt für eine Landstraße? Diese ganzen Kurven machten es unmöglich, mehr als vierzig Meilen pro Stunde zu fahren. Alles, was Holly jetzt wollte, war ein Kaffee, aber es war meilenweit keine Tankstelle in Sicht. Zugegeben, es war schön hier. Die Straße war zu beiden Seiten von Hecken gesäumt, die zu dieser Jahreszeit etwas kahl waren, aber im Frühjahr und Sommer zweifellos üppig grün, dahinter lagen unendliche Felder. Unter dem grauen Dezemberhimmel wirkte die Landschaft herrlich düster, fast ätherisch.
Am nächsten Ortsschild bog Holly rechts ab, woraufhin Lily sich aufsetzte und verschlafen blinzelte. »Was tust du?«
»Ich brauche Koffein. Ich halte irgendwo an.«
Lily rümpfte die Nase, aber das war ihr einziger Protest, als sie ins Dorf fuhren. Es war Heiligabend, und wie in London waren auch hier alle auf den Beinen, um ihre letzten Einkäufe zu erledigen. Die Straße, die Holly für die Hauptstraße hielt, war mit Weihnachtsbeleuchtung geschmückt, und ein riesiger Weihnachtsbaum stand auf der Grünfläche gegenüber von einem Uhrenturm. Eine Miniversion des Big Ben, dachte Holly und schnaubte leise.
Als sie kurz hinter dem Turm ein Café entdeckte, setzte sie den Blinker und hielt davor, woraufhin das Auto hinter ihr hupte.
Lily runzelte die Stirn. »Du kannst hier nicht anhalten – hier ist Parkverbot.«
»Ohne Koffein halte ich die restlichen fünfundvierzig Minuten nicht durch«, argumentierte Holly.
»Du wolltest doch die ganze Strecke fahren«, sagte Lily.
»Ich sage nicht, dass ich nicht fahren will, ich sage nur, dass ich Kaffee brauche. Außerdem«, fügte sie hinzu, »kannst du in deinem Zustand nicht fahren.« Sie tätschelte Lilys winzigen Babybauch, der sich gerade erst abzuzeichnen begann.
»Ich bin schwanger, nicht krank«, murmelte Lily.
»Kannst du nicht beides sein?«, fragte Holly zuckersüß, und Lily schlug ihr auf den Arm.
»Sei nett. Ich zahle.«
»Nur bis ich es dir zurückzahle.« Nicht, dass sie eine Ahnung hatte, wie sie das anstellen sollte. Sie hatte ihre Kreditkarte vergessen, als sie in letzter Minute aus dem Haus gestürmt war, weil sie es, laut Lily, nie lernen würde, pünktlich zu sein. Aber das tat eigentlich nichts zur Sache. Sie konnte sich diesen Familienausflug nicht leisten. Nachdem sie zwei Jahre lang vergeblich versucht hatte, als Künstlerin ihren Lebensunterhalt zu verdienen, hatte sie kapituliert und ihren Abschluss als Lehrerin gemacht, zur Erleichterung ihrer Eltern und ihrer vernünftigen Schwester. Doch bis sie als Lehrerin einen Job fand, musste sie wieder bei ihren Eltern wohnen und lag ihnen auf der Tasche.
»Du kannst hier nicht parken«, sagte Lily wieder und verkniff sich gerade noch ein leidgeprüftes Seufzen. »Der Vorderreifen steht auf einer doppelten gelben Linie.«
»Ach, das merkt doch keiner.«
»Holly«, sagte Lily mit ihrer verantwortungsbewussten Große-Schwester-Stimme. Aber Holly schaltete den Motor aus.
»Komm schon, es dauert nur zwei Minuten. Und schau mal, wie weihnachtlich es hier ist!«
Und das war es – draußen stand eine Kreidetafel mit einem handgemalten Schneemann und der Tageskarte, unter anderem einem köstlich klingenden Sandwich mit Camembert und Preiselbeeren. Über dem Eingang hingen Mistelzweige, und die Fenster schmückte silbernes Lametta. Um das niedrige Strohdach waren Lichterketten drapiert, die dem Lokal eine rustikale Atmosphäre verliehen: ein Ort, an dem man es sich mit einer heißen Schokolade und einem guten Buch gemütlich machen wollte. Weihnachten war immer Hollys Lieblingszeit im Jahr gewesen, doch es war nicht in erster Linie die weihnachtliche Atmosphäre des Cafés, die einen Sog auf Holly ausübte. Abgesehen davon, dass sie einfach nur einen Kaffee wollte, faszinierte sie der Name des Ladens: Impression Sunrise Café. Eine Anspielung auf Monets berühmtes Gemälde, und ein Café, das nach einem Kunstwerk benannt war, konnte nicht verkehrt sein.
Lily gab nach und folgte Holly, die Hände tief in den Manteltaschen, und Holly wünschte, sie hätte ihren Mantel aus dem Kofferraum geholt. Die beiden sahen sich so ähnlich, dass sie fast als Zwillinge durchgingen, obwohl sie vier Jahre auseinander waren. Das lag vor allem an den roten Haaren, wobei Hollys Mähne wilder war als Lilys – wahrscheinlich weil Lily ihr Haar gewissenhaft mit allen möglichen teuren Produkten zähmte, während Holly es höchstens mal zu einem Dutt zusammensteckte, wenn es sie nervte. Ich stehe zu meiner roten Mähne, hatte sie gesagt, als Lily sie vor der Abfahrt dazu bringen wollte, sie zu bürsten und zu glätten. Ich bin wie Arielle, die Meerjungfrau.
Nicht alle Rothaarigen können Arielle sein, hatte Lily geseufzt – obwohl sie beide als Kinder mehr als genug Arielle-Sprüche zu hören bekommen hatten. Und überhaupt, Arielle bürstet sich sehr wohl die Haare. Sie bürstet sie praktisch ununterbrochen, mit einer Gabel oder so.
Nun, wie du schon sagtest, nicht alle Rothaarigen können Arielle sein.
Aber es lag nicht nur an den Haaren. Sie hatten die gleichen Wangenknochen, das gleiche spitze Kinn, die gleichen gewölbten Augenbrauen (auch ohne sie zwanghaft zu zupfen, wie Lily es tat). Nur ihre Augen waren unterschiedlich – Lilys waren braun, Hollys dagegen auffallend grün.
Holly stieß die Tür des Cafés auf, ohne bei der Sache zu sein, denn sie wurde von einem wunderschönen Gemälde abgelenkt, das im Eingang hing und ihre ganze Aufmerksamkeit beanspruchte. Es war ein Regenwald, doch auf eine Weise dargestellt, wie sie es noch nie gesehen hatte – kühn und abstrakt, in leuchtenden Farben, die Leben schrien. Sie wollte es haben. Das war ihr erster Gedanke. Sie wollte es gegenüber von ihrem Bett aufhängen, um jeden Morgen mit diesem Bild aufzuwachen und etwas von seiner sprühenden Energie aufzusaugen. Ihr zweiter Gedanke war, dass sie recht gehabt hatte mit dem Café – nicht nur ein künstlerischer Name, sondern es gab auch echte Kunst und das war …
Der Gedanke wurde unterbrochen, als sie gegen eine alarmierend feste Brust prallte. Sie nahm den sauberen Duft eines frisch gewaschenen, gebügelten Hemds wahr sowie einen dunkleren, holzigen Geruch, bevor etwas Heißes ihren Arm hinunterlief. Sie schrie auf und riss ihren Arm zurück.
Sie fluchte laut, während gleichzeitig eine tiefe Stimme »Herrgott nochmal!« sagte. Etwas Schweres polterte zu Boden, zusammen mit zwei Kaffeebechern zum Mitnehmen.
Holly wich vor dem Fremden zurück, was dazu führte, dass sie auf der Flüssigkeit ausrutschte, die nun den Holzboden bedeckte. Sie fuchtelte mit den Armen in der Luft herum, fing sich aber gerade noch rechtzeitig und strich ihr Haar in einer wütenden Bewegung zurück, bevor sie in das Gesicht des Mannes blickte. Und Herr im Himmel, dieses Gesicht. Sie wollte dieses Gesicht nachformen. Es mit Ton zum Leben erwecken, die bestechenden Konturen einfangen, die markante Kieferpartie, die dunklen Augen, die Nase, die leicht schief war, was sie noch perfekter machte.
Alles an ihr kribbelte vor Verlegenheit. »Geht’s noch?«, rief sie, woraufhin einige Leute zu ihr hinübersahen, darunter auch die Frau hinterm Tresen, die gerade in einer Metallkanne Milch aufschäumte. »Sie hätten mich verbrennen können!« Nur ihr weihnachtlicher schwarzer Pullover mit dem Pailletten-Schriftzug Let Christmas Be-Gin auf der Vorderseite hatte ihre Haut vor dem kochend heißen Kaffee geschützt.
»Soll das ein Witz sein?«, rief der Mann aufgebracht. »Sie haben mich angerempelt! Passen Sie doch auf!« Er blickte auf den Boden, wo die beiden Kaffees – einer mit Milch, einer schwarz – definitiv nicht mehr zu retten waren. Seine Aktentasche lag ebenfalls dort, einer der Verschlüsse war aufgesprungen. Eine Aktentasche, echt? Wer schleppte an Heiligabend eine Aktentasche mit sich rum? Außerdem trug er einen Anzug – einen Anzug, der perfekt saß, wie sie nicht umhin konnte zu bemerken.
Holly schaute finster drein und öffnete den Mund, um zu widersprechen, ein Automatismus, aber da spürte sie eine Hand auf ihrem Arm. Es war Lily, die ihr einen strengen Blick zuwarf. Ein Blick, den sie nur zu gut kannte.
Holly zwang sich, tief durchzuatmen. Lily hatte recht. »Tut mir leid«, sagte sie unwirsch. »Ich habe nicht aufgepasst.« Ihre Worte klangen steif und unbeholfen.
»Offensichtlich«, murmelte er.
Obwohl ihr Jähzorn aufflammte und ihr schon die Worte Ich sagte doch, es tut mir leid! auf der Zunge lagen, spürte sie immer noch Lilys Blick. Also zwang sie sich, aufzublicken und dem Mann in die Augen zu sehen. Was ein Fehler war, denn es war unmöglich, sich von seinen braunen Augen – wie schwarzer Kaffee, dachte sie, obwohl dieser Vergleich vermutlich dem Ort geschuldet war – wieder loszureißen. Anders als ihre, die angeblich jedes ihrer Gefühle verrieten, wirkten seine absolut undurchdringlich.
Sein Kiefer war angespannt, als würde auch er sich die Worte verkneifen, die er ihr entgegenschleudern wollte. Und als er sich mit der Hand durchs Haar fuhr – dunkelbraune Locken, die seine Gesichtszüge betonten –, bemerkte sie die Kaffeeflecken auf seinem weißen Hemd. Ooops.
Sie rümpfte die Nase. »Tut mir wirklich leid. Ich war abgelenkt.« Sie deutete auf das Bild, und seine Miene wurde weicher.
»Ich mag das Bild auch. Es erinnert mich an … das Leben.« Er schnitt eine Grimasse, als hätte er etwas Dummes gesagt, und öffnete den Mund, um etwas anderes zu sagen, aber Holly unterbrach ihn.
»Ganz genau. Es ist so lebendig.« Sie zuckte hilflos die Schultern und spürte Lilys Blick, der sich in ihren Rücken brannte. »Ich konnte nicht wegsehen und …« Sie machte eine vage Geste, die sowohl ihn als auch den verschütteten Kaffee mit einbezog.
»Sie sind übrigens zu verkaufen. Die Bilder.« Er deutete auf die Wände des gut besuchten Cafés, an denen weitere Bilder hingen. Sie bezweifelte, dass sie sich jemals eines davon würde leisten können. Aber ein Café, das gleichzeitig eine Galerie war – das war schon cool.
Neben Holly räusperte sich Lily. »Ich hole uns was zu trinken, ja?«
»Nein«, sagte Holly, »du setzt dich hin. Ich hole die Getränke.«
Lily verzog das Gesicht. »Ich habe dir doch gesagt, ich bin nicht …«
»Setz dich«, wiederholte Holly streng, und Lily setzte sich seufzend an den nächsten freien Tisch – von denen es nicht viele gab. Auf jedem der Tische stand ein winziger Weihnachtsbaum mit einem Holzstern auf der Spitze, wie Holly jetzt sah. Niedlich.
»Sie ist nicht was?«, fragte der Mann.
»Nicht krank.«
»Oh. Gut zu wissen.«
»Hören Sie«, sagte Holly zu den Klängen von Last Christmas. »Ich kaufe Ihnen einen neuen Kaffee.« Sie warf einen Blick auf die Schweinerei auf dem Boden. »Beziehungsweise zwei. Und was Ihr Hemd angeht …« Sie rümpfte erneut die Nase, als sie es begutachtete. »Ich wünschte, ich hätte irgendein Wundermittel in der Handtasche, aber dem ist leider nicht so, daher denke ich, ehrlich gesagt, dass jede Hoffnung für das Hemd verloren ist.« Sie schnitt eine Grimasse. »Tut mir leid.«
Er lachte, und es klang offen. Seine tiefbraunen Augen wurden wärmer, sodass ihre Tiefen nicht mehr ganz so undurchdringlich wirkten. »Schon gut, ich habe noch eins im Auto.«
»Sie haben ein Ersatzhemd im Auto?«
»War doch schlau, oder?«
Sie konnte sich nicht vorstellen, jemals ein Ersatzirgendwas einzupacken, nur für den Fall – es hätte ein Maß an Organisation erfordert, dessen sie nicht fähig war. Sie war nicht mal sicher, ob sie genug saubere Unterwäsche für den Weihnachtstrip dabeihatte – sie hatte wahllos Sachen in den Koffer geworfen, während Lily sie zur Eile angetrieben hatte.
Sie fragte sich, was so wichtig war, dass er daran gedacht hatte, ein Ersatzhemd mitzunehmen – eine Hochzeit vielleicht? Seine Hochzeit? Nein, sicher nicht – wenn es seine Hochzeit wäre, würde er nicht hier mit ihr stehen; er wäre total aufgeregt und würde losrennen, um pünktlich in der Kirche zu sein.
Aber er hatte zwei Kaffee gekauft. War er verabredet? Ihr konnte es egal sein. Sie kannte nicht einmal seinen Namen, um Himmels willen, es sollte ihr völlig egal sein, ob er ein Date hatte.
Er hob seine Aktentasche auf, und gemeinsam gingen sie zum Tresen, wo die Bedienung überraschend ruhig und freundlich war, wenn man bedachte, wie viel Betrieb herrschte. War so das Leben auf dem Land? Keine Londoner Barista hatte Holly jemals so angelächelt.
»Was möchtet ihr haben?« Sie schob sich eine honigblonde Strähne hinters Ohr, sodass ein funkelnder Ohrring zum Vorschein kam.
»Ähh …« Holly sah den Mann an.
»Einen Americano und einen Hafermilch-Latte, bitte.«
Die Frau sah Holly erwartungsvoll an. »Und, ähm …«
Sie warf einen Blick auf die Specials. »Einen Zimt-Latte und einen Pfefferminztee.« Sie fand es zwar unsinnig, für Pfefferminztee zu bezahlen, aber Lily trank ihn in letzter Zeit eimerweise und weigerte sich sogar, koffeinfreien Kaffee zu trinken nur für den Fall, dass er schlecht fürs Baby wäre.
Holly betrachtete den Mann. Mit ihren eins achtundsiebzig fand sie sich selbst ziemlich groß, aber neben ihm kam sie sich klein vor. Das lag nicht nur an seiner Größe, sondern auch an der Art, wie er mit breiter Brust in seiner schwarzen Anzugjacke dastand und irgendwie Selbstbewusstsein ausstrahlte. »Ähm, kann ich Sie noch zu einem Stück Kuchen einladen oder so etwas? Als Wiedergutmachung?«
»Das müssen Sie nicht.«
»Ich möchte aber.«
»Na gut, dann …« Er ließ den Blick über die Auslage schweifen. »Der Schoko-Lebkuchenstern sieht ziemlich gut aus.« Das tat er wirklich, und so schön weihnachtlich. Genau das, wonach ihr auch der Sinn stand – allerdings gab es nur noch einen. Er lachte leise. »Den hätten Sie gern, nicht wahr?«
Offensichtlich hatte sie ihn wohl ein wenig sehnsüchtig betrachtet. Typisch.
»Nein, nein«, sagte sie schnell. »Er gehört Ihnen.« Dazu bestellte sie noch ein Stück Zitronentarte für Lily, die gerade ständig Heißhunger auf Zitronen hatte.
»Das macht dann £16,80, bitte«, sagte die Frau und lächelte wieder.
Erst da, nach einem kurzen Klaps auf ihre Jeans, fiel es ihr wieder ein. Sie schlug sich an die Stirn. »Oh Gott, ich habe meine Karte nicht dabei. Ich habe sie vergessen, als ich … Warten Sie hier«, sagte sie zu dem Fremden. »Ich frage meine Schwester. Augenblick.«
Sie drehte sich um und spürte, wie ihr Gesicht brannte – kein schöner Anblick bei einer Rothaarigen –, weil sie sich schämte, ihre große Schwester um Geld bitten zu müssen, doch er fasste sie am Arm. Nur ganz leicht, mit den Fingern, aber so, dass sie den Druck durch ihren Pullover spürte und sich an jedem Berührungspunkt eine wohlige Wärme ausbreitete.
Vergiss es, Holly.
»Schon gut. Ich zahle«, sagte er, und ihre Blicke trafen sich.
»Aber ich …«
Er gab der Frau seine Karte, bevor Holly protestieren konnte, und ihr Gesicht brannte noch mehr.
»Tut mir leid«, stöhnte sie. »Ich habe meine Karte zu Hause vergessen; ich musste mir von meiner Schwester schon Geld fürs Benzin leihen, und ich …«
»Schon gut. Ehrlich.«
Die Barista reichte ihnen Kaffee und Kuchen und ersparte Holly damit weitere Erklärungen. Sie gingen zum Ende des Tresens, um die Getränke aufzuteilen und der Warteschlange hinter ihnen Platz zu machen. Nachdem er in eine der braunen Papiertüten geschaut hatte, holte der Mann den Schoko-Lebkuchenstern heraus und hielt ihn hoch. »Sieht ziemlich gut aus, nicht wahr? Und riecht köstlich.«
Sie versuchte, sich nicht über die Stichelei zu ärgern – schließlich hatte er gerade für ihre Getränke bezahlt.
Dann verzog er den Mund zu einem Lächeln, teilte den Stern in der Mitte und reichte ihr eine Hälfte.
Sie sah ihn an. »Das kann ich nicht …«
»Klar können Sie. Sie bewahren mich vor einer Überdosis Zucker und Koffein.« Er hielt seine beiden Kaffeebecher hoch.
»Die sind beide für Sie?« War das Erleichterung, was sie da verspürte? Reiß dich zusammen, Holly!
»Ich fürchte, ja. Ich brauche den Kick heute, also kippe ich erst den Americano runter und genieße dann den Latte.«
»Wow. Das ist eine Menge Kaffee.«
»Genau. Ich brauche also keine weiteren Stimulanzien – sonst drehe ich noch total am Rad.«
Holly schnaubte stumm bei der Vorstellung, dass dieser sehr robuste Mann am Rad drehen könnte, aber sie nahm den offerierten Kuchen an. »Danke.«
Die nächsten Kunden rückten auf, deshalb wich Holly zurück – und stolperte geradewegs über die Aktentasche des Mannes. Der andere Verschluss sprang auf, und ein paar Papiere fielen heraus.
Holly stöhnte innerlich. Niemand war so ungeschickt wie sie. »Es tut mir so leid«, sagte sie und bückte sich, um die Papiere einzusammeln.
Er lachte, und es klang warm, ein wenig ansteckend. »Allmählich erkenne ich ein Muster.«
Holly reichte ihm einen Stift, der weggerollt war, hob dann eine Karte vom Boden auf und starrte sie an. Sie war wunderschön, ein Bild vom Meer, wie sie noch nie eins gesehen hatte – eine wirbelnde Masse aus Blau, Grau und Grün, die dem Wasser Leben einhauchte, die jede Welle irgendwie anders aussehen ließ, und gleichzeitig die Weite des Ozeans einfing. Die Kühnheit der Farben, der Formen erinnerte sie an das Regenwaldgemälde im Eingang des Cafés.
»Wie cool«, sagte sie zu ihm. »Ist das handgemalt? Ein Original? Ist es von Ihnen?« Er lachte wieder, und sie schüttelte den Kopf. »Zu viele Fragen, tut mir leid.«
»Ja, ja und nein«, sagte er und zählte ihre Fragen an den Fingern ab. Nach kurzem Zögern fügte er hinzu: »Ich habe es geschenkt bekommen, vor langer Zeit … Es stammt von einer hiesigen Künstlerin. Ein paar ihrer Werke hängen sogar hier.« Er zeigte zu den Wänden hin.
»Wie heißt sie? Die Künstlerin?«
»Mirabelle Landor.«
»Mirabelle Landor«, wiederholte Holly und versuchte sich den Namen einzuprägen.
Der Mann legte den Kopf schief. »Sie sind also Kunstliebhaberin?« Holly zuckte unverbindlich die Schultern. Sie traute sich nicht, sich als Künstlerin zu bezeichnen. Stand ihr dieser Titel wirklich zu, wenn sie nie Geld mit ihrer Kunst verdient hatte? Lily sagte, sie könne immer noch ihren Traum verfolgen, könne immer noch eine echte Künstlerin werden, was immer das heißen mochte. Aber für Holly fühlte es sich an, als hätte sie ihren Traum bereits aufgegeben, indem sie sich für den Lehrerberuf entschieden hatte. Nein, ermahnte sie sich. So durfte sie nicht denken – wer wusste, was das nächste Jahr bringen würde?
Holly betrachtete erneut die Karte und zeichnete eine der Wellen nach. Als sie wieder aufblickte, sah sie, dass der Mann sie beobachtete. Ein Lächeln umspielte seine Lippen, aber in seinen dunklen Augen lag noch etwas anderes, Tieferes. »Tut mir leid«, sagte sie schnell und gab sie ihm zurück.
»Das muss es nicht.« Er zögerte, dann griff er in seine Aktentasche und holte eine weitere Karte heraus. Diesmal war es ein Wald, eher golden und braun als grün, aber im selben Stil. »Hier.« Er drückte sie ihr in die Hand. »Sie ist von derselben Künstlerin. Die hier kann ich Ihnen nicht geben« – er hielt die Wellen hoch – »weil … Nun, einfach weil …«
»Sie müssen das nicht rechtfertigen!«, rief Holly beschämt. Und warum, um Himmels willen, wurde sie ständig rot? »Ich wollte nicht …«
»Ich weiß«, sagte er, seine Stimme war, im Gegensatz zu ihrer, vollkommen ruhig. Ruhig und hinreißend. Konnte eine Stimme hinreißend klingen? Sie konnte – so tief und weich und sanft, wie flüssige Schokolade. Aber dunkle Schokolade – köstlich und verlockend. »Aber die hier habe ich aus einer Laune heraus gekauft«, fuhr er fort, »in einem Laden auf dem Weg in die Stadt – und vielleicht habe ich es genau deshalb getan. Damit ich sie Ihnen schenken kann.« Es war eine alberne, romantische Vorstellung, das, was manche als Schicksal bezeichnen würden – woran Holly aber nicht glaubte. Trotzdem konnte sie nicht verhindern, dass ihr Herz ein wenig zu flattern begann.
Es fühlte sich unhöflich an, weiter zu protestieren, also nahm sie die Karte an. »Danke«, murmelte sie. »Ich … bin nicht seltsam. Es ist nur – ich will auch Künstlerin werden, und es ist cool, Leute zu sehen, die nicht superberühmt sind oder so und es trotzdem schaffen, und ich …« Sie unterbrach sich, weil sie das Gefühl hatte, sich endgültig um Kopf und Kragen zu reden.
»Ein Grund mehr, sie Ihnen zu schenken«, sagte er schlicht. Er schob die andere Karte zurück in seine Aktentasche. Sie war abgenutzt, wie sie jetzt bemerkte, die Ränder ausgefranst, und auf der Innenseite stand etwas geschrieben. Sie wollte fragen, von wem, aber sie tat es nicht – schließlich wusste sie immer noch, was sich gehörte.
»Ich bin Holly«, sagte sie stattdessen.
Er lächelte. »Und ich bin Jack.«
Kapitel zwei
So wie Jack sie jetzt ansah, war Holly froh, dass sie Lippenstift und die baumelnden Sternchen-Ohrringe trug. Sie schob sich eine Haarsträhne hinters Ohr. »Ah, und wo willst … du? …, Jack, heute hin, mit deinem Anzug und deiner Aktentasche?«
Er verzog das Gesicht. »Oh. Das ist eine … Familiensache.«
Bevor Holly weiterfragen konnte, ging der Timer auf seinem Handy, und sie zuckten beide zusammen. »Tut mir leid«, sagte er, während er ihn ausschaltete. »Ich muss los – mein Parkschein läuft gleich ab.«
»Dafür hast du einen Timer gestellt?«
Er lächelte ein wenig verlegen. »Nur zur Sicherheit.«
Holly lachte, irgendwie entzückt.
»Tut mir leid«, sagte Jack wieder. »Ich würde vielleicht sogar einen Strafzettel riskieren, um weiter mit dir zu reden, aber ich muss zu dieser …«
»Familiensache?«
»Genau.« Er zögerte. »Nächstes Mal gibst du den Kaffee aus.«
Holly neigte den Kopf. »Beziehungsweise vier Kaffee und einen halben Lebkuchen.«
Er grinste, und Holly konnte nicht anders, als ebenfalls zu grinsen.
Dann seufzte sie. »Ich schulde dir wirklich etwas, aber ich bin nicht von hier.« Wäre es sehr unpassend, wegen eines einzigen Gesprächs nach Devon zu ziehen?
»Super. Ich auch nicht.«
»Ich wohne momentan in London«, sagte Holly und zog die Augenbrauen hoch.
»Na, das passt ja, ich auch.« Das war kein Schicksal. Schicksal gab es nicht.
Jack holte einen Stift aus seiner Aktentasche und schrieb seine Nummer auf ihren Kaffeebecher. »So. Jetzt musst du mich anrufen – so fängt doch jede romantische Komödie an, oder? Als Nächstes stecken wir dann mitten in einer guten Story.«
Holly konnte sich gerade noch ein Schnauben verkneifen – Schnauben war nicht attraktiv. »Ich liebe gute Storys.«
»Ich auch«, sagte Jack, und obwohl er es augenzwinkernd sagte, wurde Holly schon wieder rot. Jack wandte sich zum Gehen, und Holly machte sich auf den Weg zu dem Tisch, an dem Lily saß.
»Nun, das hat länger gedauert als erwartet«, sagte Lily und warf Holly einen wissenden Blick zu.
»Er wollte nur höflich sein«, sagte Holly steif. Obwohl sie sich nicht verkneifen konnte, einen Blick über ihre Schulter zu werfen, um Jack nachzusehen, der das Café gerade verließ. Er hatte einen schönen Rücken, fand sie. Einen Rücken, den sie gern einmal ohne dieses Jackett sehen würde. Hör auf, Holly!
»Vielleicht bin ich da komisch«, sagte Lily gelassen, »aber ich gebe nie jemandem meine Nummer, nur um höflich zu sein.«
Holly blickte auf die Nummer, die auf ihren Kaffeebecher gekritzelt war. »Wahrscheinlich wird sowieso nichts daraus. Ich meine, ich kann ihn doch nicht wirklich anrufen, oder? Ich fange bald einen neuen Job an, ich muss umziehen und …«
»Und?«
»Und es ist kompliziert«, schloss Holly achselzuckend.
»Sieh mal«, sagte Lily und trank einen Schluck von ihrem Pfefferminztee, »ich hätte auch nie gedacht, dass ich Steve so kennenlernen würde, aber als ich ihm vor dem Club begegnet bin …«
»Eure Blicke trafen sich, und du wusstest, dass er der Richtige ist. Ich weiß, Lils, ich war dabei.«
»Ich mein ja nur … manchmal greift das Schicksal ein und man muss …«
»Ja, ja.« Holly mochte es nicht, wenn Lily die Schicksalskeule schwang – womit die Leute ihrer Meinung nach nur die schlechten Dinge im Leben rechtfertigen wollten. »Komm schon, lass uns gehen – machst du dir keine Sorgen wegen des Parkverbots?«
Lily verdrehte die Augen, stand aber auf. Holly wusste, dass es albern war – schließlich war Lily erst seit ein paar Monaten schwanger –, aber sie war in ständiger Sorge um sie.
Sie warf einen Blick auf Lilys Bauch. »Wie geht es meiner kleinen Talula? Saugt sie die ganze Weihnachtsatmosphäre in sich auf?«
Lily warf ihr einen Blick zu. »Es wird keine Talula. Das habe ich dir doch gesagt.«
»Tja, ich nenne sie aber so«, sagte Holly, als sie das Café verließen.
»Auch wenn sie ein Junge ist?«
»Ja, auch dann.«
»Damit machst du dich sicher beliebt bei ihr.«
»Pfft!« Holly winkte ab. »Als ob ich mir darüber Gedanken machen müsste – ich werde sowieso die Lieblingstante sein.«
»Weil du die einzige Tante bist.«
»Eben.« Sie versuchte es zu überspielen, aber in Wahrheit war Holly sehr aufgeregt, dass sie Tante wurde. Weit davon entfernt, an eigene Kinder zu denken, liebte sie die Vorstellung kleiner Nichten und Neffen, mit denen sie spielen konnte – und denen sie natürlich Unmengen von Malutensilien und Malbüchern kaufen würde. Sie arbeitete sogar schon an einer kleinen Skulptur, die sie ihm oder ihr am Tag der Geburt schenken wollte – eine kleine Giraffe, weil Lily Giraffen liebte, so klein, dass das Baby sie mit seinen kleinen Händen umklammern konnte, und in knalligen, kräftigen Farben, wie Elmer der Elefant.
Holly ließ den Motor an und drehte die Heizung auf, als sie ins Auto stiegen – hier unten war es eindeutig kälter als in London. Es war noch nicht mal vier Uhr nachmittags, wurde aber bereits dunkel, und kleine, trübe Regentropfen klebten an der Windschutzscheibe. Holly rümpfte die Nase – nicht gerade ideale Straßenbedingungen. Aber es waren nur fünfundvierzig Minuten, die schaffte sie auch im Dunkeln bei Regen.
Lily schnallte sich an, und ihr Blick fiel auf den Kaffeebecher, den Holly in den Getränkehalter gestellt hatte. »Ernsthaft, Holly, dieser Typ könnte der Richtige sein – du solltest ihm gleich eine Nachricht schicken.«
Holly verdrehte die Augen. »Ja, weil das gar nicht verzweifelt rüberkommen würde.«
»Diese Spielchen sind albern – wenn man jemanden mag, mag man ihn.«
»Sagt die glücklich verheiratete Frau, die sich darüber keine Gedanken mehr machen muss.«
»Dann speichere wenigstens seine Nummer.«
»Lily!« Holly justierte den Rückspiegel. Erst als sie die Scheinwerfer des Autos hinter sich sah, dachte sie daran, das Licht anzuschalten.
»Ich meine ja nur … Du beschwerst dich immer, dass du nie jemanden kennenlernst. Das ist der Grund – weil du kein Risiko eingehst, selbst wenn dir das Glück auf einem Kaffeebecher serviert wird.«
»Ich gehe sehr wohl Risiken ein«, sagte Holly und versuchte, nicht trotzig zu klingen. Und das tat sie auch – schließlich sagte sie meistens ja, wenn jemand sie um ein Date bat. Okay, sie war nicht auf den ganzen Apps, aber das war Lily auch nicht gewesen – mal ehrlich, welches Risiko war Lily denn schon groß eingegangen? Mit einundzwanzig hatte sie ihren Mann kennengelernt, fünf Jahre später geheiratet, zwei Jahre später war sie schwanger und auf dem besten Weg zur glücklichen Kleinfamilie. Und obwohl sie wusste, dass ihre Schwester aufrichtig versuchte, hilfreich zu sein, fühlte sie sich von Lily manchmal unter Druck gesetzt, möglichst schnell jemanden kennenzulernen und demselben Muster zu folgen. Doch sie schwieg – es würde nur im Streit enden, wenn sie mehr sagte.
Holly fuhr los, als die Straße frei war. Zu spät fiel ihr ein, dass sie keine Ahnung hatte, wohin sie musste. Sie tastete nach ihrem Handy, das sie neben den Kaffeebecher gelegt hatte, rief Google Maps auf und gab die Postleitzahl ein. Während sie fuhr, wurden die Regentropfen immer dicker – obwohl es, wenn sie genauer hinsah, eher so aussah, als ob …
»Es schneit!«, rief Lily. »Es schneit tatsächlich – an Heiligabend!«
Holly schaltete die Scheibenwischer ein. »Ich würde sagen, das ist eher Graupel als Schnee.«
Lily fuchtelte mit der Hand herum. »Hör auf, es kaputtzumachen. Mum und Dad werden es lieben.«
»Ich bezweifle, dass sie es auch lieben würden, wenn sie Auto fahren müssten«, murmelte Holly, aber so leise, dass Lily so tun konnte, als hätte sie es nicht gehört. Sie bog am Ende der Straße links ab, und Lily runzelte die Stirn.
»Du fährst in die falsche Richtung.«
»Nein, tue ich nicht. Ich folge der blauen Linie auf Google Maps.«
»Vielleicht hast du die Postleitzahl falsch eingegeben, denn ich habe gerade im Café auf die Karte geschaut, und du fährst in die falsche Richtung.«
»Lily! Um Himmels willen, lass mich einfach fahren, okay?«
»Ich sage dir ja nicht, wie du fahren sollst, ich sage nur, dass du in die falsche Richtung fährst. Sieh her, ich zeige es dir.« Sie schnappte sich Hollys Handy vom Armaturenbrett.
»Hey!«
»Ich meine ja nur, dein Orientierungssinn ist nicht gerade brillant, Holly. Besser, ich …«
Holly griff mit einer Hand nach dem Telefon und starrte ihre Schwester an, als sie es wegzog. »Gib es zurück!«
»Ich sehe nur nach, Holly, das ist alles.«
»Da kommt gleich eine Kreuzung. Soll ich links oder rechts abbiegen?«
»Warte kurz, ja?« Lily ließ das Telefon sinken und zoomte etwas heran.
Holly stöhnte. »Warum musst du dich immer einmischen? Warum kannst du mich nicht einmal etwas allein machen lassen?« Von hinten näherte sich ein Auto und drängelte. Um Himmels willen! Sie fuhr schon Höchstgeschwindigkeit, trotz Schneeregen. Konnte der nicht ein bisschen langsamer fahren?
»Ich finde, du übertreibst.«
»Nein, tu ich nicht! Du weißt es immer besser!« Holly war sich bewusst, dass sie überreagierte, sie war genervt.
Die Kreuzung kam jetzt schnell näher, und sie trat auf die Bremse. Aber da ein Auto hinter ihr war und sie sich auf einer Landstraße befand, konnte sie nicht einfach anhalten.
»Gib es zurück«, sagte sie erneut und diesmal schnappte sie sich das Telefon. Sieg!
Und in diesem kurzen Moment, in dem sie sich auf das Handy konzentrierte, kam an der Kreuzung vor ihnen ein Auto viel zu schnell um die Kurve gerast. So schnell, dass es ausscherte und auf die Gegenspur ausweichen musste. Holly ließ das Telefon fallen und umklammerte mit beiden Händen das Lenkrad.
»Scheiße!«, fluchte sie, während Lily »Bremsen!« rief und ihre Hände vor ihren Bauch hielt.
Also bremste Holly.
Aber das Auto hinter ihnen bremste nicht. Nicht rechtzeitig. Und statt dem entgegenkommenden Auto auszuweichen, wurden sie ein paar Meter nach vorne geschleudert …
Holly spürte ihn – den Moment des Aufpralls. Spürte den Ruck, der durch ihren Körper ging, hörte das markerschütternde Knirschen von Metall. Sie spürte, wie ihr Sicherheitsgurt in ihren Körper schnitt, ihr den Atem raubte. Sah Lilys Gesicht, die aufgerissenen Augen, sah, wie ihr Haar, das sie heute Morgen so sorgfältig frisiert hatte, nach vorn geschleudert wurde.
Und das war’s. Das war das Letzte, was sie wahrnahm, bevor etwas Hartes gegen ihren Kopf schlug. Bevor der Schmerz durch ihren Schädel schoss. Bevor ihre ganze Welt dunkel wurde.
3 Jahre später Dezember
Kapitel drei
Liebe/r Unbekannte/r
dies ist mein drittes Weihnachten allein. Wenn Du diesen Brief bekommst, ist es drei Jahre, fünf Tage, neun Stunden und elf Minuten her, seit ich meine Schwester in ein anderes Auto gefahren habe. Drei Jahre, seit wir beide bewusstlos ins Krankenhaus gebracht wurden. Drei Jahre, seit meine Schwester aus meinem Leben verschwunden ist.
Jedes Jahr denke ich, dass es leichter wird – aber das wird es nicht.
Heiligabend wird immer der Jahrestag dieses Unfalls sein. Heiligabend wird immer der Tag sein, an dem ich mich frage: Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich nicht darauf bestanden hätte zu fahren? Was wäre, wenn ich durchgefahren wäre und nicht in diesem Café angehalten hätte? Was wäre, wenn wir unsere Getränke dort getrunken hätten, statt sie mitzunehmen?
Ich mache bei diesem Club der Unbekannten mit, um mich weniger allein zu fühlen. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich damit angefangen, weil meine Freundin Abi mich dazu überredet hat, nachdem sie in einer Radiosendung davon gehört hatte, und ich habe weitergemacht, weil ich hoffte, mich dadurch weniger einsam zu fühlen. Und da ist was dran. Zu wissen, dass du, wo auch immer du bist, wer auch immer du bist, irgendwo da draußen existierst, zu wissen, dass du lesen wirst, was ich schreibe, dass du verstehen wirst, was ich schreibe, ist ein Trost. Dafür vielen Dank.
Aber eigentlich ist Weihnachten ja eine Zeit für Familie und Freunde. Und in gewisser Weise ist es das für mich auch immer noch. Ich ertappe mich immer noch dabei, wie ich mir Dinge in einem Schaufenster ansehe und denke, das wäre ein gutes Geschenk für Mama oder Papa. Für meine Schwester. Auch wenn ich Weihnachten nie wieder mit Lily verbringen werde, gelingt es mir doch jedes Jahr, das perfekte Geschenk für sie zu finden.
Es tut mir leid: Dieser Brief ist morbider, als meine Briefe das sonst sind. Es ist nicht alles schlecht, ehrlich. Und bald sind die Feiertage vorbei, und ich freue mich auf den Beginn des Schuljahres und die damit verbundene Ablenkung. Ich hoffe, du hast auch etwas, worauf du dich freust.
Jedenfalls bin ich froh, dass es dich gibt, Fremde/r, und ich hoffe, es tröstet dich, zu wissen, dass du nicht die/der Einzige bist, die/der allein ist, die/der sich einsam fühlt. Wir beide werden dieses Weihnachten überstehen, versprochen, und es wartet ein strahlendes, funkelndes neues Jahr auf uns. Zumindest sage ich mir das. Und dir sage ich es auch und hoffe, dass du mir vielleicht glaubst.
Ich sende Liebe und positive Gedanken in die Welt hinaus, während ich dies schreibe. Ich habe nie an Schicksal geglaubt – im Gegensatz zu meiner Schwester –, aber positive Gedanken können nicht schaden, oder?
Alles Liebe,
Holly
»Was machst du gerade? Gammelst du auf dem Sofa rum?« Holly hielt das Telefon vom Ohr weg, weil Abi praktisch schrie – wozu sie neigte. Holly war überzeugt, das war die Theaterlehrerin in ihr – sie war so damit beschäftigt, ihren Schülern beizubringen, allesrauszulassen, dass sie verlernt hatte, in normaler Lautstärke zu sprechen. »Sag, dass das nicht wahr ist!«, schrie Abi. »Du hast mir versprochen, das nicht zu tun.«
»Ich gammle nicht rum«, sagte Holly brav, obwohl sie gerade auf ihrem gebrauchten grünen Sofa saß und ins Leere starrte, weil es ihr zu anstrengend war, den Fernseher einzuschalten.
»Du lügst«, sagte Abi, die sie durchschaute. »Aber wir sehen uns morgen, oder? Heiligabend-Drinks? Ich habe James nach London zu seinem Bruder geschickt, also sind wir nur zu zweit.«
Holly ließ sich noch tiefer ins Sofa sinken. Heiligabend. In diesem Jahr war ihre kleine Wohnung nicht geschmückt – darum hatte Abi sich immer gekümmert, bevor sie ausgezogen war –, also gab es keinerlei Hinweise auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Die Wohnung selbst war okay – sie war zwar klein, aber schlicht und modern und vor Hollys Einzug frisch renoviert worden, auch wenn die Küchenschranktüren dazu neigten, aus den Angeln zu kippen. Doch heute verlieh das graue Winterlicht dem Wohnzimmer eine nasskalte Tristesse. Holly fragte sich, ob es richtig gewesen war, den Mietvertrag zu verlängern, nachdem Abi mit James, ihrem fantastischen irischen Verlobten, zusammengezogen war – aber wo hätte sie sonst bleiben sollen?
Sie hatte Abi kurz nach dem Unfall kennengelernt, als sie nach Windsor gezogen war, auf der Flucht vor London und ihrem Leben dort, unfähig, sich der Trauer und den Schuldgefühlen zu stellen. Es war ihr gelungen, eine Stelle als Lehrerin zu ergattern, und seitdem war sie jeden Tag dankbar, dass Abi eine ihrer Kolleginnen dort gewesen war – denn obwohl es sich angefühlt hatte, als wäre ihre ganze Welt eingestürzt, war Abi immer für sie da gewesen. Und als Abi als stellvertretende Direktorin an die Kunsthochschule wechselte, war Holly mitgegangen. Abi hatte Holly sogar bei sich einziehen lassen, was sich als Segen erwies, denn Holly hatte nicht bedacht, wie teuer die Mieten in Windsor waren, und sich anfangs in einer chaotischen WG durchgeschlagen.
Vor zwei Monaten hatte Abi schließlich dem Druck nachgegeben, mit James zusammenzuziehen, und Holly allein zurückgelassen. Eigentlich hatte sie vorgehabt, sich eine neue Mitbewohnerin zu suchen, aber sie war nicht dazu gekommen. Außerdem überlegte sie, Daniel zu fragen, ob er bei ihr einziehen wollte – denn tat man das nicht mit Ende zwanzig, wenn man schon eine Weile zusammen war?
»Willst du essen gehen oder nur was trinken?«, fragte Abi und riss Holly aus ihren Gedanken.
»Hm, essen gehen? Wahrscheinlich besser, oder? Aber kriegen wir so kurzfristig noch einen Tisch?«
»Ich regle das«, sagte Abi schlicht. Und das würde sie auch tun – Abi regelte immer alles irgendwie.
Hollys Telefon klingelte, und sie sah aufs Display. »Ich muss auflegen, Abs, Daniel ruft an.«
»Gut. Unternimm was mit ihm, statt rumzugammeln. Amüsier dich ein bisschen!«
Diesmal machte Holly sich nicht die Mühe, es nicht zu erwähnen. »Geht nicht. Er ist auf dem Weg nach Prag, schon vergessen?«
»Ach ja, wie konnte ich.« In Abis Stimme schwang Missbilligung mit.
»Er darf ein Leben haben, Abs.«
»Ja, das darf er. Ich finde nur, dass er dich vielleicht ab und zu mitnehmen könnte.«
»Wir haben eine gesunde Beziehung«, sagte Holly, die zwar merkte, dass sie in die Defensive ging, sich aber nicht zurückhalten konnte. »Wir respektieren den Freiraum des anderen.« Das war eines der Dinge, die sie an der Beziehung zu Daniel mochte – er belagerte sie nicht ständig, vermittelte ihr kein Gefühl der Klaustrophobie.
Abi legte auf, und Holly sammelte sich kurz, damit ihre Stimme aufgekratzt klang, als sie Daniels Anruf entgegennahm. »Hey!«
»Hey, hör mal, können wir reden?« Er klang gestresst. Er neigte zwar dazu – einige Schüler hatten ihm sogar den Spitznamen Stresskopf verpasst, und mindestens einmal pro Woche konnte man ihn während des Musikunterrichts die Fassung verlieren hören –, aber normalerweise war das aufs Unterrichten beschränkt, deshalb wurde sie hellhörig.
»Klar«, sagte Holly. »Was ist es denn?«
Ein Radfahrer auf der falschen Straßenseite? Darüber konnte er sich wirklich aufregen. Oder fand er vielleicht irgendetwas nicht, das er für Prag einpacken musste?
»Bist du zu Hause?«, fragte Daniel und seine Worte überschlugen sich.
»Ähm, ja …«
»Okay … Hör zu, ich bin nur fünf Minuten entfernt. Kann ich vorbeikommen?«
»Musst du nicht packen?« Das war der Grund, warum er vorhin keine Zeit gehabt hatte, sie vor seiner Abreise nach Prag noch einmal zu treffen. Sein Flug ging morgen früh – Heiligabend waren die Flüge anscheinend billiger.
»Ich weiß, ich wollte nur … Hör zu, Holly, ich muss wirklich mit dir reden.«
»Okay, dann komm vorbei!« Sein Ton gefiel ihr nicht, doch sie blieb positiv. Kein Grund zur Panik.
Ein paar Minuten später schloss Daniel die Wohnungstür auf. Sie hatte ihm vor etwa sechs Monaten einen Schlüssel und den Code für das Gebäude gegeben – ein weiterer Schritt, den sie glaubte, tun zu müssen. Sie stand auf, als er die Tür hinter sich schloss, und bemerkte die Briefe, die im Briefschlitz steckten. Einige davon mussten für Abi sein – sie hatte ihre Adresse immer noch nicht geändert, aber nicht, weil sie unorganisiert war, sondern, wie Holly wusste, aus Sorge, dass es nicht funktionierte – dass sie, so sehr sie James auch liebte, im Zusammenleben irgendeine Unvereinbarkeit feststellen würde, die ihr vorher nie aufgefallen war.
Holly zauberte ein Lächeln für Daniel hervor, der den übergroßen, teuren schwarzen Mantel trug, den er vor zwei Jahren gekauft hatte. Er stand ihm nicht besonders, das Schwarz machte ihn blass, besonders im Winter, aber sie hatte nie etwas gesagt.
»Willst du eine Tasse Tee?«, fragte Holly. »Ich habe diesen Zitrone-Ingwer-Tee, den du so magst.« Sie ging in die Küche –eher eine Kochnische –, die ans Wohnzimmer grenzte. Aber er folgte ihr nicht.
Sie drehte sich wieder um. Er spielte an seinem blonden Haar herum, wie immer, wenn er nervös war, sodass es noch platter anlag. Es wurde oben schon schütter – was ihm peinlich war, wie sie wusste, aber sie hatte ihm wiederholt gesagt, dass es sie nicht störte.
»Daniel? Was gibt’s?«
Er holte so tief Luft, dass sein Brustkorb sich weitete. »Holly.« Seine Stimme klang gepresst. »Das hier funktioniert nicht.«
Holly runzelte die Stirn. »Was funktioniert nicht? Der Tee?«
Er trat von einem Fuß auf den anderen. Er hatte seine Schuhe nicht ausgezogen, fiel Holly auf – die klobigen Wanderstiefel, die er im Winter immer trug. »Wir.«
Sie sah ihn ausdruckslos an, ehrlich verblüfft. »Was meinst du mit wir?«
Er schloss kurz die blassblauen Augen. »Tut mir leid.« Wieder spielte er an seinem Haar herum. »Gott, tut mir leid, ich wollte nicht so damit herausplatzen.«
»Womit herausplatzen?«
»Ich glaube nicht … Ich meine, dass du und ich …«
Sie starrte ihn an – das schüttere Haar, die Augen, die ihrem Blick auswichen, die schiefe Nase, die er sich als Kind gebrochen hatte –, und ihr dämmerte etwas. »Moment, Moment, Moment … Heißt das … Machst du Schluss mit mir?«
Sein Gesicht sagte alles.
»Was soll das, Daniel?« Sie holte tief Luft und versuchte, nicht hysterisch zu klingen. »Wo kommt das plötzlich her?«
»Es ist …« Er schluckte. »Ich denke schon seit einer Weile darüber nach.«
»Seit einer Weile?« Und sie hatte die Suche nach einer Mitbewohnerin schleifen lassen in der Annahme, dass sie früher oder später zusammenziehen würden. »Danke, dass ich das auch mal erfahre.« Sie fuhr sich mit beiden Händen durchs Haar und bemerkte erst jetzt, dass sie es heute nicht gebürstet hatte. »Warum?«
»Ich …« Sein Blick fiel auf den beigen Teppich. »Ich glaube, du bist nicht mit ganzem Herzen dabei.«
»Ist das dein Ernst?« Sie spürte, wie sie die Beherrschung verlor. »Du tauchst hier auf, einen Tag vor Heiligabend, um mit mir Schluss zu machen, und gibst mir die Schuld?«
»Ich wollte nicht damit warten, es dir zu sagen«, sagte Daniel, und seine Worte überschlugen sich. »Ich meine, eigentlich wollte ich bis Neujahr warten, aber ich habe mit einem Kumpel geredet und der meinte, es sei nicht richtig, das ganze Weihnachtsding mit Geschenken und allem durchzuziehen, wenn ich wüsste …«
Sie konnte ihn nur anstarren. Wieso hatte sie das nicht kommen sehen? Wie konnte sie nicht die leisesteAhnung gehabt haben?
»Und so«, fuhr er fort, »haben wir wenigstens ein paar Wochen Zeit, bevor wir uns bei der Arbeit wiedersehen.«
»Oh ja«, sagte Holly bitter. »Sehr rücksichtsvoll von dir.« Sie wandte sich von ihm ab, um sich ein Glas Wasser aus der Küche zu holen. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Was tat man in so einer Situation? Sie hatte noch nie erlebt, dass jemand mit ihr Schluss machte – all ihre Beziehungen vor Daniel waren nur von kurzer Dauer gewesen und irgendwie … im Sande verlaufen.
»Es tut mir leid!«, rief Daniel hinter ihr und folgte ihr jetzt. »Ich weiß nicht, was ich tun soll – es fühlt sich an, als könnte ich nichts richtig machen, als gäbe es keinen richtigen Zeitpunkt, es zu sagen.«
Holly holte ein Glas aus dem Küchenschrank, fluchte vor sich hin, als sich eines der Scharniere löste, füllte Wasser ins Glas, spielte auf Zeit, während sie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Dann drehte sie sich zu ihm um, zwischen ihnen die Arbeitsplatte, die die Küche vom Wohnzimmer trennte. »Ich verstehe es nur nicht, Daniel. Was hat sich geändert?«
Daniel machte einen Schritt auf sie zu. »Sieh mal, als wir zusammenkamen, warst du … Naja, du hattest einiges durchgemacht.«
Holly zuckte zusammen. Als sie Daniel kennenlernte, lag der Unfall schon ein Jahr zurück, aber sie hatte ihn immer noch nicht verkraftet. Und als Daniel mit ihr ausgehen wollte, hatte Abi sie ermutigt. Du musst nach vorn schauen, Babe. Du kannst nicht in der Vergangenheit leben – das bringt dich um.
»Und das habe ich verstanden, ehrlich, aber ich dachte, vielleicht …«
»Du dachtest was?«, fragte Holly scharf.
Er schüttelte den Kopf, und es wirkte erschöpft. Ernsthaft? Jetzt besaß er auch noch die Dreistigkeit, erschöpft zu wirken? »Keine Ahnung.«
»Du dachtest, es wird irgendwann lustiger mit mir. Ist es das?«
»Nein! Es ist lustig mit dir.« Aber es klang beschwichtigend, als meinte er es nicht wirklich. War sie nicht lustig? War das das Problem? »Es ist nur … Du scheinst nicht wirklich … engagiert. Ich dachte, du würdest mit der Zeit vielleicht offener, würdest mehr mit mir reden.«
Sie runzelte die Stirn. »Ich rede die ganze verdammte Zeit mit dir.«
Er seufzte. Als wäre sie es, die unvernünftig war. »Ich will jemanden, mit dem ich mir ein Leben aufbauen kann, Holly.«
»Das will ich auch!« Die Worte kamen automatisch – es war das, was man in so einer Situation sagte. Aber es war auch die Wahrheit. Oder etwa nicht?
»Willst du das wirklich?«
»Ja.« Sie reckte ihr Kinn, und die Geste erinnerte sie kurz an die Streitereien mit Lily. Willst du das wirklich tragen, Holly? Ja. Willst du wirklich die ganze Strecke fahren? Ja.
»Vielleicht«, räumte Daniel ein. »Aber nicht mit mir. Du hast mich noch nicht einmal deinen Eltern vorgestellt, verdammt noch mal.«
Holly zuckte zusammen, ließ sich aber von ihm kein schlechtes Gewissen einreden. »Sagst du mir jetzt, was ich will? Was ich fühle? Wie kannst du es wagen! Und meine Eltern, meine Familie … Das ist …«
»Holly, beruhige dich, ich bin nicht …«
Aber Holly schüttelte den Kopf und fuhr dazwischen. »Weißt du was? Ich will mich damit jetzt nicht befassen. Raus.«
Er rührte sich nicht. »Siehst du, das meine ich – du willst nie reden, nie über deine Gefühle sprechen.«
»Oh, du willst, dass ich über meine Gefühle spreche, ja? Ich soll dir sagen, dass mein Herz gebrochen ist, damit du dein Ego aufpolieren kannst, während du mich tröstest?«
»So hab ich das nicht gemeint.« Er strich sich wieder mit einer Hand durchs Haar. »Scheiße, ich mache das nicht richtig.«
»Nein, das machst du verdammt noch mal nicht.«
»Ich gehe.«
»Ja, bitte.«
»Ich rufe dich später an, wenn du …«
»Wenn ich was?«
»Wir müssen in Ruhe darüber reden«, sagte er.
Holly seufzte. »Geh einfach, Daniel.« Ihre Wut verblasste jetzt, und etwas anderes trat an ihre Stelle. Sie wollte lieber allein sein, wenn sich dieses Gefühl in ihr breitmachte.
Er zögerte, wandte sich dann aber zum Gehen. In der offenen Tür hielt er inne und sah sie noch einmal an. »Es tut mir leid, Holly. Ich tue das nicht, um dich zu verletzen.«
Holly stieß ein humorloses Lachen aus. »Tja, für mich fühlt es sich aber so an.«
»Ich rufe dich an«, wiederholte er und schloss die Tür hinter sich. Dadurch lösten sich die Briefe, die in den Briefschlitz gestopft waren. Holly fühlte sich ein wenig betäubt, als sie sich bückte, um sie aufzuheben, ihre Bewegungen waren steif.
Und da, ganz oben auf dem Stapel, lag der diesjährige Brief von einer Unbekannten.
Kapitel vier
Liebe/r Unbekannte/r,
ich weiß nicht so recht, wie ich diesen Brief beginnen soll – es ist das erste Mal, dass ich so etwas mache, und es kommt mir ein bisschen albern vor. Aber ich werde es versuchen. Dass ich dich nie treffen werde, macht es, ehrlich gesagt, etwas einfacher. Da hat Pam schon recht.
Weißt du, ich bin allein. Schon seit Jahren. Mein Sohn Richard starb vor achtzehn Jahren bei einem Autounfall. Fast auf den Tag genau vor achtzehn Jahren, während ich dies schreibe. In der Weihnachtszeit sind alle irgendwie in Eile, nicht wahr? Sie haben es eilig, nach Hause zu kommen oder sich mit Freunden zu treffen. Sich zu amüsieren oder zu entspannen, wie auch immer. Wusstest du, dass die Wahrscheinlichkeit, in einen Autounfall verwickelt zu werden, an Weihnachten bis zu viermal höher ist als an jedem anderen Tag des Jahres?
Als Richard starb, war es vorbei. Mein Mann Charles hat es nicht verkraftet, und es hat uns auseinandergerissen. Wir sind zusammengeblieben, und ich habe ihn immer noch geliebt, und ich glaube, dass er mich trotz allem auch immer noch geliebt hat. Aber er war nur noch ein Schatten seiner selbst, und als er vor sieben Jahren starb, war ich fast erleichtert. Es ist furchtbar, so etwas zu sagen. Ich würde es niemals zu jemandem sagen, den ich kenne, aber es fühlt sich nicht so an, als würde ich diesen Brief einer echten Person schreiben. Das war es wohl, was Pam meinte. Versteh mich nicht falsch, ich wollte nicht, dass Charles stirbt. Es hat mich getroffen, und natürlich wäre es mir lieber, er wäre noch hier. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich erleichtert war, mich nicht mehr verstellen zu müssen.
Charles hat mir die Schuld gegeben, glaube ich. Er hat nie etwas gesagt, aber ich weiß, dass er mir die Schuld gegeben hat. Nicht so sehr für Richards Tod, sondern dafür, dass wir mit Richard auch unseren Enkel verloren haben. Seine Mutter hat ihn uns weggenommen und gesagt, dass sie uns nie wieder sehen wollen. Ich habe diesen Jungen so sehr geliebt. Er besaß die Beharrlichkeit seiner Mutter und die Leidenschaft seines Vaters – ich frage mich, ob er beides noch hat, oder ob das eine oder das andere im Laufe der Zeit verloren gegangen ist.
Ich schätze, es hat keinen Sinn, zu beklagen, was wir verloren haben – irgendwann muss man es einfach akzeptieren. Aber während ich dies schreibe, sitze ich in meinem Stammcafé, starre auf das Gemälde eines Regenwaldes und wünschte, ich wäre dort, und ich kann nicht anders, als mich zu fragen, wie mein Leben ausgesehen hätte, wenn Richard an diesem Tag nicht ins Auto gestiegen wäre. Hätte ich jetzt jemanden, an den ich mich anlehnen könnte?
Denn dieses Jahr wünschte ich, ich hätte jemanden. Bei mir wurde gerade Krebs diagnostiziert. Bauchspeicheldrüsenkrebs, um genau zu sein. Und ich nehme an, die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit bringt einen dazu, Bilanz über sein Leben zu ziehen. Was man bedauert, welche Fehler man gemacht hat. Und im Moment bin ich nicht nur mit der Möglichkeit des Todes konfrontiert – ich bin damit auch allein.
Weißt du was? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich dadurch besser fühle, dass ich dies schreibe. Ich bin mir auch nicht sicher, ob du dich dadurch besser fühlen wirst – offensichtlich mache ich also alles falsch. Aber vielleicht ja doch? Denn bist du nicht auch allein? Geht es nicht gerade darum, zu wissen, dass wir nicht die Einzigen sind? Vielleicht liegt darin auch eine Art von Trost. Ich wünschte, ich hätte weise, inspirierende Worte für dich, aber das ist schwierig, da ich nichts über dich weiß, und gute Ratschläge sollten auf den Einzelnen zugeschnitten sein, oder? Ich weiß auch nicht, ob du überhaupt Ratschläge von mir annehmen würdest – ich bin kaum ein leuchtendes Vorbild, wie man sein Leben leben sollte.
Ich verabschiede mich also mit einem Frohe Weihnachten und fertig. Frohe Weihnachten – und alles Gute, wer immer du bist. Ich hoffe, du findest im nächsten Jahr Freude, irgendwo – und sei es nur, indem du ein Gemälde von einem Regenwald betrachtest und dir den Geschmack der Luft dort vorstellst.
Mit freundlichen Grüßen,
Emma Tooley
P.S.: Ich versichere, ich bin nicht pedantisch – ich starre nicht sehnsüchtig die ganze Zeit Bilder an. Es liegt an dem Café, in dem ich sitze – dem Impression Sunrise, nach Monet.
P.P.S.: Ich habe gelogen. Ich bin ein bisschen pedantisch. Aber was kümmert es dich? Du wirst mich nie kennenlernen.
Holly legte sich die Bettdecke um die Schultern und las den Brief ein drittes Mal. Seit Daniel gegangen war, hatte sie sich im Bett verkrochen, die obligatorische Schokolade auf dem Nachttisch neben der Lampe, die dazu neigte, hin und wieder zu flackern. Es war einfacher, immer wieder den Brief zu lesen, den Kummer und die Einsamkeit dieser fremden Frau – Emma – zu absorbieren, als über sich selbst nachzudenken. Denn sie wollte sich nicht damit auseinandersetzen, dass Daniel sie verlassen hatte, dass sie sich wieder einmal als nicht liebenswert erwiesen hatte. Sie wollte sich nicht damit auseinandersetzen, dass sie an Weihnachten wirklich allein war, umso mehr, als ihre Familie zusammen war – ohne sie.
Sie wollte sich auch nicht damit auseinandersetzen, dass es ihr eigentlich schlechter gehen sollte. Sollte man nicht am Boden zerstört sein, wenn jemand aus heiterem Himmel Schluss mit einem machte – jedenfalls wenn man ihn wirklich liebte?
Ich will jemanden, mit dem ich mir ein Leben aufbauen kann, Holly.
Das will ich auch!
Vielleicht, aber nicht mit mir.
Hatte er recht? Die Frage stieß ihr unangenehm auf, also schob sie sie beiseite und konzentrierte sich lieber auf den Brief. Vielleicht lag es an der Sache mit Daniel, vielleicht lag es daran, dass dieser Brief anders war, offener in seinem Kummer und seiner Einsamkeit, aber er sprach sie mehr an als alle anderen bisher.
Ein Autounfall. Diese Frau, Emma, hatte ihren Sohn bei einem Autounfall verloren. Wenn das jemand nachempfinden konnte, dann Holly.
Dann die Stelle mit dem Stammcafé. Das Impression Sunrise Café. Jedes Mal, wenn sie die Worte las, versetzten sie ihr einen Schock. Denn sie kannte dieses Café. Sie war in diesem Café gewesen. Sie hatte es sogar gegoogelt, um sicherzugehen – es schien in ganz England nur ein einziges Café mit diesem Namen zu geben. Das in Devon, wo sie und Lily an jenem schicksalhaften Tag Halt gemacht hatten.
Sie wusste, was Lily sagen würde, wenn sie jetzt hier bei ihr wäre. Vielleicht war es Schicksal, dass du diesen Brief erhalten hast. Vielleicht war es dir bestimmt, ihn zu bekommen.
Aber Holly las diesen Brief ja nur, weil Lily nicht mehr in ihrem Leben war, und deshalb konnte es kein Schicksal sein. Das wäre zu deprimierend.
Dies war der dritte Brief an eine/n Unbekannte/n, den sie bekommen hatte, und sie hatte noch nie einen der Absender getroffen. Das hätte sie auch nicht gekonnt – die Briefe enthielten keine Adressen, keine Kontaktdaten. Aber dieses Mal … Wenn sie recht hatte und es dasselbe Café war, dann kannte sie das Dorf, in dem die Frau lebte. Und sie kannte den vollen Namen der Frau. Nicht jeder unterschrieb mit Nachnamen, aber diese Frau schon. Sie konnte sie finden, wenn sie ein wenig googelte, da war sie sicher.
Ihr Telefon vibrierte auf dem Nachttisch. Daniel. Stirnrunzelnd drehte sie es nach unten. Und das war die Entscheidung. Sie wollte hier nicht allein sitzen und ihrer gescheiterten Beziehung nachtrauern. Sie wollte die nächsten Tage nicht damit verbringen, alle zu beneiden, die sie mit ihrer Familie verbrachten, und auch nicht mit herzzerreißenden Erinnerungen an vergangene Weihnachtsfeste mit ihrer Schwester und ihren Eltern. An die Jahre vor dem Unfall, als sie mit ihrem Vater in der Küche gekocht und ihrer Mutter zugehört hatte, die nach zu viel Glühwein immer umständlichere Geschichten erzählte. Oder an die Nacht, die alles veränderte.
Nein, stattdessen würde sie etwas Nützliches tun. Unabhängig davon, ob es ihr bestimmt war, diesen Brief zu bekommen, beschloss sie zu handeln. Mit einer fließenden Bewegung warf sie die Bettdecke zurück und griff nach ihrem Handy, um ihre Theorie zu überprüfen.
Dann sah sie die Zeit. Irgendwie war es spät geworden, ohne dass sie es bemerkt hatte. Okay, sie würde erst einmal schlafen. Sie würde schlafen und früh aufstehen, und dann würde sie diese Emma Tooley aufspüren – sie finden und ihr klarmachen, dass es da draußen jemanden gab, der sich um sie sorgte. Dass sie nicht so allein war, wie sie glaubte.
»Nimm es mir nicht übel, aber ich schaffe es heute Abend nicht.« Holly setzte den Blinker und bog nach links ab, um Windsor zu verlassen und auf die M4 zu fahren.
»Was? Warum?«, ertönte Abis Stimme über die Lautsprecher ihres Autos. Holly hatte zwei Jahre gebraucht, um den Mut aufzubringen, sich wieder hinters Steuer zu setzen, und sicherheitshalber in ein Navi sowie eine Bluetooth-Verbindung investiert, damit sie nie wieder während der Fahrt nach ihrem Handy greifen musste.