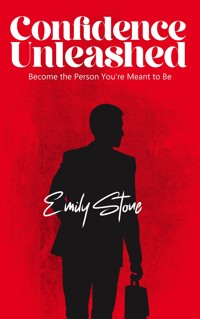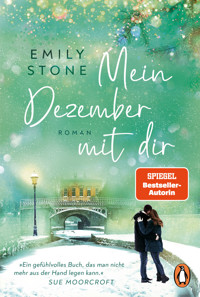
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kannst du ihn in dein Leben lassen, selbst wenn dein Herz gebrochen ist?
Schon eine halbe Ewigkeit begleitet Lexie ihr Glas der Wünsche, das ihre tief verborgenen Sehnsüchte enthält. Und fast genauso lange hat sie ihren Vater weder gesehen noch gesprochen. Als sie unerwartet die Nachricht seines plötzlichen Todes erreicht, ist sie zunächst am Boden zerstört. Doch Lexies Vater hat ihr ein Vermächtnis hinterlassen: Ein Jahr lang soll sie gemeinsam mit Theo sein florierendes Reiseunternehmen in Bath leiten. Theo, der nicht nur unfassbar gutaussehend, sondern auch unwiderstehlich ist … Er könnte Lexies Herz aus Eis zum Schmelzen bringen. Was sie jedoch nicht weiß: Ihr Vater hat nicht nur sein Erbe, sondern auch ein großes Geheimnis vor ihr verborgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Emily Stone lebt und arbeitet in Chepstow, Wales. Ihr gefühlvoller
Debütroman Für immer im Dezember eroberte nicht nur die Herzen ihrer Leser*innen, sondern ebenfalls die SPIEGEL-Bestsellerliste.
Auch ihr Roman Mein Dezember mit dir ist eine hochemotionale
Lektüre über die große Liebe.
Außerdem von Emily Stone lieferbar:
Für immer im Dezember
Jedes Jahr im Winter
Kein Winter ohne dich
www.penguin-verlag.de
Emily Stone
Mein Dezember mit dir
Roman
Aus dem Englischen von Juliane Zaubitzer
Die Originalausgabe erschien
unter dem Titel Home again for Christmas
bei Headline Review, London 2024.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 der Originalausgabe by Emily Stone
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Lisa Wolf
Covergestaltung: Favoritbuero
Coverabbildungen: © LL_studio, IanRedding, AKaiser, Woskresenskiy, Sven Hansche, Delbars, Gudrun Muenz / Shutterstock.com
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-32657-9V001
www.penguin-verlag.de
1. Kapitel
Lexie stand zwischen den beiden Mädchen und hielt den großen goldenen Stern über ihre Köpfe – keine leichte Aufgabe, denn Bella war mit ihren dreizehn Jahren fast so groß wie sie.
»Ich will den Stern auf den Baum stecken!«, rief Bree.
»Tja, Pech gehabt, Zwerg, du kommst da gar nicht ran.«
Über dem grünen Glitzerkleid, offenbar ihr Weihnachtsoutfit, stemmte Bree die Hände in die Hüften. »Ich bin kein Zwerg, ich bin sechs.«
Bella verdrehte die Augen und warf melodramatisch ihr langes blondes Haar zurück. »Wo ist der Unterschied?«
»Okay!« Lexie klatschte in die Hände und zwang sich, ein strahlendes Lächeln aufzusetzen, während sie sich fragte, was um alles in der Welt sie geritten hatte, einen Job als Nanny anzunehmen – auch wenn es nur für einen Winter war. »Lasst uns doch erst die restlichen Kugeln aufhängen, und dann kümmern wir uns um den Stern.«
»Ich denke, es sind genug Kugeln«, sagte Bella naserümpfend, als sollte auch für Lexie offensichtlich sein, dass die anderen drei Kisten Weihnachtsschmuck auf dem gläsernen Couchtisch hinter ihnen völlig überflüssig waren.
Bree warf Lexie einen flehenden Blick zu. »Ich will aber so gern«, sagte sie und zog einen Schmollmund.
»Na gut.« Bella warf sich aufs Sofa und verschränkte die Arme. »Ist sowieso blöd.«
»Wie wäre es, wenn ich den Stern anbringe?«, fragte Lexie und stellte sich auf die Zehenspitzen, um genau das zu tun.
Beide Mädchen starrten sie an, und Lexie wurde heiß. Das war eindeutig die falsche Entscheidung. Da sie selbst nicht mit Geschwistern aufgewachsen war, kannte sie sich mit den Feinheiten von Geschwisterstreit nicht aus. Gott, vielleicht hätte sie doch den Job am Skilift annehmen sollen, wie bei ihrer letzten Skisaison vor ein paar Jahren.
»Äh, sollen wir deine restlichen Schneeflocken aufhängen, Bree?«
Langsam, als würde sie die schreckliche Tat, die Lexie gerade begangen hatte, noch verarbeiten, nickte Bree und wandte sich den Papierschneeflocken zu, die sie zuvor gebastelt hatten. Bella seufzte, zückte ihr Handy, ließ sich auf dem Sofa nieder und zog eines der flauschigen weißen Kissen zu sich heran.
Nachdem Bree fast jede freie Stelle an der Wand samt Holzbalken mit Schneeflocken geschmückt hatte, betrachtete sie die übrig gebliebenen in ihren Händen. Dann lächelte sie Lexie an, das vorangegangene Drama um den Stern längst vergessen. »Jetzt dein Zimmer«, schlug sie vor.
»Nein, ich glaube …«
Ohne Lexies Protest zu beachten, marschierte Bree durchs Chalet schnurstracks auf Lexies Zimmer zu. Es war das kleinste – ein Einzelbett, ein Kleiderschrank, eine Kommode –, aber hübsch eingerichtet, und die Aussicht durch das große Fenster auf die schneebedeckten Tannen war atemberaubend.
Bree begann unaufgefordert, Schneeflocken an die Wände zu kleben, während Lexie sich flüchtig umsah. Zugegeben, ihr Zimmer war eher spärlich eingerichtet, fast schon deprimierend kahl – nur ein Stapel gebrauchter Bücher auf dem Nachttisch, ein paar Fotos von ihr und ihrer Mutter auf der Kommode. Doch Lexie war stolz darauf, dass sie ihr ganzes Leben in zwei Koffern verstauen konnte. Es machte das Reisen so viel einfacher, und sie blieb nicht gern länger am selben Ort.
»Was ist das?«, fragte Bree und zeigte auf das Glasgefäß neben dem Spiegel auf Lexies Kommode. Es war einer der wenigen Gegenstände, den sie von einem Ort zum anderen mitnahm. Auch wenn sie ansonsten keinen großen Wert darauf legte, das Zimmer, in dem sie schlief, weihnachtlich zu schmücken. Bree wollte danach greifen, aber Lexie stellte sich ihr in den Weg.
Bree funkelte sie böse an. »Ich will es mir ansehen«, sagte sie und zog wieder einen Schmollmund.
Lexie betrachtete Bree einen Moment lang. Die falschen Tränen warteten schon darauf zu fließen, falls Lexie nein sagen würde. Eine Sekunde lang wog sie ab. Dann griff sie seufzend hinter sich, nahm das Glas und reichte es Bree zur Begutachtung. Es war nichts Besonderes – ein mit Glitzer verziertes hohes, schmales Glas mit goldener und silberner Schrift. Lexie hatte es gebastelt, als sie etwas jünger gewesen war als Bree jetzt.
Bree las die Worte langsam und stolperte über Lexies unsaubere Handschrift. Eine Handschrift, die, wenn man es genau bedachte, nie viel besser geworden war. Lexies Wunschglas.
Von der Tür des Zimmers, an der Bella jetzt lehnte, weil sie wohl doch die Neugier getrieben hatte, ertönte ein Schnauben. »Ein Wunschglas? Ernsthaft?«
»Was ist ein Wunschglas?«, fragte Bree.
Lexie wurde heiß. Es fühlte sich komisch an, darüber zu sprechen, und sie wollte nicht, dass irgendjemand sich darüber lustig machte, schon gar nicht Bella. Nur ihre Mutter wusste davon, sonst niemand. »Es ist ein Weihnachtsbrauch«, sagte sie abweisend und hoffte, das Thema sei damit erledigt.
»Aber was ist ein Wunschglas?«, wiederholte Bree, und Lexie wurde klar, dass sie nicht locker lassen würde.
Also gab sie nach. Offenbar war sie so konfliktscheu, dass sie sogar dem Streit mit einer Sechsjährigen aus dem Weg ging. »Jedes Jahr zu Weihnachten wünsche ich mir etwas, schreibe es auf einen kleinen Zettel, falte ihn zusammen und lege ihn in das Glas. Siehst du?« Sie zeigte auf die Zettel im Glas.
»Und sie gehen in Erfüllung?«, fragte Bree aufgeregt.
»Äh …«
»Natürlich nicht«, spottete Bella von der Tür aus. »Nichts geht einfach in Erfüllung, nur weil man es sich wünscht.«
Tja, da hatte sie wohl recht. Lexie musste an den einen großen Wunsch denken, als sie sieben war, den sie mit so viel Hoffnung in das Glas gesteckt hatte. Und der sich nicht erfüllt hatte.
Das Wunschglas gab es, seit sie vier war, und es war eine ihrer frühesten Erinnerungen. Die Idee stammte ursprünglich von ihrer Mutter, und jedes Jahr kurz vor Weihnachten holte Lexie das Glas wieder hervor und wählte sorgfältig ihren Wunsch. Die ersten Wünsche waren, im Nachhinein betrachtet, belanglos, auch wenn sie ihr damals bedeutend vorgekommen waren – ein neues Fahrrad, ein Hamster als Haustier. Und sie waren tatsächlich in Erfüllung gegangen. Obwohl sie mit zunehmendem Alter begriff, dass nicht wirklich Magie im Spiel war, hatte sie dennoch das Gefühl, dass ihrem Wunschglas vielleicht ein wenig Weihnachtszauber innewohnte, so wie ihre Mutter immer behauptet hatte. Bis zu dem Jahr, als diese Illusion zerbrach und sie auf die harte Tour lernte, dass es zwecklos war, sich etwas zu wünschen.
Doch das hielt sie nicht davon ab, die Tradition fortzusetzen. Es hatte etwas Kathartisches, einen Wunsch aufzuschreiben und ins Glas zu legen – als würde sie ihn loslassen.
»Das weißt du nicht«, sagte Bree und klang verletzt. Immerhin wirkte Bella ein wenig schuldbewusst und trat von einem Fuß auf den anderen. Vielleicht, weil sie Anfang der Woche beinahe ausgeplaudert hätte, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gab, und dafür einen strengen Blick von ihrer Mutter kassiert hatte.
»Ich will auch«, verkündete Bree und sah sich schon nach einem Zettel um. »Ich will einen Wunsch in das Wunschglas stecken. Ich glaube, ich wünsche mir einen Hund. Julie hat einen, und der ist so süß.«
Bella schnaubte verächtlich. »Du darfst uns nicht sagen, was du dir wünschst, sonst geht es nicht in Erfüllung.«
»Dann glaubst du also doch dran«, sagte Bree listig.
Bella verdrehte nur die Augen. Augenrollen war eine Kunst, die Bella perfekt beherrschte.
»Wo sind die Zettel?«, fragte Bree.
Lexie spürte Panik in sich aufsteigen. Sie wusste, es war albern, aber sie wollte nicht, dass jemand anderes einen Wunsch in ihr Glas steckte – nicht einmal die kleine Bree. Also stellte sie es weg und klatschte in die Hände. »Hey, ich habe eine Idee!«
Bree sah sie mit ihren großen blauen Augen an.
»Wie wäre es, wenn wir dir ein eigenes Wunschglas basteln?«
Bree war sofort Feuer und Flamme, und obwohl Bella partout kein eigenes wollte, half sie Bree, das Marmeladenglas zu verzieren, das sie gefunden hatten, und das reichte aus, um sie zu beschäftigen, bis Nicole und David nach Hause kamen.
Lexie war gerade in ihrem Zimmer, nachdem sie den Mädchen gute Nacht gesagt hatte, als eine Nachricht auf ihrem Handy einging.
Lust auf einen Absacker?
Mikkel. Sie lächelte bei dem Gedanken daran, wie sie ihn heute Morgen im Bett zurückgelassen hatte. Wie einfach es wäre, heute wieder mit ihm nach Hause zu gehen – ohne Verpflichtungen.
Sie zögerte kurz, zog sich dann aber schnell um und griff zu irgendeinem Oberteil, das nicht voller Glitzer war, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen. Viele Leute kamen direkt von der Piste, also war es nicht nötig, sich aufzubrezeln. Sie trug einen dezenten Lippenstift auf und etwas Wimperntusche, damit ihre braunen Augen nicht so müde wirkten. Nach kurzer Überlegung griff sie nach ihren Sternenohrringen, eine kleine Referenz an Weihnachten. Dann fuhr sie sich mit der Hand durch die dunklen Locken und antwortete Mikkel.
Bin in zehn Minuten da.
*
Mikkel fing Lexies Blick auf, als sie die Bar betrat und sich die Pudelmütze vom Kopf zog. Er grinste und winkte sie zu einer Ecke mit Bänken vor Holzwänden, die mit waldgrünem Lametta geschmückt waren. Lexie bahnte sich den Weg durch die Menge, vorbei an einem Weihnachtsbaum, so riesig, dass sie sich nicht erklären konnte, wie man ihn hier reingeschafft hatte, und atmete den Kiefernduft ein, der sich mit Bier und Schweiß vermischte. Mikkel rückte auf der Bank ein Stück zur Seite, um ihr Platz zu machen, und schob ihr ein Bier hin, als sie sich setzte.
»Guter Tag?«, fragte er.
»Ach, du weißt schon, das Übliche. Viel Glitzer mit einer Prise Sarkasmus.«
»Du musst morgen unbedingt mit auf die Piste.«
»Mach ich«, sagte sie kurzentschlossen. »Die Mädchen sind vormittags in der Skischule, da habe ich ein paar Stunden für mich.«
»Gut. Um elf habe ich eine Pause, da können wir ein paar Abfahrten zusammen machen.« Er lächelte und legte unter dem Tisch eine Hand auf ihr Knie.
»Was ist mit dir, Lexie?« Amelie, eine der regelmäßigen Saisonarbeiterinnen, schaute herüber, und Lexie trank stirnrunzelnd einen Schluck von ihrem Bier, während sie versuchte, dem Gespräch zu folgen. »Nächste Woche ist Weihnachten, was hast du vor?«
»Oh, ich schätze, die Familie erwartet, dass ich arbeite.«
»Das solltest du sie fragen«, sagte Amelie. »Bei Mikkel findet ein Truthahnessen statt. Wenn du Zeit hast, musst du auch kommen.«
»Ja, unbedingt«, sagte Mikkel. Er hatte tolle Augen – graublau, passend zu den hellen Haaren und dem blassen Teint, klassisch skandinavisch. Außerdem führte er ein typisches Nomadenleben und wirkte dabei vollkommen selbstbewusst und zufrieden, obwohl er nie länger als sechs Monate an einem Ort verbrachte, im Winter als Skilehrer und im Sommer als Surflehrer. Er war schon Anfang dreißig und schien trotzdem nie genug davon zu bekommen. Lexie hätte ihn zu gern ihren Freundinnen zu Hause präsentiert, die sich oft fragten, wann sie sich endlich einen »richtigen Job« suchen und »sesshaft« werden würde wie alle anderen.
Eingeklemmt am Ende der Bank, schälte Lexie sich mühsam aus ihrem Mantel und zog ihr Handy aus der Tasche. Ein verpasster Anruf. Sie biss sich auf die Lippe, als sie sah, von wem.
»Alles in Ordnung?«, fragte Mikkel.
»Ja. Es ist nur …« Wieder warf sie einen Blick auf ihr Handy. »Bin gleich wieder da, okay? Ich muss nur kurz telefonieren.«
»Okay. Beeil dich, wir trinken Shots.«
Lexie lachte. »Ich definitiv nicht … Muss morgen früh raus.«
Mikkel grinste. »Einer kann nicht schaden.«
Sie winkte ab, zog ihren Mantel wieder an und stapfte hinaus in den Schnee. Normalerweise hätte sie einem Anruf von ihrer Mutter keine große Beachtung geschenkt, doch sie hatte schon den letzten vor ein paar Tagen verpasst und wusste, dass sie sich Sorgen machen würde, wenn sie nicht bald von ihr hörte. Lexie suchte sich eine ruhige Ecke, doch auch hier dudelte die Weihnachtsmusik, die seit Wochen in Endlosschleife lief.
Das Telefon klingelte keine zweimal, bevor sich jemand meldete. »Hallo, Lexie, meine Süße.« Ihre sonst so fröhliche Stimme klang seltsam angespannt.
»Hi, Mum. Alles okay?«
»Ehrlich gesagt, nein.«
Lexies Herz setzte einen Schlag aus. »Was ist los?« Die kalte Luft vor ihr dampfte schlagartig. »Was ist passiert?«
»Es … Es geht um deinen Vater.«
Ihr Magen zog sich zu einer bleiernen Last zusammen. »Ich will es nicht wissen«, sagte sie knapp.
»Doch, das willst du«, sagte ihre Mutter, ihr sanfte Stimme ein Warnsignal. »Er ist … Er ist tot, Lexie.«
2. Kapitel
Die Beerdigung war ein Albtraum. Knapp dreißig Leute standen schweigend beieinander, und Lexie hätte sich am liebsten in Luft aufgelöst. Ihr Vater war nicht religiös gewesen, deshalb gab es keinen Pfarrer, und die Zeremonie fand auf einem Waldfriedhof statt, wo man das Rascheln der Tiere hören konnte, die mutig genug waren, sich in die Kälte hinauszuwagen. Obwohl sie im Schutz der Bäume standen, biss der eisige Wind in die Fingerspitzen und machte sie taub. Zwar regnete es nicht, aber die Luft war so feucht, dass sie sich drückend anfühlte. Und es war eine dumme Idee gewesen, hohe Absätze zu tragen. Sie hatte die schwarzen Schuhe im Haus ihrer Mutter ganz hinten im Schrank gefunden, doch jetzt bohrten sich die Absätze in den weichen Boden, sodass sie alle paar Minuten die Position ändern musste. Dann dachte sie, dass etwas mit ihr nicht stimmte, denn der Matsch auf ihren Schuhen beschäftigte sie mehr als der Tod ihres Vaters.
Ihr Vater war tot. Er war an Krebs gestorben, und sie hatte nichts davon geahnt. Sechs Monate hatte er versucht, dagegen anzukämpfen. Leberkrebs. Sie konnte es immer noch nicht ganz begreifen, es fühlte sich unwirklich an. Oder jedenfalls irgendwie von ihr losgelöst. Sie konzentrierte sich wieder auf die Worte der Trauerrednerin, die von einem großen Verlust sprach, dass Richard eine Naturgewalt gewesen sei, dass er die Menschen mitgerissen habe und sie ihn sehr vermissen würden. Lexie konnte den Mann, den sie gekannt hatte, nicht mit der Person in Einklang bringen, die beschrieben wurde. Wer hatte der Trauerrednerin diese Worte in den Mund gelegt?
Sie fragte sich, ob es Rachel gewesen war. Rachel, die inzwischen erwachsen war. Wie alt mochte sie sein, zweiundzwanzig? Als Lexie sie das letzte Mal gesehen hatte, war sie noch ein Teenager gewesen. Sie hatte die gleichen dunklen Locken wie Lexie und ihr Vater. Sonst hätte Lexie ihre Halbschwester vielleicht gar nicht wiedererkannt, die jetzt nach vorn ging, um davon zu sprechen, was für ein wunderbarer Vater er gewesen war. Sie erzählte, wie Richard sie an ihrem einundzwanzigsten Geburtstag mit einer Dinnerparty überrascht hatte. Mittendrin musste Rachel abbrechen, und der Zettel, von dem sie ablas, zitterte in ihren Händen, bis die Trauerrednerin ihr tröstend die Hand auf die Schulter legte.
Wo war Rachels Mutter?, fragte Lexie sich, während ihre eigene Mutter tröstend ihre Hand nahm. Sie hatte erwartet, dass ihre Stiefmutter – wenn man die Frau so nennen konnte, denn Lexie hatte sie kaum gekannt – an Rachels Seite eilen würde. Stattdessen war es eine Freundin von Rachel, etwa in ihrem Alter – ein großes Mädchen mit fast schwarzen Haaren. Währenddessen versuchte Lexie das, was Rachel über ihren Vater gesagt hatte, mit dem Mann zu vereinbaren, den sie selbst gekannt hatte. Sie dachte an ihren eigenen einundzwanzigsten Geburtstag, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte – der Moment, in dem sie beschlossen hatte, ihren Vater komplett aus ihrem Leben zu streichen.
Ja, die Beerdigung war ein Albtraum. Aber der Leichenschmaus war noch schlimmer. Er fand in Bath statt, im tristen Festsaal eines Mittelklassehotels, in dem bis auf den beigen Teppich alles weiß war, dazu dezente Weihnachtsdeko. Lexie hasste diese austauschbaren Hotelketten, deren Farblosigkeit man sich nicht entziehen konnte. Sie hatte kein Geld, um in teuren Hotels zu übernachten, aber wenn sie die Wahl hatte, versuchte sie, in unabhängigen Hotels unterzukommen, die von Einheimischen betrieben wurden. Natürlich war das nicht immer möglich, aber sie fand, dass man so einen besseren Eindruck von dem Ort bekam, an dem man sich aufhielt. Außerdem unterstützte sie gern kleine Betriebe.
Lexies Mutter drückte ihre Schulter. »Geht es dir gut, Süße?«
Lexie nickte. Gott sei Dank war sie hier. Sie wusste nicht, wie sie es ohne ihre Mutter geschafft hätte, einem Mann Respekt zu zollen, den sie kaum kannte, ihre Erinnerungen an ihn von Enttäuschung getrübt. Ihre Mutter hätte nicht mitkommen müssen – schließlich waren sie seit über zwanzig Jahren geschieden –, und vermutlich tat sie es nur für Lexie. Wie mochte es ihrer Mutter dabei gehen? Sie musste ihn geliebt haben. Genug, um ihn zu heiraten. Genug, um in ihrem Zimmer zu weinen, nachdem er sie verlassen hatte, in dem Glauben, Lexie könnte sie nicht hören.
»Und dir?«, fragte Lexie, und ihre Mutter lächelte sie beruhigend an. Ihr Lächeln war so schön, so warm. Es erschien Lexie ungerecht, dass sie mehr von ihrem Vater als von ihrer Mutter hatte – die dunklen Locken, die trüben braunen Augen. Der Körperbau ihrer Mutter ähnelte ihrem, aber ihre Gesichtszüge waren weicher, ihr Haar war honigblond, inzwischen gefärbt, und sie hatte ein weiches, herzförmiges Gesicht, das sofort freundlich wirkte – während Lexies markant war, mit einer zu großen Stirn.
»Ich muss auf Toilette«, sagte ihre Mutter. »Kann ich dich eine Minute allein lassen?«
»Natürlich.« Denn was hätte sie sagen sollen? Nein, Mum, bitte bleib? Noch während sie ihrer Mutter nachsah, wurde ihr heiß unter dem hochgeschlossenen schwarzen Kleid. Es war eines der wenigen schwarzen Kleider, die sie besaß, und stammte noch von ihrem kurzen Abstecher in die Londoner Bürowelt, wo sie es gerade mal acht Monate ausgehalten hatte. Sie nahm sich ein Würstchen im Blätterteig, Futter für die Seele, und bestellte sich an der Bar ein Glas Rotwein.
Hatten Rachel und Jody, Rachels Mutter, die Trauerfeier organisiert? Sie riskierte einen Blick in die Runde. Rachel saß mit ihrer dunkelhaarigen Freundin in einer Ecke, umringt von Menschen, die ihr Beileid aussprachen, aber Jody konnte Lexie nirgends entdecken. Sie wusste, dass Richard auch sie vor ein paar Jahren verlassen hatte – vielleicht war Jody nicht so nachsichtig wie Lexies Mutter, obwohl sie länger mit Richard verheiratet gewesen war. Was hatte Richard wohl dazu bewogen, sie zu verlassen? Schlichtweg Langeweile, wie bei seiner ersten Familie?
Sie sollte rübergehen und mit Rachel reden. Vorhin hatten sie sich kurz mit einer verlegenen Umarmung begrüßt, aber nicht wirklich miteinander gesprochen. Es wäre nur höflich zu fragen, wie es ihr ging. Lebte sie noch in Wales? Lexie hatte keine Ahnung. Und es war ja nicht Rachels Schuld, dass ihr Vater beschlossen hatte, eine neue Familie zu gründen – Rachel war zwischen die Fronten geraten. Aber das machte es nicht leichter, und sie war sich nicht sicher, ob sie emotional bereit war, die Art von Gespräch zu führen, die von ihr erwartet wurde. Außerdem hatte Rachel jeden Blickkontakt vermieden. Zwischen ihnen lag ein Altersunterschied von sieben Jahren – was bedeutete, dass Richard Lexies Mutter schon vor der Trennung betrogen hatte – und bei ihren seltenen Begegnungen hatten sie kaum etwas miteinander anfangen können, weil ihnen der Altersunterschied als Kinder gigantisch vorgekommen war. Inzwischen waren sie beide erwachsen, aber was sollte man zu einer Schwester sagen, die man kaum kannte? Was sollte man auf der Beerdigung des Mannes sagen, der auf dem Papier ihrer beider Vater war?
Lexie umklammerte ihr Weinglas fester und versuchte, die Wut zu unterdrücken, die aus dem Nichts aufzusteigen schien. Und dann war da noch die Schuld, die auf ihr Gewissen drückte. Weil sie kein guter Mensch war, weil kein Tag verging, an dem sie nicht wütend auf ihren Vater war, weil sie es nicht schaffte, Rachel eine echte Schwester zu sein. Sie spürte, wie Tränen in ihren Augen brannten, und versuchte, sie wegzublinzeln. In Wahrheit hatte sie ihren Vater schon vor vielen Jahren verloren, es gab keinen Grund, jetzt zu weinen. Sie sollte gar nicht hier sein. Sie hätte in Österreich bleiben sollen, bei den Mädchen und ihren Freunden.
Sie spürte, wie das Handy in ihrer Handtasche vibrierte. Es war eine Nachricht von Fran, einer der wenigen Menschen aus ihrer Heimat, mit denen sie befreundet geblieben war, als sie mit achtzehn an die Uni gegangen war. Seitdem hatte sie es sich zur Aufgabe gemacht, nie lange an einem Ort zu bleiben.
Ich hoffe, dir geht’s gut. Ruf mich nachher an, wenn du reden möchtest.
Lexie atmete flatternd aus. Aus irgendeinem Grund rührte sie die Nachricht noch mehr zu Tränen. Sie und Fran waren in Frome, in der Nähe von Bath, auf dieselbe Schule gegangen. Fran lebte jetzt in Bath und hatte angeboten, heute mitzukommen. Sie erinnerte sich, Richard ein paarmal getroffen zu haben, als sie Teenager waren. Aber es hatte sich unpassend angefühlt, eine Freundin zur Beerdigung ihres Vaters mitzubringen. Trotzdem sollte sie sich Zeit für einen Kaffee mit Fran nehmen, bevor sie nach Österreich zurückflog.
Lexie sah sich nach ihrer Mutter um, während sie an ihrem Wein nippte. Ernsthaft, wie lange konnte man brauchen, um auf Toilette zu gehen? Ihr Blick fiel auf eine Frau mit einem gepflegten grauen Bob. Sie bemerkte, dass Lexie sie anstarrte, obwohl sie schnell den Blick abwandte. Daraufhin drückte die Frau dem großen dunkelhaarigen Mann, mit dem sie sich unterhielt, ihr leeres Glas in die Hand und kam schnurstracks auf Lexie zu.
Lexie spürte, wie Panik in ihr aufstieg. Bisher war es ihr gelungen, Beileidsbekundungen aus dem Weg zu gehen und alles zu vermeiden, was sie als Familienmitglied entlarvt hätte. Als sie jemanden sagen hörte: »Hatte er nicht zwei Töchter?«, war sie schnell in die andere Richtung gegangen. Aber jetzt war da diese Frau, die sehr zielstrebig auf sie zusteuerte. Der Raum war zu klein, um in der Menge unterzutauchen, und es gab niemanden in ihrer Nähe, den sie in ein Gespräch verwickeln konnte, sodass Lexie sich zwar hektisch umsah, aber regungslos stehen blieb, bis die Frau vor ihr stand. Sie hatte sehr auffällige blassgrüne Augen, die Lexie abschätzig musterten. Die Frau trug ein schwarzes Kleid und hochhackige Stiefel, die auf wundersame Weise vom Matsch verschont geblieben waren. Ihre Lippen waren knallrot geschminkt, die Augenbrauen zu einem perfekten Bogen gezupft.
»Du kennst mich wahrscheinlich nicht«, sagte sie zur Begrüßung.
»Äh …« Lexie versuchte, sie einzuordnen.
»Aber du bist Lexie.« Die Frau lächelte, irgendwie effizient und herzlich zugleich.
Sie wusste nicht, was sie darauf sagen sollte, außer »Ja«.
»Ich habe für deinen Vater gearbeitet.«
»Oh. Okay.« Sie trug Segelboot-Ohrringe, fiel Lexie auf. Mitten in all dem Schwarz trug diese Frau große, bunte Segelboot-Ohrringe.
»Du bist etwas älter als auf den Fotos, die er von dir hat, aber ich würde dich überall wiedererkennen.« Sie musterte Lexie erneut von oben bis unten, als wollte sie sich vergewissern, und die Segelboote schaukelten. »Du alterst gut.«
»Ähm … Danke.« Ihr Vater hatte Fotos von ihr? Irgendwie bezweifelte sie das, und mit dem Zweifel kam sofort das Misstrauen gegenüber dieser Frau.
»Das ist kein Kompliment, sondern eine Tatsache. Ich war Richards persönliche Assistentin, seit er die Firma gegründet hat.«
Lexie nickte langsam, unsicher, worauf das Gespräch hinauslief. Hoffentlich ging es nicht um die Firma ihres Vaters. Sie wusste kaum etwas darüber – außer, dass es die Firma gab und ihr Vater sie vor etwa fünf Jahren gegründet hatte, als er seine zweite Familie verlassen hatte und nach Bath gezogen war. Es hatte etwas mit Reisen zu tun, aber das war auch schon alles, was sie wusste.
»Du fragst dich sicher, was denkt sich diese fremde Frau dabei, mich auf der Beerdigung meines Vaters zu belästigen«, fuhr sie fort. »Aber ich sehe keine andere Möglichkeit.«
»Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht …«
»Du musst übermorgen ins Büro deines Vaters kommen. Es findet eine Besprechung statt, und du musst dabei sein.«
Lexie starrte die Frau an und wartete darauf, dass sie noch etwas sagte. Als sie das nicht tat, ergriff Lexie das Wort. »Was um alles in der Welt hätte ich dort zu suchen?«
»Das kann ich jetzt nicht erklären. Es würde zu lange dauern, und es ist weder der richtige Ort noch der richtige Zeitpunkt. Aber es betrifft dich und noch ein paar andere, also ist es am besten, wenn alle dabei sind.«
Lexie wartete auf weitere Erklärungen, aber es kam nichts mehr. »Tut mir leid«, sagte sie bemüht höflich, »aber ich habe absolut keine Ahnung, wovon Sie reden.«
»Nein. Kann ich mir vorstellen.« Das Gesicht der Frau wurde weicher, und ihre grünen Augen füllten sich mit so viel Mitgefühl, dass sich Lexie die Kehle zuschnürte. »Mir tut es leid. Wirklich. Aber du wirst es verstehen, wenn du ins Büro kommst. Weißt du, wo das ist?«
»Äh …«
»Egal, ich gebe dir die Adresse.« Sie kramte in ihrer knallroten Handtasche, die wie ihre Ohrringe aus dem Schwarz hervorstachen, und überreichte Lexie eine Karte.
Angela Wilson. Persönliche Assistentin. R&L Travel. Die Welt ist ein Fest.
So also hieß die Firma ihres Vaters. Sie runzelte die Stirn. Ein nichtssagender Name, fand sie. Und der Slogan ergab überhaupt keinen Sinn. Dann fiel ihr Blick auf die erste Zeile. Angela. Erst jetzt wurde Lexie bewusst, dass die Frau sich nicht mit ihrem Namen vorgestellt hatte.
»Wirst du da sein?«, fragte Angela. »Übermorgen, um elf Uhr vormittags.«
»Ich weiß wirklich nicht …«
»Es wird sich alles klären, versprochen.« Angela bedachte sie erneut mit einem warmen Lächeln, das kleine Fältchen um ihre Augen warf. »Auf Wiedersehen. Und es war schön, dich endlich kennenzulernen, Lexie.«
Lexie fragte sich, wie sie einer Sache zustimmen konnte, ohne zuzustimmen. Sie würde sich einfach eine Ausrede einfallen lassen müssen. Eine ansteckende Krankheit vortäuschen oder so etwas. Sie trank ihren Wein aus, stellte das Glas auf den Tresen und sah endlich ihre Mutter auf sich zukommen.
Lexie blickte wieder auf die Karte in ihrer Hand. »Kennst du jemanden namens Angela Wilson?«, fragte sie, als ihre Mutter näher kam.
»Ange? Ich glaube, sie ist die persönliche Assistentin deines Vaters. Oder war«, fügte sie nach einer Pause hinzu und tätschelte Lexies Arm. »Wie geht es dir, Lex?«
»Ich bin … Gott, ich weiß nicht.« Aus den Augenwinkeln sah sie, dass Rachel immer näher kam. Bald würden sie nebeneinanderstehen. Doch Rachel sah nicht in ihre Richtung – vermutlich wollte sie einem Gespräch genauso sehr aus dem Weg gehen wie Lexie.
»Mum, ich glaube, ich will lieber gehen. Ich hab ein bisschen Kopfschmerzen.« Das war nicht gelogen. Sie spürte den Druck wie ein enges Band um den Kopf.
»Okay, Süße, ich fahre dich.«
»Nein, du …«
Ihre Mutter bedachte sie mit einem strengen Blick. »Lexie, du schläfst bei mir. Wie willst du sonst nach Frome zurückkommen? Außerdem will ich auch nach Hause, glaube ich.« Sie sah sich um, und Lexie fragte sich wieder einmal, woher ihre Mutter die Kraft nahm, das alles mit Anmut und Würde durchzustehen. »Ich muss mich nur schnell von ein oder zwei Leuten verabschieden, wir treffen uns draußen, okay?«
Lexie gehorchte, froh über klare Anweisungen. Sie zog ihren Mantel an und konzentrierte sich ganz auf ihre Füße, um niemandem in die Augen sehen zu müssen, als sie mit einem harten Körper zusammenstieß. Sie schwankte ein wenig und spürte, wie eine Hand ihren Arm ergriff, um sie zu stützen.
Sie blickte auf. Es war der Mann, den sie vorhin mit Angela hatte reden sehen – dunkles Haar, markantes Kinn mit Bartschatten und eine schwache Narbe unter einer Augenbraue.
»Tut mir leid.« Seine Stimme war tief, und ein bisschen rau. »Ich habe nicht aufgepasst, wo ich …«
Ihre Blicke trafen sich. Sie Augen waren dunkler als ihre eigenen, mit einem bernsteinfarbenen Schimmer in der Mitte, der sie an glühende Kohlen erinnerte.
Seine Hand glitt von ihrem Arm, und er sah sie stirnrunzelnd an. »Du gehst schon?«, fragte er, und sie war sicher, Missbilligung in seiner Stimme zu hören. Vielleicht wusste er, wer sie war – eine von Richards Töchtern, die sich vor der Beerdigung drückte.
»Ich …« Sie räusperte sich und riss sich zusammen. Dieser Fremde hatte kein Recht, über sie zu urteilen. »Ja. Wenn es Ihnen also nichts ausmacht …« Lexie deutete auf die Tür und gab ihm zu verstehen, dass er ihr im Weg stand.
Er nickte ihr kurz zu und machte dann einen Schritt zur Seite, damit sie vorbeikonnte.
Sie eilte davon und zog den Mantel enger. Bevor sie um die Ecke in die Hotellobby bog, warf sie noch einen kurzen Blick über die Schulter. Der Fremde wandte sich gerade ab, aber sie sah noch den finsteren Blick in ihre Richtung. Ernsthaft? Was hatte der Typ für ein Problem? Sie versuchte, nicht weiter darüber nachzudenken, als sie aus dem Hotel in die kalte, feuchte Luft trat, um auf ihre Mutter zu warten. Sagte sich, dass sie sich die Missbilligung in seiner Stimme nur eingebildet hatte. Sie machte sich immer viel zu viele Gedanken.
3. Kapitel
Lexie stand auf der Straße vor R&L Travel. Das Büro lag oberhalb vom Stadtzentrum, zwischen wunderschönen, goldenen Altbauten mit großen, einladenden Schaufenstern im Erdgeschoss und herrschaftlichen Wohnungen über den Geschäften. Der Himmel war heute strahlend blau, die Luft frisch und kalt und die Straßen voller Leute, die ihre Weihnachtseinkäufe erledigten. Lexie stellte sich vor, wie schön die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit sein musste, wenn die Weihnachtsbeleuchtung anging.
Sie war an einigen Weihnachtsständen vorbeigekommen, und der Duft von gebrannten Mandeln lag in der Luft. Es erinnerte sie an den Weihnachtsmarkt in Deutschland, auf dem sie als Kind gewesen war. Viel wusste sie nicht mehr, aber sie erinnerte sich vage, wie sie sich an der Hand ihres Vaters festgehalten hatte, der eine Tüte Mandeln hielt, und an das warme Lachen ihrer Mutter. Kopfschüttelnd verscheuchte sie die Erinnerung. Sie war erst sieben, als ihr Vater sie verließ, und sie dachte nicht gern daran zurück. Doch davor, als sie noch eine dreiköpfige Familie gewesen waren, verreisten sie jedes Jahr zu Weihnachten, ohne Ausnahme. Nicht immer ins Ausland, aber jedes Mal woanders hin. Ihre Eltern sparten das ganze Jahr dafür. Sie hatte nie gefragt, warum. In Anbetracht der Firma, die ihr Vater gegründet hatte, war es vielleicht seine Idee gewesen. Nachdem er fort war, blieben sie zu Hause, wahrscheinlich weil ihre Mutter es sich nicht leisten konnte. Lexie erinnerte sich an ihr erstes Weihnachten allein, als ihre Mutter ihr mit rotgeweinten Augen eine heiße Schokolade reichte und sich dafür entschuldigte, dass ihr Vater nicht gekommen war. Der ganze Tag war verdorben, jede Hoffnung zerschlagen. Alles, was sie in diesem Jahr bekommen hatte, war eine Weihnachtskarte mit einem Zehn-Pfund-Schein darin. Und diese Tradition einer Karte mit Geld hatte er Jahr für Jahr fortgesetzt.
Reiß dich zusammen, Lexie.
Sie straffte die Schultern, als sie das Gebäude betrat. Der Laden war kundenfreundlich eingerichtet, überall Urlaubsprospekte, damit man stöbern konnte. Eine Wand war vollständig mit Fotos von glücklichen Menschen im Urlaub bedeckt, vermutlich hatten sie hier gebucht und störten sich nicht daran, dass ihre Schnappschüsse öffentlich ausgestellt wurden. An den anderen drei Wänden hingen diverse Kunstwerke, die keine offensichtliche Verbindung zueinander hatten. Aber irgendwie funktionierte es. Trotz ihres Unbehagens musste Lexie zugeben, dass ihr der Laden gefiel. In einer Ecke stand ein Weihnachtsbaum mit Geschenken darunter – vermutlich Attrappen – und auf dem Empfangstresen eine Schale mit Schokotalern. Im Hintergrund lief Last Christmas.
Ein Mann, der gerade mal Anfang zwanzig sein konnte, mit schlaffen blonden Haaren und Brille, blickte auf. Er lächelte beängstigend enthusiastisch und zeigte ihr die Zähne, während er aufsprang und auf sie zueilte. Er trug eine Weihnachtskrawatte, knallrot mit weißen Schneeflocken. »Hallo, kommen Sie doch rein. Möchten Sie nur schauen, oder kann ich …?«
Lexie zuckte unwillkürlich zurück, doch eine keifende Stimme zu ihrer Linken ersparte ihr die Antwort. »Nein, Harry, sie ist nicht hier, um einen Urlaub zu buchen. Und versuche bitte, ein bisschen weniger so auszusehen, als würdest du sie die Straße runterjagen und ihr einen Prospekt über den Schädel ziehen, wenn sie den Laden verlässt. Aber gut gemacht, das war schon besser.«
Lexie fragte sich, was die übliche Begrüßung war, wenn das schon besser war. Angela trug ein gepunktetes Kleid über schwarzen Strumpfhosen, die Lippen dasselbe Rot wie bei der Beerdigung. Ihre Ohrringe hatten heute die Form von Weihnachtsbäumen.
»Komm rein, Lexie.« Sie lächelte. »Die anderen sind alle schon oben und warten auf dich.«
Lexie folgte Angela durch den Laden und spürte Harrys neugierigen Blick im Rücken. Sie trug einen roten Rollkragenpullover und Jeans und fragte sich plötzlich, ob sie sich formeller hätte kleiden sollen. Gott, sie sollte gar nicht hier sein. Hätte sich nicht von ihrer Mutter überreden lassen dürfen. Ihr Magen krampfte sich zusammen, als sie durch die Hintertür trat und Angela die Treppe hinauf folgte.
Oben angekommen, führte Angela sie durch eine Tür mit einer goldenen Nummer Zwei in den Eingangsbereich einer Wohnung.
»Ähm …«, begann Lexie.
Angela lächelte ihr über die Schulter zu. »Komm nur, sie sind gleich hier.« Sie führte Lexie in eine offene Wohnküche und trat hinter die Kochinsel auf den gefliesten Küchenboden. »Wir dachten, wir machen die Besprechung hier oben, das ist etwas zwangloser, und außerdem unterbricht uns Harry hier nicht alle fünf Minuten mit irgendeiner Frage. Möchtest du eine Tasse Tee? Oder Kaffee? Wasser?«
»Ähm, nur Wasser, danke.«
Sie sah sich um und entdeckte zwei Männer im angrenzenden Wohnzimmer. Einer, mit schütterem Haar und Lesebrille, leckte sich die Finger, während er durch einen Stapel Papiere blätterte, der andere hatte dunkles Haar und steckte sich gerade einen Zettel in die Jeanstasche. Er starrte aus dem großen Sprossenfenster zu seiner Linken, sodass sie sein Gesicht nicht sehen konnte. Keiner von beiden schien zu bemerken, dass sie reingekommen waren.
Lexie senkte die Stimme. »Was mache ich hier, Angela?«
»Nenn mich Ange, das tun alle.« Sie reichte Lexie ihr Wasser und deutete auf die beiden Männer, die um einen Glastisch saßen.
»Gehört das zum Büro?«, fragte Lexie. Der Mann mit dem schütteren Haar schien sie zu bemerken, blickte von seinen Unterlagen auf, nahm seine Lesebrille ab und lächelte sie höflich an. Lexie nickte ihm zu, ging weiter ins Wohnzimmer – und blieb wie angewurzelt stehen. Denn jetzt konnte sie das Gesicht des dunkelhaarigen Mannes sehen. Des Mannes, der, wie sie wusste, obwohl er unverwandt aus dem Fenster blickte, dunkelbraune Augen mit einem bernsteinfarbenen Schimmer in der Mitte hatte. Es war der Mann von der Beerdigung, der sie so missbilligend angesehen hatte, als sie gegangen war. Dessen vernichtender Blick sie noch immer verfolgte.
»Was zum Teufel macht er hier?«
Sie platzte unbedacht damit heraus, obwohl sie gar nicht vorgehabt hatte, es laut auszusprechen, und spürte, wie ihr die Hitze ins Gesicht schoss, als er sich zu ihr umdrehte und eine Augenbraue hochzog – die mit der Narbe.
Wer war dieser Typ? Warum war er hier, in dieser Wohnung über dem Büro ihres Vaters? Was ging hier vor?
»Setz dich, Lexie«, sagte Angela – Ange. Sie hatte den anderen Sessel gegenüber von dem Mann mit der Halbglatze eingenommen, sodass nur noch ein Platz neben dem Mann auf dem Sofa frei war. Sie zögerte, sah aber keine andere Möglichkeit, also setzte sie sich ans andere Ende des Sofas und schlug ein Bein über das andere, um möglichst wenig Raum zu beanspruchen.
»Also, Lexie«, sagte Ange, offenbar ohne ihr Unbehagen zu bemerken, »das ist Howard, der Anwalt deines Vaters.«
Howard lächelte wieder höflich. »Schön, dich kennenzulernen, Lexie. Obwohl ich wünschte, die Umstände wären erfreulicher.«
»Der Anwalt?« Lexie setzte sich etwas aufrechter hin. »Moment, Sie sind doch nicht … Geht es um das Testament meines Vaters …?«
»Es geht um seinen letzten Willen, ja«, sagte Howard leise.
Lexie sah zu Ange. Dass sie als persönliche Assistentin ihres Vaters hier war, machte Sinn. Aber wer war dieser finster blickende Mann? Und warum stand sie überhaupt im Testament? Sie spürte, wie sich Kopfschmerzen in ihren Schläfen ausbreiteten.
»Tut mir leid, dass ich so begriffsstutzig bin …«
Sie unterbrach sich, als der Mann neben ihr leise schnaubte, so leise, dass sie nicht sicher war, ob sie es sich nur eingebildet hatte. Als weder Ange noch Howard reagierten, fuhr sie fort.
»Aber könnte mir bitte jemand erklären, worum es hier geht? Hat mir mein Vater etwas hinterlassen? Oder brauchen Sie eine Unterschrift?« Sie und Rachel waren vermutlich die nächsten Angehörigen – sollte sie etwas absegnen? Sie warf einen Blick zur Eingangstür und fragte sich, ob Rachel auch noch kommen würde. War Rachel jemand, der immer zu spät kam? Sie hatte keine Ahnung.
Der Anwalt legte seine Unterlagen auf den Glastisch und verschränkte die Hände im Schoß. »Ich komme gleich zur Sache. Nach dem letzten Willen deines Vaters sollst du die Hälfte von R&L Travel erben.«
Sie blinzelte ihn an, denn die Worte ergaben für sie überhaupt keinen Sinn. »Tut mir leid. Ich verstehe nicht.«
»R&L Travel. Die Firma, die dein Vater gegründet hat.« Er deutete auf die Reiseprospekte, die überall verstreut lagen. »Die Hälfte davon gehört jetzt dir.«
Der Mann neben ihr biss die Zähne so fest zusammen, dass die Muskeln in seinem Kiefer zuckten. Lexie schluckte und wischte sich die Hände an der Jeans ab. Warum war es hier so heiß? Und was hatte es zu bedeuten, dass er ihr seine Firma vermacht hatte?
Ange nahm den Gesprächsfaden auf. »Lexie, ich weiß, das ist vielleicht ein kleiner Schock, vor allem, weil dein Vater vor seinem Tod keine Gelegenheit mehr hatte, es dir zu sagen, aber …«
»Ich will sie nicht«, platzte sie heraus.
Der Anwalt und Ange sahen sie an – und der Mann neben ihr jetzt auch. Sie Blick brannte auf ihrer Haut, und am liebsten hätte sie zurückgestarrt. Wer war er überhaupt, eine Art Anwaltsgehilfe?
»Das ist …« Lexie schluckte. »Hören Sie, das muss ein Irrtum sein. Ich habe kein Interesse an dieser Firma. Ich weiß nicht mal, um was es dabei geht.«
»Das ist kein Irrtum«, sagte Howard sanft, »die Hälfte der Firma gehört jetzt dir – und die andere Theo.« Er deutete auf den Mann neben ihr.
Sie stieß einen ungläubigen Laut aus. »Was?« Sie drehte sich zu Theo um. »Wer sind Sie überhaupt?«
»Ich bin Theo«, sagte er ausdruckslos.
»Das habe ich schon kapiert, danke, aber was …?«
»Theo hat mit deinem Vater zusammengearbeitet«, warf Ange ein, »fast seit der Gründung der Firma.«
Das Pochen in ihren Schläfen wurde stärker, und Lexie legte die Hände an den Kopf. »Und was …?« Sie deutete auf Theo. »Sollen wir die Firma aufteilen? Verkaufen wir und teilen den Gewinn oder so?«
Howard räusperte sich. »Na ja, da gibt es ein paar Bedingungen.«
»Natürlich gibt es die.«
Lexie spürte, wie Theo erneut die Augenbrauen hochzog, aber sie weigerte sich, ihn anzusehen. Sie konnte auch cool und distanziert sein, wenn er es darauf anlegte.
»Wenn ihr die Firma verkaufen und den Gewinn teilen wollt, seid ihr zunächst verpflichtet, die Firma ein Jahr lang gemeinsam zu leiten.«
Lexie starrte ihn an. »Die Firma leiten?«
»Genau. Und wenn ihr am Ende des Jahres Gewinn erwirtschaftet habt, dürft ihr die Firma verkaufen, falls ihr das beide dann noch wollt. Aber wenn ihr keinen Gewinn macht, seid ihr für weitere fünf Jahre an das Unternehmen gebunden. Danach entscheidet ihr, wie es weitergehen soll.«
Alles um sie herum drehte sich. Konnte denn niemand ein Fenster öffnen, oder waren das nur Attrappen? Sie fühlte sich gefangen wie in einem Käfig – sie konnte bis zu sechs Jahre an einen Job gebunden sein, den sie gar nicht wollte. Dabei hielt sie es nicht mal sechs Monate am selben Ort aus. »Und wenn ich das nicht will? Wenn ich nur meine Hälfte verkaufen will?«
Etwas gequält sah Howard zwischen Theo und Lexie hin und her. »Es ist wichtig, dass ihr eine gemeinsame Entscheidung trefft, aber wenn ihr euch jetzt für den Verkauf entscheidet, würdet ihr laut Testament mit nichts dastehen – der Gewinn würde in die Firma fließen, also an den, der sie übernimmt.«
»Unglaublich«, murmelte Theo.
»Theo«, schimpfte Ange. Er warf ihr einen finsteren Blick zu, aber sie schüttelte den Kopf. »Sieh mich nicht so an, du solltest es besser wissen.«
Er hielt den Blick weiter auf sie gerichtet, und Ange zog die Augenbrauen hoch, fast als wollte sie ihn herausfordern. Sein Gesicht entspannte sich etwas, als er sich mit verschränkten Armen auf dem Sofa zurücklehnte. Eins zu null für Ange.
»Du musst doch zugeben, dass das völlig lächerlich ist«, fuhr er fort, sichtlich bemüht, ruhig zu bleiben. Jetzt, da er es geschafft hatte, mehr als zwei Worte aneinanderzureihen, konnte sie den Hauch eines irischen Akzents heraushören. »Sie hat sich nie dafür interessiert, was Richard aufgebaut hat, oder? Sie hat selbst gesagt, dass sie keine Ahnung hat, was wir hier machen. Sie war noch nie hier. Ich bin überrascht, dass sie überhaupt hergefunden hat.« Dann sah er Lexie kopfschüttelnd an. »Nichts für ungut, aber hast du überhaupt eine Ahnung, wie man ein Geschäft führt?«
Lexie spürte, wie ihr heiß wurde, aber diesmal nicht vor Verlegenheit. »Und du, bist du der Unternehmer des Jahres?« Er sah sie nur an, offenbar unbeeindruckt von ihrem Versuch, ihn zu beleidigen. Klar war er genervt, aber er schien nicht überrascht. Sie fragte sich, ob er es schon bei der Beerdigung ihres Vaters gewusst hatte. Vielleicht hatte es ihn gar nicht gestört, dass sie früher gegangen war. Er hatte einfach generell etwas gegen sie.
Lexie wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Anwalt zu. »Gibt es eine Möglichkeit, wie ich aus der Sache rauskomme?«
Howard lächelte mitfühlend. »Ich fürchte nicht.«
Lexie sah zwischen Howard und Ange hin und her und hoffte, dass einer von beiden sagen würde: Haha, reingefallen. »Ich soll also die Firma meines Vaters führen, zusammen mit jemandem, von dem ich noch nie gehört habe?«
Theo fühlte sich zu einer Antwort bemüßigt: »Warum solltest du auch von mir gehört haben? Du hast dir nie die Mühe gemacht, die Anrufe deines Vaters entgegenzunehmen oder dich nach seinem Leben zu erkundigen. Außerdem bist du immer unterwegs.«
Lexie fühlte sich getroffen, obwohl sie wusste, dass es dumm war. »Du kennst mich doch gar nicht«, fuhr sie ihn an. »Du hast keine Ahnung, was ich …«
Ange hob beschwichtigend die Hände. »Okay. Ganz ruhig. Howard ist ein vielbeschäftigter Mann, und ich bin sicher, er würde gern zum Schluss kommen.«
Lexie atmete tief durch und versuchte, sich zu beherrschen. Normalerweise war sie die Ruhe selbst, aber wer konnte angesichts solcher Umstände ruhig bleiben. »Was ist mit Rachel?«
Es gab eine Pause, dann sagte Howard: »Dein Vater hat ihr das Haus vermacht.«
»Das Haus?«
»Es liegt etwas außerhalb von Bath, eigentlich nur ein kleines Cottage.«
Lexie fragte sich kurz, ob er das nur sagte, um den Schock zu mildern. Tja, das brachte es auf den Punkt. Rachel, die Lieblingstochter, erbte ein Haus, während man ihr einen Job aufdrückte, den sie gar nicht haben wollte. Nicht nur das, sie wurde auch noch gezwungen, mit einem Typen zusammenzuarbeiten, der sie ganz offensichtlich zutiefst verachtete. Rachel dagegen musste keinerlei Verpflichtungen eingehen und konnte das Cottage vermutlich einfach verkaufen. Ganz toll, Richard.
»Nein. Ich kann das nicht«, sagte Lexie kopfschüttelnd.
»Welch Überraschung«, murmelte Theo.
»Theo!«, schimpfte Ange.
Er hob kapitulierend die Hände.
»Warum lässt du das alles nicht erst mal sacken, Lexie?«, sagte Ange. »Howard, du stehst doch zur Verfügung, falls Lexie noch Fragen hat, oder?«
»Natürlich. Ich lasse dir meine Karte da, du kannst mich jederzeit anrufen.«
Howard stand auf und sammelte seine Unterlagen ein. Waren sie fertig, einfach so?
»Möchtest du noch einen Augenblick hier oben sitzen bleiben? Ich mache dir eine Tasse von meinem ausgezeichneten Tee.«
Lexie schaute sich in der Wohnung um. Die Wände waren hellblau, ein bisschen kahl, keinerlei Weihnachtsdeko. »Gehört das zum Büro?«
»Nein, das ist meine Wohnung«, sagte Theo ohne Umschweife.
Ange bedachte ihn mit einem strengen Blick. »Zügele dein Temperament, junger Mann, sonst müssen wir uns unterhalten. Du weißt ganz genau, dass Lexie nichts dafür kann. Außerdem ist es nicht deine Wohnung.« Sie lächelte Lexie an. »Sie gehört der Firma, aber zurzeit hat Theo sie gemietet. Wir nutzen sie für Meetings und gelegentlich für Drinks mit den Mitarbeitern.«
»Wenn wir damit fertig sind, Richards Vermögen aufzuteilen, als hätte der Mann nie existiert, gehe ich jetzt nach unten und kümmere mich um die Firma, die ich die letzten Jahre zusammen mit ihm geleitet habe.«
Theo stand vom Sofa auf, ohne Lexie noch eines Blickes zu würdigen.
Ange sah ihm stirnrunzelnd nach. »Du musst Theo verzeihen.« Sie seufzte. »Na ja, du musst ihm nicht verzeihen, ich weiß nicht, ob ich das könnte, so wie er sich gerade benimmt, aber glaub mir, wenn ich dir sage, dass er nicht immer so ist. Ich schätze, er fühlt sich ein bisschen verloren ohne Richard.«
Lexie wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Weder auf die Behauptung, dass er nicht immer so war, noch auf die Implikation, dass dieser Theo eine Beziehung zu ihrem Vater hatte, die über die Arbeit hinausging. Schwer vorstellbar. Sie vermutete, dass Theos Verhalten eher dem potenziellen Verlust einer großen Geldsumme geschuldet war, und obwohl sie seinen Groll verstand, gab ihm das noch lange nicht das Recht, sich wie ein Arschloch aufzuführen, egal, was Ange sagte.
»Ich glaub, ich geh lieber«, sagte Lexie und stand auf. Absurd. Die ganze Sache war total absurd. »Ich bin sowieso mit einer Freundin zum Kaffeetrinken verabredet.« Fran! Fran, die Anwältin war. Tja, mal sehen, was Fran dazu zu sagen hatte. Es musste doch einen Ausweg geben.
»Okay, mach das. Sprich es durch, ja? Wir sehen uns dann morgen.«
»Morgen?«, wiederholte Lexie verständnislos.
»Ich dachte, es wäre gut, dir alles zu zeigen, damit du weißt, worauf du dich einlässt.« So wie sie es sagte, klang es, als hätte Lexie ein Mitsprachrecht. »Über Weihnachten haben wir ein paar Tage geschlossen«, fuhr Ange fort, »also sollten wir das vorher erledigen. Morgen kannst du erst mal ausschlafen und dann nachmittags vorbeikommen, okay?« Und während Ange sie die Treppe hinunterführte, fühlte Lexie sich schon wieder überrumpelt, und als hätte sie im Grunde keine Wahl.
4. Kapitel
Lexie saß bei ihrer Mutter auf dem Sofa, eine Decke um die Knie gewickelt, und nippte an dem Glühwein, den ihre Mutter gemacht hatte. »Gemacht« war ein Euphemismus für aufgewärmt – es handelte sich um Fertig-Glühwein von Tesco. Aber er schmeckte trotzdem, und sie hatte ein paar Orangenscheiben und eine Zimtstange dazugegeben. In der Ecke stand ein rot-gold geschmückter Weihnachtsbaum, und im Kamin knisterte ein Feuer.
Alles fühlte sich so schön vertraut an. Lexie war in diesem Haus aufgewachsen. Damals, nachdem ihr Vater sie verlassen hatte, dachte Lexie, dass sie es vielleicht räumen müssten. Sie hatte erwartet, dass ihre Mutter vielleicht einen Neuanfang wollte, wenn sie sie in ihrem Schlafzimmer schluchzen hörte oder sie in Tränen ausbrechen sah, weil sie irgendwo eine alte Herrensocke gefunden hatte. Doch Lexie hatte den Gedanken gefürchtet und das auch deutlich gemacht – einmal hatte sie die ganze Nacht geweint, als die Sprache darauf kam. Denn es war ihr Zuhause, und sie wollte nicht weg. Und insgeheim hatte sie Angst, dass ihr Vater nie zurückkommen würde, wenn sie umzogen. Sie wusste nicht genau, wie es dazu gekommen war, aber irgendwann stand fest, dass sie bleiben würden. Doch obwohl ihre Mutter darüber hinwegkam und mit Lexies Hilfe ihr Zimmer neu strich und obwohl es Lexie gewesen war, die unbedingt bleiben wollte, hatte sie mit der Zeit einen gewissen Groll gegen das Haus entwickelt. Denn es war das Haus, das ihr Vater verlassen hatte, das Haus, in das er nicht zurückgekehrt war.
Sie hatte so viele schöne Erinnerungen daran. Übernachtungspartys mit Freundinnen, Filmabende mit ihrer Mutter. Doch sie wurden von den schlechten überlagert.
Ihre Mutter stand nebenan in der Küche und rührte in einer selbstgemachten Nudelsauce. Pasta konnte sie gut, jede Art von Pasta. Aber alles andere ging tendenziell daneben.
»Das ergibt keinen Sinn«, schnaubte Lexie und nippte an ihrem Glühwein. »Wusstest du davon? Hat er es dir erzählt?«
Sie hatte keine Ahnung, wie viel Kontakt ihre Mutter und ihr Vater am Ende gehabt hatten. Als Lexie klein war, hatten sie die Besuchszeiten abgesprochen, und sie wusste, dass ihr Vater manchmal versucht hatte, über ihre Mutter an sie heranzukommen, als sie älter war und ihn ignorierte, aber vermutlich hielt sich die Kommunikation in Grenzen.
Ihre Mutter zögerte den Bruchteil einer Sekunde. »Nein.«
»Mum!«
»Hat er nicht, Lex. Er hat nur … Wir haben letztes Jahr ein paarmal miteinander gesprochen. Ich wusste es nicht, aber er war krank und wollte Kontakt zu dir aufnehmen, und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er …«
»Vergiss es. Ich will es nicht hören.«
Ihre Worte schmerzten sie. Auch weil ihre Mutter anzudeuten schien, dass sie die Anrufe ihres Vaters hätte annehmen und ihm vergeben sollen, nachdem er sie immer wieder im Stich gelassen hatte. Ihre Mutter war an ihrem einundzwanzigsten Geburtstag dabei gewesen. Sie wusste genau, warum Lexie beschlossen hatte, dass es genug war. Sollte sie sich jetzt schuldig fühlen? Weil er ihr im letzten Jahr seines Lebens plötzlich wieder ein Vater sein wollte? So funktionierte das nicht.
»Ich wusste es nicht, Lexie«, sagte ihre Mutter wieder. »Wir haben nicht viel miteinander geredet. Und er hat mir nichts von dem Krebs erzählt, ich glaube, weil er nicht wollte, dass du es von mir erfährst, aber …«
»Aber was?«, keifte sie und holte dann tief Luft. Sie klang wie ein Teenager – vielleicht lag es an diesem Haus. Sie durfte ihren Frust nicht an ihrer Mutter auslassen. »Tut mir leid. Ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich will seine blöde Firma nicht leiten. Ich lebe nicht mal in Großbritannien. Soll ich dafür wirklich mein ganzes Leben umkrempeln?«
»Du könntest wieder herziehen, wenn du willst.«
»Ich habe einen Job in Österreich, Mum. Ich durfte für die Beerdigung nach Hause fliegen, aber am zweiten Weihnachtstag muss ich zurück sein.«
Ihre Mutter reagierte nicht. Lexie wusste, dass sie keinen ihrer Jobs ernst nahm, wahrscheinlich, weil sie nie lange dabei blieb. Aber Lexie würde die Familie, für die sie arbeitete, im Stich lassen, wenn sie kündigte, und auch wenn es nur Saisonarbeit war, bedeutete das nicht, dass es ihr egal war.
»Denk an das Geld am Ende. Wenn du die Firma verkaufst, hast du vielleicht genug für die Anzahlung auf ein Haus.«
»Falls sie Gewinn macht. Falls nicht, bin ich weitere fünf Jahre gebunden. Außerdem hat Theo leider recht. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Unternehmen führt.«
»Ist Theo der Mann, mit dem du zusammenarbeiten musst?«
»Ja, der Mann, der mich hasst. Ein vollkommen Fremder, dem Richard die Hälfte seiner Firma vermacht hat.«
Lexie blickte zum Küchenherd und sah, wie ihre Mutter die Augenbrauen hochzog, weil sie ihn statt Dad, Richard genannt hatte, aber sie verkniff sich einen Kommentar. Stattdessen sagte sie: »Ich bin sicher, er hasst dich nicht.«
Lexie entgegnete nichts, sie wollte nicht zickig sein.
»Und ich bin sicher, dein Vater hatte einen guten Grund dafür, Lexie.«
»Natürlich, weil alles, was er in der Vergangenheit getan hat, ja so nachvollziehbar war.«
Ihre Mutter warf ihr einen abschätzenden Blick zu. »Ich denke, man sollte nicht vergessen, dass die Dinge immer etwas komplizierter sind, als sie scheinen.«