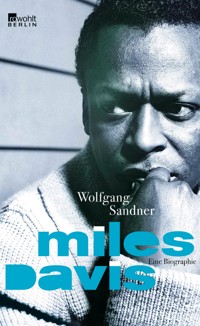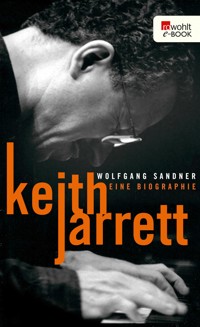
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Rowohlt Monographie
- Sprache: Deutsch
Keith Jarrett ist einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts, ein Jazzvisionär und glänzender Interpret der Klassik, ein Meister der Improvisation – sein legendäres «Köln Concert» von 1975 ist bis heute die meistverkaufte Soloplatte des Jazz überhaupt. Wolfgang Sandner kennt Keith Jarrett, über dessen Leben bislang nur wenig bekannt ist, seit vielen Jahren, war Gast in Jarretts Haus und hat in intensiven Gesprächen den Menschen hinter der Musik erlebt. Nun erzählt er die Biographie des Künstlers: von Jarretts Kindheit, in der er als Wunderkind die Bühne betrat, über seine Reifung im Spiel mit Größen wie Art Blakey, Charles Lloyd oder Miles Davis bis zu seinen gefeierten Interpretationen der Werke Bachs, Mozarts oder Schostakowitschs. Sandner zeigt, was Jarrett und seine Musik geprägt hat, erzählt aber auch von Schicksalsschlägen – wie jenem chronischen Erschöpfungssyndrom, das Jarrett für Jahre verstummen ließ, bevor er sich Ende der Neunziger triumphal zurückmeldete. Das Porträt eines der größten Pianisten der Gegenwart, erzählt von einem, der Jarrett nahekommen konnte – und zugleich eine Musikgeschichte der letzten fünfzig Jahre, voll von Momenten magischer Intensität, in denen sich die treibende Kraft der Musik offenbart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Wolfgang Sandner
Keith Jarrett
Eine Biographie
Über dieses Buch
Keith Jarrett ist einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts, ein Jazzvisionär und glänzender Interpret der Klassik, ein Meister der Improvisation – sein legendäres «Köln Concert» von 1975 ist bis heute die meistverkaufte Soloplatte des Jazz überhaupt.
Wolfgang Sandner kennt Keith Jarrett, über dessen Leben bislang nur wenig bekannt ist, seit vielen Jahren, war Gast in Jarretts Haus und hat in intensiven Gesprächen den Menschen hinter der Musik erlebt. Nun erzählt er die Biographie des Künstlers: von Jarretts Kindheit, in der er als Wunderkind die Bühne betrat, über seine Reifung im Spiel mit Größen wie Art Blakey, Charles Lloyd oder Miles Davis bis zu seinen gefeierten Interpretationen der Werke Bachs, Mozarts oder Schostakowitschs. Sandner zeigt, was Jarrett und seine Musik geprägt hat, erzählt aber auch von Schicksalsschlägen – wie jenem chronischen Erschöpfungssyndrom, das Jarrett für Jahre verstummen ließ, bevor er sich Ende der Neunziger triumphal zurückmeldete. Das Porträt eines der größten Pianisten der Gegenwart, erzählt von einem, der Jarrett nahekommen konnte – und zugleich eine Musikgeschichte der letzten fünfzig Jahre, voll von Momenten magischer Intensität, in denen sich die treibende Kraft der Musik offenbart.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2015
Copyright © 2015 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
Umschlagabbildung Kuni Shinohara
ISBN 978-3-644-11731-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorwort
1. Der 8. Mai 1945 – transatlantisch
2. Aufwachsen in Allentown
3. Drei Stufen zum Jazz: Art – Charles – Miles
4. Eine ideale Partnerschaft
5. Die formativen Jahre
6. Verschlungene Wege zur Meisterschaft
7. Solist ohne Grenzen
8. Zwischen Glanz und Krise
9. Die Geschichte einer Kultplatte
10. Amerikas Gesangbuch
11. Der Jazzmusiker als Klassiker
12. Ein kompletter Künstler
13. Einspruch
Epilog
Diskographie
Bibliographie
Bildnachweis
Danksagung
Für Anikó, Gábor und Bálint
Vorwort
Mit freundlichen Künstlern ist die Welt nicht gesegnet. Aber es gibt sie, die geduldigen Genies, die sich zu uns herabneigen und kluge Antworten auf banale Fragen geben, ihr Handwerk erläutern und ihre Kunst beschreiben, Einblick in den Schaffensprozess gewähren, vielleicht sogar auf quälende Stunden verweisen, in denen die Muse sie nicht küsst und die Verzweiflung naht.
Die skeptischen Künstler sind zahlreicher. Ihr Misstrauen richtet sich gegen alle, die das Leben mit der Kunst verwechseln, sich nicht so sehr für die Arbeit und das Produkt der Arbeit interessieren, dafür den äußerlichen Merkmalen einer Künstlerexistenz – kolportiert in Erzählungen und Geschichten – umso größere Aufmerksamkeit schenken. Der Pianist Alfred Brendel meinte, man müsse sich bis an die Zähne bewaffnen gegen Anekdoten in der Kunst. Mit Anekdoten kommt man dem Wesen einer Sache so wenig nahe wie ein Astronom dem Saturn, solange er nur dessen Ringe studiert.
Es gibt auch zornige Künstler. Sie verwahren sich gegen jede Deutung, weil sie darin nichts anderes als geistigen Diebstahl wittern. Im Jazz trifft man sie häufig. Der Trompeter Freddie Keppard gilt als früher Kronzeuge für die Abwehrhaltung, die dieses Genre und seine Repräsentanten bis heute prägt. Als man ihm 1916 anbot, seine Klänge aufzuzeichnen und ihn so zum ersten Musiker der Jazzgeschichte mit einer Schallplattenaufnahme zu machen, lehnte er ab: Er wolle nicht, dass man seine Musik permanent abspielen und sie damit studieren und kopieren könne. Für einen schwarzen Musiker in der weißen Gesellschaft seiner Zeit war Vervielfältigung nur ein beschönigendes Wort für Ausbeutung. Ein Jahr später kam sie heraus, die erste Schallplatte des Jazz, eingespielt von der Original Dixieland Jazz Band – weiße Musiker allesamt.
Schließlich gibt es die radikalen Künstler. Sie sind davon überzeugt, dass Musik, die hermetischste aller Künste, gegen Erklärungen immun ist. Selbst tolerantere Zeitgenossen neigen bisweilen zu der Ansicht, musikalische Vorgänge ließen sich weit besser emotional erfassen als mit dem Verstand. «Nun mögen die ohnmächtigen Worte verstummen; er selber rede in seinen Werken zu uns.» Albert Schweitzers Grundsatz zur Musik Johann Sebastian Bachs findet sich als Basso continuo in vielen Äußerungen von Künstlern, Hörern und natürlich auch bei jenen, die in der kritischen Auseinandersetzung mit Musik unweigerlich an Grenzen der Vermittlung stoßen.
Wer sich fragt, warum über Keith Jarrett bisher so wenig geschrieben steht, findet in dieser Haltung eine Antwort. Einer der einflussreichsten und originellsten Pianisten der Gegenwart ist zu einem radikalen Verweigerer des Wortes geworden. Auf ihn trifft zu, was wiederum Paul Hindemith über den Thomaskantor Bach sagte: Er sei von einer austernhaften Verschwiegenheit. Wer über Jarretts Kunst Aussagen macht, tut es im Grunde gegen dessen Willen. Hätte er darüber entscheiden können, wäre vielleicht auch das vorliegende Buch nie zustande gekommen.
Am 14. Januar 2014 wurde Keith Jarrett im New Yorker Lincoln Center zusammen mit dem Saxophonisten Anthony Braxton, dem Bassisten Richard Davis und dem Pädagogen Jamey Aebersold in den Kreis der jährlich vom National Endowment of the Arts geehrten «Jazz Masters» aufgenommen, der höchsten offiziellen Auszeichnung für Jazzmusiker in Amerika. In seiner kurzen Dankesrede sagte Jarrett, Musik könne man nicht mit Worten beschreiben, Musik sei nichts anderes als Musik. Was tautologisch klingen mag oder auch wie die Essenz mystischen Denkens erscheint, verdankt sich eher der Skepsis gegenüber Materialanalysen, mit denen bestenfalls erklärt werden kann, wie ein Musikstück gemacht wurde, aber nicht, was es ist.
In den sechziger Jahren, als Keith Jarrett noch Mitglied im Charles Lloyd Quartet war, bin ich erstmals auf seine Musik gestoßen. Später habe ich Jarrett durch den Produzenten Manfred Eicher persönlich kennengelernt und Gespräche mit ihm geführt, unter anderem als Gast in seinem Haus in Oxford, New Jersey. Mein Vorhaben, eine Biographie über ihn zu schreiben, fand sein Interesse und sein Wohlwollen, bis es bei einer öffentlichen Feier nach einem seiner Solokonzerte zu einem kuriosen Disput zwischen uns über das Köln Concert kam. Dass ich dieses Konzert als einen seiner großen Erfolge bezeichnete, löste sein ausgesprochenes Missfallen aus und brachte unseren Dialog zum Erliegen.
Auch darin liegt eine gewisse Konsequenz, etwas Prototypisches, auf das man bei Jazzmusikern stets gefasst sein muss. Nichts fürchten sie so sehr wie das Etikett «commercial». Jeder zählbare Erfolg steht im Verdacht, durch ästhetische Kompromisse erkauft worden zu sein. Sosehr die Künstler die öffentliche Anerkennung herbeisehnen, so allergisch reagieren sie, wenn diese Anerkennung sich dann in einer Weise einstellt, die diesen Verdacht nähren könnte. Keith Jarrett befindet sich mit seinem Köln Concert von 1975, mit dem er über den engeren Zirkel der Jazzfans hinaus die Aufmerksamkeit einer breiten musikalischen Öffentlichkeit erregte, in einem persönlichen Dilemma. Die Aufnahme hat eine größere Auflage erzielt als jede andere Einspielung eines Solisten in der Geschichte des Jazz. Aber sie kam unter widrigen Umständen auf einem indiskutablen Flügel zustande, der die Möglichkeiten des Spiels arg beschränkte. So etwas kann ein Maximalist wie Keith Jarrett nicht als Erfolg durchgehen lassen, auch wenn die kollektive Resonanz dem widersprechen mag.
Das Ende eines Dialogs eröffnet jedoch auch eine Chance. Unweigerlich wird man wieder auf die Musik selbst verwiesen und ist weniger in Gefahr, der Suggestion des Künstlers zu unterliegen. Denn auch die mittelbaren wie die unmittelbaren Selbstdarstellungen, wir wissen es schon lange, können nicht objektiv sein. Mit dieser Biographie soll Keith Jarretts Wörterstürmerei nicht konterkariert werden. Aber es ist den Versuch wert, alle sprachlichen Mittel zu mobilisieren und – im Sinne T.S. Eliots – «neue Entdeckungen im Gebrauch der Worte zu machen», um eine Musik näherzubringen, die zu den faszinierendsten Kunstäußerungen unserer Zeit gehört und die es verdiente, in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen zu werden. Vor allem aber: die es verdient, gehört zu werden.
1. Der 8. Mai 1945 – transatlantisch
«Es ist gut, heute allein zu sein», vertraut Alfred Kantorowicz im New Yorker Exil seinem deutschen Tagebuch an. Heute, das ist der 8. Mai 1945. Der Schriftsteller notiert weiter: «Das also liegt hinter uns. Immerhin zwölf Jahre. Zwölf Jahre, die die Verbrechen von tausend Jahren angehäuft haben. Ich versuche mir eine Vorstellung davon zu machen, wie es jetzt da drüben aussieht, aber ich weiß, dass jede Vorstellung vor der millionenfältigen Wirklichkeit versagen muss. Noch wage ich nicht weiterzudenken. Von irgendwoher wird Beethovens Fünfte gesendet. Die Hymne des Sieges!? Es gibt keinen Sieg. Es gibt am Ende dieses Krieges nur Besiegte.»
Die «millionenfältige Wirklichkeit da drüben», in einem Europa, das dem alten Kontinent von einst nicht mehr entsprach, hat ein anderer Schriftsteller Jahre später zu einem monumentalen Mosaik aus Erinnerungsfetzen und Zustandsschilderungen von Zeitzeugen zusammengesetzt, aus nüchternen Protokollen und einsamen Bekenntnissen, qualvollen Einsichten und offiziellen Erklärungen, aus Beobachtungen am Rande und hastigen Notizen kurz vor dem Verstummen. Walter Kempowskis Echolot, mehrere tausend Seiten tief in die Seelen der Überlebenden gesenkt, ist ein grandioses Dokument der akkumulierten Stimmung eines historischen Augenblicks. Noch haben sich an diesem 8. Mai des Jahres 1945 die schwarzen Wolken nicht ganz verzogen. Aber eine Ahnung davon, dass sich ein Weltbild aufgelöst hat und eine neue Zeit anbricht, ist in vielen, vielleicht in allen Äußerungen und Gesten spürbar. Dabei muss den einstmals mächtigen und selbstbewussten Staaten Europas endgültig klargeworden sein, dass es ohne Amerika keinen Neubeginn mehr geben kann. Auch keinen kulturellen. An diesem Tag hat die Hegemonie Europas aufgehört zu existieren. Paul Valéry hat es drastischer formuliert: «Europa ist am Ende seiner Karriere.»
War sie nicht lange schon da gewesen, die Kultur Amerikas? Hatte der Jazz nicht Jahrzehnte zuvor seinen Anspruch als Unterhaltungsmusik des Jahrhunderts und ein wenig auch als die klassische Musik der Neuen Welt mit einem möglichen Kraftfeld für das erschöpfte Europa angemeldet? Hatten die Ragtime-Pianisten nicht schon um die Jahrhundertwende zahllose Synkopen in ihre Kompositionen eingebaut, um das Bewusstsein für die Zeit zu schärfen? Sie wollten die Zeit zum Stolpern bringen, daran hindern, unauffällig weiterzuticken: Ragtime – zerrissene Zeit. Dieser Rhythmus war die erste musikalische Auflehnung der Afro-Amerikaner gegen das europäische Zeitgefühl, ein Knüppel zwischen marschierende Beine. Die Synkopen brachten alles durcheinander, danach wollte keiner mehr geradeaus musizieren. Das virtuose Hakenschlagen um die Eckpfeiler bürgerlichen Denkens und Fühlens war zur sinnlichen Mode geworden.
Viele unter musikalischer Anämie leidende Künstler Europas haben sich von der ästhetischen Bluttransfusion Heilung versprochen. Nicht nur die Musik selbst, die gesamte Kunst der ersten Jahrhunderthälfte und weit darüber hinaus ist voll von Grußadressen an die Saboteure eines schnurstracks geführten Viervierteltakts: Debussy mit seinem stilisierten Plantagentanz war der Vorreiter, danach kamen Ravel mit seinem französischen Blues und Milhaud mit einer eigenen musikalischen Schöpfungsgeschichte, in der bildenden Kunst Matisse mit einem Zyklus von Scherenschnitten und Mondrian mit seinem Broadway Boogie Woogie, der Universalist Picabia mit zwei kubistischen Chansons nègres und der Sozialkritiker Dix mit einem gegenwartsnahen Großstadt-Triptychon. Cocteau, Satie, Grosz, Marcel Carné, Louis Malle, Jean-Luc Godard, Boris Vian, Julio Cortázar, Peter Rühmkorf – alles Künstler mit einem untrüglichen Rhythmusgefühl, das aus dem Jazz kam. Als im Jahr 1918 Strawinskys Ragtime veröffentlicht wurde, zu dessen Erstdruck Pablo Picasso den Umschlag gezeichnet hatte und zu dem LéonideMassine später eine Choreographie schuf, meinten Kulturkritiker der Zeit, nun sei der Jazz endgültig als Kunst akzeptiert worden. Aber Europa hieß den Sound der Neuen Welt nicht lediglich wegen seiner bizarren Rhythmen oder der attraktiven Exzentrik seiner Repräsentanten willkommen. Europa war fasziniert, weil diese Musik, wie der Historiker Eric Hobsbawm lakonisch feststellte, durch und durch amerikanisch klang. Jazz, das war ein Synonym für das Moderne schlechthin. Die chromblitzenden Bands kamen aus demselben Land wie die Automobile Henry Fords.
Der Pianist Dave Brubeck, hier mit seinem Quartett auf einem Foto von 1950, war unmittelbar nach 1945 in der Nähe von Nürnberg stationiert und trat in diversen Jazzclubs auf.
Europa kannte den Jazz. In den Tagen nach der Zäsur des 8. Mai 1945 haben diese Klänge allerdings eine noch größere, alles Bisherige übertönende Qualität angenommen. Was Europa, Deutschland zumal, zu hören bekam, waren – einer schäbigen Propaganda der unmittelbaren Vergangenheit zum Trotz – keine zerstörerischen Posaunen von Jericho. Es waren Fanale, Flammenzeichen eines fundamentalen Neubeginns. Dave Brubeck, nach Kriegsende mit einer Militärband bei Nürnberg stationiert und in den Clubs der amerikanischen Streitkräfte unterwegs, spürte, warum hier alle Jazz hören wollten. Der alte Kontinent vernahm darin den Klang einer totalen geistigen Entfesselung.
Noch enthusiastischer als im zerstörten Deutschland oder in manchen anderen europäischen Ländern drückte sich das in Frankreich aus. Europa war von Amerika befreit worden, aber die Stadt an der Seine tat so, als seien es ihre Bewohner gewesen, die für sich und den Rest der Welt den Nationalsozialismus mit seiner barbarischen Ideologie und kulturellen Ignoranz überwunden hatten. Die Stadt, die niemals schlief, freilich aus anderen Gründen als New York, beanspruchte den Status einer Zentrale des neuen, oder sagen wir lieber: des befreiten Denkens und Fühlens, des Sehens, Schmeckens und Riechens und nicht zuletzt des Hörens für sich. Jazz wurde auch im restlichen Europa unwiderruflich als eine bestimmende Musik des zwanzigsten Jahrhunderts wahrgenommen. Aber Paris machte aus dem amerikanischen Jazz mit den Ingredienzien des französischen Existenzialismus das aufregende Parfum spécial einer Epoche.
Der Anspruch, die Hauptstadt eines aufbrechenden Nachkriegseuropas zu sein, bestand vollkommen zu Recht. Welcher andere Ort in Europa wäre imstande gewesen, am 8. Mai 1945 ein umfassend neues Lebensgefühl zu propagieren? Aus den Kellern der Rue de la Huchette und der Rue des Carmes, den Klubs und Konzerthallen der Rue Saint-Benoît und der Rue du Faubourg Saint-Honoré schallten die Klänge von Claude Luters Klarinette, später von Bill Colemans Trompete und James Moodys Saxophon. Aus dem Café de Flore und dem Deux Magots auf dem Boulevard Saint-Germain drangen die Diskussionen von Simone de Beauvoir mit Jean-Paul Sartre und Albert Camus. Im Tabou trat Juliette Gréco, die Sängerin der Denker und sinnliche Erscheinung der Existenzphilosophie schlechthin, vor einer Gesellschaft auf, zu der ein Jean Cocteau, ein Raymond Queneau und ein Camille Bryen gehörten. Und Jacques Préverts Chanson Les feuilles mortes, das aus Juliette Grécos feuerrotem Mund wie ein verspätetes Versprechen erschien, war nach Ansicht von François Mauriac zum «vollkommensten Ausdruck der Nachkriegszeit» geworden.
Paris, Hauptstadt des Jazz und des Existenzialismus nach dem Krieg: Jean-Paul Sartre, der Komponist und Jazztrompeter Boris Vian und Simone de Beauvoir, 1949 im Café Le Procope.
Amerikaner konnten nachempfinden, welche Faszination in Europa von ihrer Musik ausging, auch wenn sie ihre Ohren dazu nicht neu ausrichten mussten. Es war schließlich ihre Klangkultur, die mitgekämpft und mitgesiegt hatte. Vielleicht waren in diesen Tagen nach dem 8. Mai 1945 die Bläsersätze der Orchester von Duke Ellington und Count Basie tatsächlich so etwas wie die patriotische Musik Amerikas geworden. Nur wurde am V-Day die Stimmung so selbstverständlich von diesem Gestus des Jazz geprägt, dass man nicht eigens Notiz von ihm nehmen musste. Amerika war zu sehr mit anderem beschäftigt, um die verminderten Quinten von Charlie Parker oder die vertrackten Bläserriffs von Woody Hermans Bigband zu beachten. Man tanzte selbstvergessen und geriet dabei in einen kollektiven Taumel. Dem aufmerksamen Dramatiker Arthur Miller erschien das Kriegsende, als habe man sich lange gegen eine Stahltür gestemmt, die mit einem Mal von innen aufgerissen wurde. Und plötzlich fühlte man sich, als gleite man schwerelos in einer Raumkapsel, in der Orientierungen wie oben, unten, rechts oder links bedeutungslos geworden sind. Zwar kehrten die alten Sicherheiten im Mutterland des unbegrenzten Optimismus bald zurück. Für einen kurzen historischen Augenblick jedoch gab es keinen Kompass mehr: «Es war eine so aufregende, so elementare Situation, in der wir uns befanden – wie Tiere mit gespitzten Ohren und der Nase im Wind.»
In dieser globalen Stunde null des 8. Mai 1945 wurde Keith Jarrett in der kleinen Industriestadt Allentown, Pennsylvania, geboren. Anders als bei Louis Armstrong ist jene Angabe kein fiktives Datum. Satchmo hatte sich mit dem 4. Juli 1900 nachträglich einen attraktiven Geburtstag zugelegt, um seinen ersten Auftritt auf dem Planeten mit dem amerikanischen Unabhängigkeitstag des neuen Jahrhunderts publikumswirksam in Einklang zu bringen. Sein tatsächlicher Geburtstag war der 4. August 1901. Keith Jarrett wäre dagegen wohl kaum in den Sinn gekommen, seinen Lebensweg später mit einem spektakulären Auftakt zu schmücken. Und doch hat auch das bemerkenswerte Datum seiner Geburt etwas Triftiges, als habe er mit seinem Werdegang den symbolträchtigen Tag rechtfertigen wollen, an dem er zur Welt gekommen ist. Das Ende des Zweiten Weltkriegs, diese historische Schnittstelle zwischen einer alten Weltordnung und einer neuen Epoche, zwischen einem Amerika, das wieder nach Europa drängte, und einem Europa, das nicht mehr ohne Werte aus der neuen Welt zurechtkam, dieses euroamerikanische Scharnier lässt sich im Lebensweg und in der Kunst von Keith Jarrett unschwer ausmachen.
Viele Künstler gibt es nicht, die so wie er auf beiden Kontinenten zu Hause sind, zwei Sichtweisen, zwei Kulturen repräsentieren und hellhörig auf die Unterschiede im Verhalten zwischen Europa und Amerika reagieren. In Allentown, achtzig Kilometer nördlich von Philadelphia und hundertvierzig Kilometer westlich von New York gelegen, wurde er in eine Familie hineingeboren, die den alten Kontinent spürbar in sich trug. Die einen Großeltern waren aus Europa eingewandert, verständigten sich teilweise noch in den Sprachen der österreichisch-ungarischen Monarchie. Als Keith, der Erstgeborene von fünf Brüdern, sehr früh seine Begabung zeigte und mit drei Jahren begann, Klavier zu spielen, bekam er eine klassische musikalische Ausbildung, wie im Übrigen später einige seiner jüngeren Geschwister. Sein erstes Solo-Recital im Woman’s Club von Allentown am 12. April 1953, nachmittags um drei Uhr, bestritt der siebenjährige Keith mit barocken bis hin zu klassisch-romantischen Klavierstücken, einem Panorama europäischer Kunstmusik aus zwei Jahrhunderten: Carl Philipp Emanuel und Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Mendelssohn Bartholdy, Grieg, Brahms, Saint-Saëns, Moszkowski und Mussorgski sowie ein paar eigene Werke einer kindlich-frechen Programmmusik.
Jazz stand noch nicht auf der Tagesordnung. Die Zukunft des pianistischen Wunderkinds lag in der Vergangenheit, der klassischen Musik. Als der gefeierte Jazzpianist, der Pionier einer von allen Vorgaben unbelasteten, freien Improvisationskunst, im Jahr 1988 den ersten Teil seiner Gesamteinspielung des Wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach vorlegte, war das Erstaunen in der Öffentlichkeit dennoch groß. Die Jazzkarriere hatte die klassischen Anfänge des Pianisten vollständig überlagert. Dass sich Jarrett neben dem Jazz immer auch mit klassischer Musik auseinandergesetzt und die Spur von Bach bis zur Moderne nie aus den Augen verloren hatte, war weiten Kreisen der Kritik nahezu verborgen geblieben.
Keith Jarrett war von Beginn seiner Laufbahn an ein Künstler mit einer entschieden europäischen Perspektive, und er ist es bis heute geblieben. Aber die Herkunft seiner Familie oder seine persönliche Neigung zur klassischen europäischen Musik allein hätten wohl kaum ausgereicht, ihn, den überaus erfolgreichen Jazzmusiker, konstant in Richtung alte Welt blicken und ihn dort einen Teil seiner Wurzeln finden zu lassen. Es war die Entwicklung in Europa selbst, die dafür sorgte und ihm den Schritt über den Atlantik erleichterte. Denn Amerikas Kultur kam zwar nach dem 8. Mai 1945 mit entsprechender Vehemenz nach Europa und überschwemmte förmlich einen offensichtlich ausgetrockneten Kontinent. In den folgenden zwanzig Jahren aber, die dem Ende des Zweiten Weltkriegs folgten, haben die Europäer die neue Kultur so gründlich adaptiert, dass sie – mit ihren eigenen ästhetischen Standards amalgamiert – die Unterschiede zum Mutterland des Jazz nahezu nivellieren konnten. Ohne die Emanzipation des europäischen Jazz und einer gleichzeitig kontinentalen Ausbreitung dieser Musik wäre es auch einem Keith Jarrett nicht leichtgefallen, Europa so in die Topographie seiner Kunstäußerungen und seiner musikalischen Präsenz einzubinden.
Jarrett widmete wesentliche Einspielungen seines gigantischen Aufnahmenkatalogs der klassischen europäischen Musik. Lange besaß er ein «Europäisches Quartett» neben einem «Amerikanischen Quartett», und von 1971 bis heute erschienen seine wichtigsten Aufnahmen bei der Plattenfirma ECM in München. In Europa, in Südfrankreich zumal, wo er sich regelmäßig aufhält, fühlt er sich offensichtlich zu Hause. Und er vermag, europäisch zu denken. Ian Carr, sein bisher einziger ernstzunehmender Biograph, stammt aus England. Auch das einzige Buch über Jazz, dass der überkritische Jarrett gelten lassen will, wurde von einem Engländer geschrieben – Geoff Dyers Fiktion und Realität wundersam mischendes But Beautiful. All das entbehrt nicht einer gewissen Folgerichtigkeit. Keith Jarrett ist ein Amerikaner von Geburt, mit einer großen Wahlverwandtschaft, die in Europa ansässig ist.
Aber Keith Jarrett konnte nur ein Europa auf ästhetischer Augenhöhe zur Kenntnis nehmen. Ein paar ehrenwerte Komponisten mit diskreten Adaptionen afro-amerikanischer Klanggestik, ein paar Saxophonisten, die fleißig Charlie Parkers Phrasen transkribieren, ein Max Beckmann mit seinem Selbstbildnis mit Saxophon und ein paar wohlmeinende Dixielandbands auf den Sommerfestivals von Italien bis Schweden hätten dazu nicht ausgereicht. Es mussten schon gewichtige Künstler wie Jan Garbarek, Albert Mangelsdorff, Dave Holland, John McLaughlin, Kenny Wheeler oder Tomasz Stańko die Bühne betreten, Festivals in Berlin, Den Haag, Montreux und Antibes etabliert werden, das prestigeträchtige Avantgardetreffen in Donaueschingen seine Tore dem Jazz öffnen, es mussten Labels wie MPS, ECM oder FMP gegründet werden, Produzenten vom Rang eines Manfred Eicher und Toningenieure wie Jan Erik Kongshaug auf der Bildfläche erscheinen, Forschungsstellen in Graz und Darmstadt sowie Ausbildungsstätten für Jazz in niederländischen Städten von Arnheim bis Amsterdam eingerichtet werden, um das Gleichgewicht der kulturellen Kräfte herzustellen, sodass der Austausch von Gedanken zwischen europäischen und amerikanischen Jazzmusikern nicht als intellektuelle und emotionale Einbahnstraße funktionierte.
All das war nötig, um Künstler wie Keith Jarrett, Lee Konitz, Herb Geller, Jiggs Whigham, Charlie Mariano, Don Cherry oder Jimmy Woode dauerhaft an Europa zu binden oder diese Weltgegend zumindest zeitweise zu einem attraktiven Aufenthaltsort für amerikanische Jazzmusiker zu machen. Hinzu kam, was der Baritonsaxophonist und Musikforscher Ekkehard Jost in seiner Diagnose des soziokulturellen Unterschieds einmal salopp formulierte: Amerika habe die Musik und Europa die Ohren, um sie zu hören. Viele Amerikaner waren beeindruckt von der Haltung der Europäer, die wirklich zuhörten und die Musik nicht zur Beigabe eines kulinarischen Abends degradierten.
Cecil Taylor, der jahrelang von der Sozialfürsorge leben musste, weil seine Musik quer zu jener des amerikanischen Entertainments stand, konnte ein Lied davon singen, wie die Clubgastspiele von Jazzmusikern, auch in traditionsreichen Etablissements, gewissermaßen von der Kellnerzunft geregelt wurden. Die Dauer einer Improvisation sollte möglichst die Länge eines Drinks an der Bar nicht übertreffen, die Dynamik der Musik hatte sich nach jener des im Restaurant servierten Ragout fin zu richten. Dafür waren die rabiate Intensität, mit der Cecil Taylor seine clusterähnlichen Akkorde heraushämmerte, und die aberwitzige Dichte seiner klanglichen Strukturen keine guten Voraussetzungen. Taylors früherer Bassist Buell Neidlinger hat den Widerstand von Clubbesitzern oft miterlebt und beschrieben, wie man den Avantgardisten Taylor gelegentlich am Weiterspielen hindern wollte: «Wir bekamen oft das Zeichen zum Aufhören, das alte Radiosignal, die flache Hand über die Gurgel fahrend. Abschneiden, aufhören, Schluss jetzt. Aber das kann man nicht. Wenn Igor Strawinsky dasitzt und schreibt, kann man auch nicht plötzlich sagen: ‹Hör auf, Igor! Wir möchten jetzt ein paar Whiskeys verkaufen.› Das ist bei uns eben auch so.» Cecil Taylor komponierte, wenn er spielte – wie alle Jazzmusiker, bei denen die Improvisation gleichzusetzen ist mit dem Akt der Ad-hoc-Komposition.
Um der Wahrheit die Ehre zu geben, darf ein solch harsches Urteil freilich nicht die andere Seite überdecken. In Amerika gab es schon immer eine große Bereitschaft, Pioniertaten wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen. Der Kontinent einer permanenten Einwanderung blickt auch in Kunstäußerungen auf eine lange Tradition des Neuen zurück, die sich möglicherweise auf das politische Universalgenie Benjamin Franklin beziehen lässt, der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts mit seinem Streichquartett für leere Saiten so etwas wie die musikalische Unabhängigkeitserklärung des Landes komponierte. Man hat nicht ohne Grund die prototypischen amerikanischen Künstler «Mavericks» genannt, ein symbolischer Begriff, der mit «Kauz» nur sehr vage umschrieben ist. Herrenloses Vieh ohne Brandzeichen, mutterloses Kalb, abtrünniger Einzelgänger, Außenseiter – diese vielen Bedeutungen geben schon einen Hinweis auf die Sphäre und jene Zeit, aus der der Begriff stammt: als die Neuankömmlinge fremde Natur in Heimat verwandelten, die Grenze nach Westen offen war und die rastlosen Pioniere ihre Herden zwar zusammenhalten mussten, zugleich aber jeden Ausreißer schätzten, weil sie sich in seinem unzähmbaren Freiheitsdrang selbst wiedererkannten. Was man aber bis ins neunzehnte Jahrhundert noch als Primitivität oder Naivität in der amerikanischen Musik angesehen haben mag, wurde bei Charles Ives oder Carl Ruggles bald zu einer selbstbewussten musikalischen Philosophie umgedeutet: komplexe Musik in Hemdsärmeln.
Michael Tilson Thomas, der rührige Chefdirigent des San Francisco Symphony Orchestra, hat jenen kauzigen Figuren vor einigen Jahren ein Festival unter dem Etikett «American Maverick» ausgerichtet. Dabei konnte man dann einen älteren, freundlich unter seiner Brille hervorblinzelnden Herrn mit weißem Bart auf der Bühne sitzen sehen und hören, wie er die einzelnen Sätze von Charles Ives’ Holiday Symphony mit wundersamen verbalen Stimmungsbildern verband, als seien es Landschaftsmalereien von Grandma Moses. Es war Lou Harrison, einer dieser Pioniere, an die Gertrude Stein gedacht haben mag, als sie ihr bizarres Bonmot formulierte, Amerika sei das älteste Land des zwanzigsten Jahrhunderts. Das lässt Raum für Spekulation, aber vermutlich hat Gertrude Stein damit auch gemeint, Amerika, dieses im Vergleich zu den europäischen Staaten junge Land, besitze die längste Tradition künstlerischer Experimente und ästhetischen Außenseitertums, man könnte sagen: Hier kann sich Individualismus entfalten. All diese Musiker von John Cage bis zu La Monte Young, von Henry Cowell, Harry Partch, Meredith Monk zu Conlon Nancarrow bilden die Phalanx einer rustikalen Avantgarde, auf die Europa gelegentlich mit Irritation reagierte, weil sie mehr bastelte als komponierte, mehr erfand als entwickelte, mehr vorausschaute als Traditionen im Rucksack mitschleppte.
Es ist sicher kein Zufall, dass Keith Jarrett Sympathie für diese musikalischen Querköpfe besitzt, sich mit Werken von einigen dieser künstlerischen Eigenbrötler auseinandergesetzt hat, zu denen viele Verächter von Dogmen und altväterlicher Gelehrsamkeit gehören. Notorisch unangepasst, unbeeinflusst von Tradition, historisch unberechenbar, die Grenzen ihres Genres generös missachtend, kraftvoll unbehauen, sind es die erstaunlichsten Innovatoren in der Musik des zwanzigsten Jahrhunderts, auch wenn sie bisweilen über die Erfindung von Skurrilitäten nicht hinausgekommen sind. Und sie haben sich in ihrem Freiheitsdrang nicht nur mit Musik beschäftigt, sie gelten als Philosophen und Theoretiker, Autoren und unorthodoxe Lehrer, Librettisten und Komödianten, Bilderstürmer und experimentierfreudige Wissenschaftler.
Anfang der achtziger Jahre hat Keith Jarrett in Stuttgart Werke von zwei dieser Mavericks, Lou Harrison und Alan Hovhaness, neben einer Komposition der Australierin Peggy Glanville-Hicks teilweise als europäische Erstaufführungen interpretiert, später die Suite für Violine, Klavier und Orchester sowie das Klavierkonzert von Lou Harrison auf Schallplatte herausgebracht. Dass er sich für diese und andere Sonderlinge eingesetzt hat, eine Affinität zu ihnen besitzt, bedeutet aber nicht, dass man ihn selbst, trotz seiner unbestreitbaren Neigung zur Exzentrik, in die bunte Phalanx amerikanischer Mavericks einreihen könnte. Keith Jarrett ist zu gebildet im traditionellen Sinne, zu musikalisch reflektiert, vor allem auch technisch zu gut ausgebildet und zu organisiert, wenn man will: zu konservativ im besten Verständnis, als dass er uneingeschränkt als Maverick durchgehen könnte, der auf sympathische Weise immer auch den amerikanischen Hinterwald repräsentiert. Aber eines ist Keith Jarrett mit Sicherheit, sonst hätte er den Rang eines der größten lebenden Jazzmusiker nicht eingenommen: Er ist, wie alle bedeutenden Jazzmusiker vor ihm und neben ihm, ein Individualist, einer der originellsten obendrein.
Von Individualisten lebt diese Musik. Wer im improvisierten Jazz etwas gelten will, muss über eine erkennbare Physiognomie verfügen. Mit der ersten swingenden Saxophonphrase lässt sich der elegante Virtuose Stan Getz erkennen, beim gestopften Trompetenton wird man unweigerlich an Miles Davis denken, und bei der lässigen rechten Hand, die der linken immer etwas nachklimpert, wird man hinter dem Klavier Erroll Garner vermuten. Selbst Big Bands, bei denen ja vierzehn bis achtzehn Individuen zusammen musizieren, haben identifizierbare Merkmale, durch die sie sich unterscheiden lassen. Am unorthodoxen Instrumentarium etwa war Stan Kentons Orchester auszumachen, am Four-Brothers-Sound die verschiedenen Herds von Woody Herman, an der sparsamen Klavierintroduktion vom ersten Moment an die Band von Count Basie.
Keith Jarrett besitzt eine ganze Reihe solcher Identifikationsmerkmale, die seinen persönlichen Stil bestimmen, seine Musik prägen, ihn herausheben aus der Anonymität des guten Pianistendurchschnitts. Solche Zeichen und Gesten sind allerdings nicht immer ohne Umschweife hörbar. Das hat damit zu tun, dass die wirklich großen Jazzmusiker eine eigene Form der Quadratur des Kreises beherrschen müssen: einen erkennbar individuellen Stil zu entwickeln und dennoch stets originell und überraschend zu sein. Man erkennt Keith Jarrett an seiner schier grenzenlosen Fähigkeit zur weitschweifigen Selbstinspiration, an einem faszinierend virtuosen Spiel, bei dem doch nie das Gefühl überwiegt, es gebe Noten, die besser nicht gespielt worden wären. Er besitzt einen ungemein modulationsfähigen Anschlag, ein untrügliches Ohr für die Mitspieler, die ihn inspirieren und die er inspiriert. Er kann hämmern wie ein Perkussionist und die Obertöne hervorzaubern wie ein Claude Debussy. Er vermag es wie Thelonious Monk, dem Instrument Töne zu entlocken, die man auf der Tastatur und im Korpus nicht vermutet. Immer wieder überraschend ist, wie er ein Stück beginnt, wie er es aufbaut, ob er das Werk als Impression vorüberhuschen lässt oder als feste Burg ins Gedächtnis eingraviert.
Alles, was man zur Charakterisierung über Keith Jarrett sagen kann, hat mit seiner Musik zu tun. Mit nichts sonst. Keith Jarrett ist Musiker, konzertierender, aktiver Musiker. Kein Theoretiker, kein Lehrer, kein Verfechter einer Schule, kein Autor musikalischer Weisheiten, kein Agitator oder Essayist. Seine Konzentration auf das Wesentliche, auf die Musik, ist eine absolute.
Sie korrespondiert mit der Beschränkung von Jarretts privatem Radius, der scheinbar im Gegensatz zu seiner globalen Ausstrahlung steht. Man könnte ihn in dieser Hinsicht – auch wenn es etwas abwegig wirken mag – mit Giacomo Puccini oder Giuseppe Verdi vergleichen. Verdis und Puccinis Musik hat die Welt erobert, die Künstler selbst aber blieben dem Landstrich und der Gegend treu, in die sie hineingeboren wurden, die raue Emilia-Romagna zwischen Roncole, Busseto und Sant’Agata für den einen, die liebliche Toskana in einem winzigen Dreieck zwischen Lucca, Torre del Lago und Viareggio für den anderen. Keith Jarrett ist ebenso erstaunlich bodenständig. Seit 1972 lebt er in einem Haus in New Jersey, das damals halb so alt war wie die Vereinigten Staaten. Es ist nur wenige Kilometer entfernt von seinem Geburtsort Allentown, an dem er seine Kindheit verbrachte. New York hat durchaus seine Anziehungskraft auf ihn ausgeübt – aber auf Dauer in dieser Stadt mit ihrem mörderischen Lebenskampf und ihrer nie erlöschenden Energie zu wohnen käme ihm wohl kaum mehr in den Sinn. Man darf vermuten, dass das für den in sich zurückgezogenen, sich selbst schützenden Keith Jarrett an jener Eigenart New Yorks liegt, die John Steinbeck in seiner Erzählung Geburt eines New Yorkers so eindrucksvoll beschrieben hat: New York setze sich nicht in die Kleider, es gehe vielmehr in die Poren. Wer in dieser Stadt zu Hause sei, der sei für alle anderen Städte verloren. Und das bedeutet auch, einen Teil seiner Identität an eine Stadt zu verlieren.
Es gibt noch ein anderes Charakteristikum, an dem sich Jarretts Konzentration aufs Wesentliche und seine skrupulöse Zurückhaltung offenbaren. Er kann mittlerweile auf eine gut fünfzig Jahre währende Karriere zurückblicken. Wenn man aber die Musiker aufzählen soll, mit denen er zusammen auf der Bühne oder im Studio gestanden hat, dann bedarf es dazu keiner außergewöhnlichen Gedächtnisleistung. Verglichen mit der Menge an Mitspielern, die etwa Miles Davis in einer vergleichbaren Zeitspanne vorweisen konnte, ist es im Fall von Keith Jarrett bei einer überschaubaren Zahl geblieben. Zudem war Jarrett, bevor er Aufnahmen mit eigenen Gruppen machte, im Grunde nur Mitglied von drei Bands: von Art Blakeys Jazz Messengers, dem Charles Lloyd Quartet und dem offenen Ensemble von Miles Davis. Aber was waren das für Stationen auf dem Weg zur Selbstfindung!
Aus der Liste von Musikern, die mit Art Blakey gespielt haben, ließe sich mühelos ein repräsentatives Lexikon des Jazz machen: Horace Silver, Lee Morgan, Bobby Timmons, Kenny Dorham, Donald Byrd, Benny Golson, Freddie Hubbard, Chuck Mangione, Wynton und Branford Marsalis, Wayne Shorter, Johnny Griffin und eben auch Keith Jarrett – sie alle und vielleicht noch zweihundert weitere Musiker haben dem Schlagzeuger, der nie Noten lesen gelernt hat, auf die Finger geschaut und dabei mehr gelernt als auf jeder Akademie. Charles Lloyd war aus anderem Schrot und Korn, aber für Keith Jarrett ebenso wichtig, weil er hip war. Er war der erste Jazzmusiker, der von der immer stärker zur Rockmusik tendierenden Jugend akzeptiert wurde. In der Flower-Power-Szene der sechziger Jahre hatte er einen großen Namen und trat mit seiner Band erfolgreich auf Popfestivals und in Rockmusikhallen auf.
Art Blakeys Jazz Messengers, hier mit dem Tenorsaxophonisten Wayne Shorter und dem Trompeter Lee Morgan 1961 in einem Jazzclub von Chicago, war eine der einflussreichsten Hardbop-Bands der fünfziger und sechziger Jahre. Die Band war 1965 Keith Jarretts erste Station als professioneller Jazzmusiker.
Miles Davis schließlich ist mit Sicherheit einer der größten Anreger in der Geschichte des Jazz gewesen, und er hielt seine Bands stets für talentierte junge Jazzmusiker offen. Seine Musik gehe immer auf die nächste Generation zu, meinte der Bassist Dave Holland, mit dem Miles in einer entscheidenden Phase seiner Karriere, während der Entwicklung zum Rockjazz, zusammengespielt hat. Ob er ein Pionier oder ein musikalischer Revolutionär war, darüber wird man sich nicht so leicht verständigen können. Selbst bei der Veränderung vom expressiven Bebop zum intellektuelleren Cool Jazz haben andere – Gil Evans etwa – eine ebenso wichtige Rolle gespielt. Auch für die modale Spielweise oder den Rockjazz gibt es noch andere Musiker, die als Vorreiter gelten können. Aber in all den Stilrichtungen seit 1945, mit Ausnahme des Free Jazz, den er an sich vorüberrauschen ließ wie einen bösen Traum, hat Miles Davis Wegmarkierungen hinterlassen. Kaum wurde ein neuer Stil geboren, hatte er schon einen gewichtigen Beitrag dazu geleistet. Er war ein notorischer Frühklassiker, der mit seinem Kind of Blue ein Meisterwerk eingespielt hat, von dem Komponisten wie György Ligeti meinten, man müsse es den späten Streichquartetten von Beethoven oder Bachs Kunst der Fuge an die Seite stellen.
Die Bands von Miles sind als Seminare einer imaginären Jazzuniversität bezeichnet worden. Was aber wurde dort gelehrt, und was haben die Studenten gelernt? Stilistische Gemeinsamkeiten wird man bei den vielen Pianisten, die mit Miles gespielt haben, kaum ausfindig machen können. Vielleicht hilft zum Verständnis, was der Gitarrist Mike Stern einmal anmerkte: Das Schwierigste beim Gitarrespiel sei die Atemtechnik, die Fähigkeit, Musik atmen zu lassen. Gerade das habe er bei Miles Davis gelernt. Andere Mitspieler haben Ähnliches berichtet. Miles Davis war kein Lehrer, er war ein Katalysator, der seinen Musikern geholfen hat, sich selbst zu entwickeln. Ein paar Hinweise, ein paar Absprachen, dann waren sie sich selbst überlassen. Die traumwandlerische Selbstsicherheit von Miles Davis, die Ausstrahlung seiner Person und das Vertrauen in die musikalischen Fähigkeiten seiner Mitspieler müssen mehr bewirkt haben als sattelfeste Musikkonzepte und krisensichere Klangarrangements.
Hört man Keith Jarrett auf den frühen Aufnahmen mit den Bands von Art Blakey, Charles Lloyd oder Miles Davis, wird man allerdings zu dem Schluss kommen, dass er schon damals seinen Bandleadern so viel zurückgeben konnte, wie er von ihnen bekam. Man gewinnt im Vergleich zu späteren Einspielungen mit eigenen Gruppen keineswegs den Eindruck, er sei durch das Zusammenspiel mit diesen Jazzgrößen als Pianist stilsicherer, versierter geworden. Was er im Spiel mit Art Blakey, Charles Lloyd und Miles Davis erwarb, war vor allem die notwendige Routine im Aufeinanderhören und im Auftreten. Keith Jarrett war schon früh auf einem Höhepunkt seiner Spielkunst angelangt, was keineswegs bedeutet, dass er sich nicht weiterentwickelt hat. Nur vertraute er dabei eher sich selbst als fremden Stimmen. Auch im Zusammenspiel mit anderen Künstlern hat er stets äußerste Konzentration, Ökonomie und ästhetische Vorsicht walten lassen. Bis heute gehören zu seinem Kreis nur eine Handvoll Musiker. Immer wieder tauchen dieselben Namen auf. Mit Jack DeJohnette und Gary Peacock bildet er seit mehr als dreißig Jahren ein Trio. Charlie Haden und Paul Motian gehörten immer wieder zu seinen Bandbesetzungen.
Der Trompeter Miles Davis hat von 1947 bis zu seinem Tod im Jahr 1991 nicht weniger als fünfundvierzig Pianisten in seinen diversen Bands beschäftigt, gelegentlich sogar drei von ihnen gleichzeitig in einer Combo. Der Pianist Keith Jarrett stand in der gleichen Zeit höchstens mit einem Dutzend Bläsern auf der Bühne. Als Jazzmusiker favorisiert Jarrett neben dem Solo die kleinen Besetzungen, Duo, Trio, Quartett. In einer Bigband könnte man ihn sich kaum vorstellen: Die einzige Aufnahme dieser Art geht auf einen Auftritt mit den College All-Stars von Don Jacoby zurück, für die er mit sechzehn Jahren als Repräsentant der Berklee School of Music am Klavier saß. Man läge nicht ganz falsch, ihn einen Eremiten zu nennen, der von Zeit zu Zeit seine Klause verlässt, um auf Bühnen weltweit seine gar nicht so einsiedlerische Kunst vorzuführen. Das verleiht ihm eine gewisse messianische Aura, auch wenn seine eher scheue bis abweisende Art ihn nicht dazu prädestiniert, zum Guru mit großer Anhängerschaft zu werden.
Auch sein Repertoire im Jazz kreist immer wieder um die drei selben Bereiche: Standards, die er freilich wie kaum ein anderer Interpret mit neuem Leben erfüllt, eigene Kompositionen und freie Solo-Improvisationen. Hinzu kommt die klassische Klavierliteratur von Bach bis zur Musik unserer Zeit. Keith Jarrett ist, man kann es nur betonen, in seinem Kunstverständnis von einer bemerkenswerten Konsequenz. Und er ist bis zur Selbstaufgabe kritisch. Es war in Lausanne, als ihn bei einem seiner Solo-Auftritte die Inspiration im Stich ließ, er an die Rampe trat und fragte, ob ein Pianist im Publikum sei, der für ihn weiterspielen möchte. Ihm falle nichts mehr ein. Das hätte auch zu Glenn Gould gepasst oder zu Piotr Anderszewski, der in Leeds, beim einzigen Klavierwettbewerb, an dem er jemals teilnahm, als aussichtsreicher Kandidat für das Finale nach dem zweiten Satz von Anton Weberns kryptischen Variationen op. 27 einfach das Podium verließ und nicht mehr gesehen ward. Später hat er sarkastisch angemerkt, manchem Juror sei überhaupt nicht aufgefallen, dass er das Werk nicht zu Ende gespielt habe. Tatsache aber ist, dass Anderszewski aus freien Stücken aufgegeben hat, weil er selbst mit seiner Interpretation nicht zufrieden war. Auf so etwas muss man auch bei Keith Jarrett gefasst sein, der von seinem Publikum nichts weniger erwartet als das, was er sich selbst bis zum Exzess abverlangt: bedingungslose Konzentration auf die Musik.
Keith Jarrett sagt, er habe sein Leben lang Schlagzeug gespielt, es sei sein erstes Instrument gewesen. Auch wenn das sachlich stimmen mag, ist es dennoch eine Übertreibung. Keith Jarretts Talent reicht aus, jedes Instrument erlernen und spielen zu können, wenn sein Interesse daran nur groß genug ist. Und wer seine stattliche Diskographie zu Rate zieht, wird in der Tat ein ganzes Arsenal verschiedenster Klangwerkzeuge finden, die er vom Beginn seiner Karriere an betätigt hat: Schlagzeug, diverse Perkussionsinstrumente und Flöten, Gong, Tabla, Saxophon, E-Gitarre, E-Bass, Glockenspiel, Harmonika, Banjo, Cello und dazu neben dem Klavier auch andere Tasteninstrumente wie Pfeifenorgel, Hammondorgel, E-Piano, Celesta, Cembalo, Klavichord. Dennoch: In die Annalen der Musik wird er nicht mehr als Bläser oder Schlagzeuger eingehen. Dort hat er längst seinen festen Platz als einer der großen Jazzpianisten und als klassischer Klavierspieler von Rang.
Jazzklavier und klassisches Klavier. Das sind allerdings zwei musikalische Weltanschauungen. Kein Jazzmusiker würde etwa vom Klavier als einem omnipotenten Instrument sprechen. Im Jazz stieß das Klavier stets an Grenzen. Es war immer zu weit vom Körper des Spielers entfernt, zu neutral, es blieb – auch wenn die Geschichte des Instruments und die Terminologie des Klavierspiels das Gegenteil suggerieren mögen – buchstäblich unantastbar. Und es war im Grunde unfähig, die Vorstellungen von Timbre und Zwischentönen zu befriedigen, die im afro-amerikanischen Musizieren eine so große Rolle spielen. Wer sich fragt, warum es Keith Jarrett, wenn er Jazz spielt, nicht auf seinem Klavierstuhl aushält, er sich wie ein Berserker aufführt, die Arme förmlich in das Klavier hineinschraubt und die Tasten biegt, dass einem Angst und Bange um den Flügel werden kann, findet hier die Erklärung: Er will dem unnahbaren Instrument zu Leibe rücken, ihm Blessuren beibringen, damit es zu jammern beginnt wie eine alte Bluesgitarre. Denn freiwillig gibt kein Klavier Blue Notes von sich, man muss sie aus ihm herausquetschen, und sei es, indem man sich ihm anverwandelt und zum Kentaur wird: halb Mensch, halb Klavier. Durch solche Metamorphosen hat Keith Jarrett Berühmtheit erlangt. Aber man mystifiziere sie nicht: Es sind Kraftakte des Geistes. Und Kraftakte bedeuten Arbeit. Der kluge Journalist und Jazzautor Peter Rüedi hat Keith Jarrett wohl nicht zuletzt auch deswegen ein Genie genannt. Eben davon handelt dieses Buch: von der Arbeit eines Genies.
2. Aufwachsen in Allentown
Nach Allentown im Staate Pennsylvania, an den Ausläufern der Appalachen gelegen, kommt man nicht zufällig. Man muss schon hinwollen. Aber wer will dorthin? In eine Industriestadt, deren bessere Zeiten vorüber sind, die mit ihren knapp hundertzwanzigtausend Einwohnern in der statistiksüchtigen amerikanischen Gesellschaft der Größe nach an 224. Stelle geführt wird und in der allerdings nur inoffiziellen Liste der konservativsten Kommunen des Landes auf dem zwölften Platz steht?
Bevor Billy Joel der Stadt 1982 auf dem Album The Nylon Curtain mit seinem Song Allentown ein klingendes Denkmal setzte, muss der politisch wache Sänger wohl an Bertolt Brecht gedacht haben, der die Frage stellte, ob in schlechten Zeiten auch gesungen werde, um sie sogleich selbst zu beantworten: «Ja, in schlechten Zeiten wird auch gesungen: von den schlechten Zeiten.» Im schwerindustriellen Abendrot von Pennsylvania am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts wollte Billy Joel – wie er selbst bekannte – eigentlich Levittown besingen, die Stadt, in deren Nähe er aufgewachsen ist. Später dachte er auch an Bethlehem, die kleinere Nachbargemeinde von Allentown, die noch weit mehr zu leiden hatte unter dem deprimierenden Verschwinden der Stahlküchen und des Kohlebergbaus während der Rezession in den frühen achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Aber die Namen Levittown und Bethlehem waren weniger sangbar, zudem nicht so leicht in einen Reim zu bringen, und der Sänger wich auf Allentown aus, um mit seinem stampfenden Worksong den wohlhabenden Bürgern des Landes die weniger privilegierte Arbeiterklasse in Erinnerung zu rufen. In dieser ökonomischen Verzweiflungshymne gebührt Allentown also durchaus kein Vorrang vor anderen Städten. Billy Joel meinte, Allentown sei lediglich ein Symbol für die Situation vieler amerikanischer Städte in der Zeit des industriellen Niedergangs: «Allentown ist nur eine Metapher für die wirtschaftliche Misere Amerikas. Es klingt so typisch amerikanisch wie Jimmytown, Bobbyburgh, Anytown.»
Der Bürgermeister der Stadt wusste freilich, warum er, als der Song herauskam und sehr schnell populär wurde, Billy Joel die Ehrenbürgerschaft antrug, verbunden mit einer symbolischen Übergabe des Stadtschlüssels. Auch wenn manche Bürger nicht sehr glücklich waren mit dem Image ihrer Stadt, das der Song bestätigte und ausposaunte, so hat Allentown doch von dem grobkörnigen Lied profitiert. Nahezu in jeder Weltgegend wurden selbst lange Zeit nach dem Erscheinen des Songs die Bürger von Allentown, wenn sie erzählten, woher sie kommen, von den Kennern amerikanischer Popmusik, also von allen, mit dem Satz begrüßt: «Oh, aus Allentown. Hat Billy Joel nicht einen Song über euch geschrieben?» In Amerika nennt man so etwas «einen Ort auf die Landkarte setzen».
Das Beispiel zeigt zugleich die Allgegenwart, in gewisser Weise auch die Allmacht von Popmusik. Hat Keith Jarrett die Ehrenbürgerschaft seiner Geburtsstadt bekommen? Hat der größte Musiker, der je aus Allentown kam, die Stadt auf die Landkarte gesetzt? Jarrett hätte wohl nicht einmal dann den Bekanntheitsgrad seiner Heimatstadt steigern können, wenn er eine Jazz-Suite für großes Orchester und Klavier unter dem Titel Allentown komponiert hätte. Um allgemeine Aufmerksamkeit zu erreichen, bedarf es schon eines Billy Joel, der publikumswirksam die Ärmel hochkrempelt; von Frank Sinatra, Liza Minnelli oder Tony Bennett gar nicht zu reden, denen man es allerdings nie und nimmer abgenommen hätte, wenn sie neben Chicago, New York oder San Francisco ernsthaft Allentown, my Allentown oder I Left My Heart in Allentown gesungen hätten.
Allentown liegt mitten in jenem ehemals prosperierenden Manufacturing Belt, dem größten industriell geprägten Wirtschaftsraum weltweit, der sich nahezu von Wisconsin bis New Jersey erstreckt und aus dem seit den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts unter anderem durch die Verlagerung der Schwerindustrie in billiger produzierende Entwicklungsländer, Importe preiswerterer Güter und die Abwanderung von Arbeitskräften jenes ökonomische Notstandsgebiet wurde, das als «Rust Belt» traurige Berühmtheit erlangte. Ähnlich wie das Ruhrgebiet ist dieser «Rostgürtel» strukturell beschwerlich, langwierig und noch immer nicht befriedigend zu einer Region mit funktionierendem Dienstleistungsgewerbe umgewandelt worden. Welche Auswirkung die Wirtschaftskrise für die Region bis heute hat, mag man am Beispiel von Detroit ermessen, dem einstmals boomenden Zentrum der amerikanischen Automobilindustrie, einer Stadt, die in den fünfziger Jahren eineinhalb Millionen Menschen beherbergte und heute knapp die Hälfte, davon fünfundachtzig Prozent Afro-Amerikaner mit extrem schlechten Beschäftigungschancen. Detroit nähert sich mit fünfundachtzigtausend verlassenen oder heruntergekommenen Häusern und geschlossenen Schulen nahezu dem Zustand einer Geisterstadt. Es hat als erste amerikanische Großstadt im Juli 2013 Insolvenz angemeldet und gilt heute als außerordentlich gefährlich – wie alle hoffnungslosen Orte auf diesem Planeten.
Keith Jarrett kommt aus Allentown und ist der Region treu geblieben, sieht man einmal von dem kurzen Aufenthalt während seines sehr schnell wieder abgebrochenen Studiums an der Berklee School of Music in Boston und der Zeit seines Karrierebeginns in New York ab. Seit 1972 lebt er in Oxford, im Nachbarstaat New Jersey, einen Katzensprung entfernt von seinem Heimatort. Als er geboren wurde, sah es freilich noch etwas anders aus in Allentown und im gesamten Lehigh Valley zwischen dem östlichen Pennsylvania und dem westlichen New Jersey, die hier aneinandergrenzen. Steinkohle-, Eisen- und Stahlindustrie, Erdölförderung, Maschinen- und Werkzeugbau wurden noch im großen Stil betrieben, und es gab genug Arbeit, bescheidenen Wohlstand und eine sicher scheinende Perspektive für junge Familien. Eine besondere Liebesbeziehung zu Allentown kann Keith Jarrett dennoch nicht entwickelt haben, wenn er der Stadt im Rückblick auf seine frühen Jahre ein verheerendes Zeugnis ausstellt, wobei er natürlich immer die Kultur im Blick behält: «Allentown ist eine der musikalisch armseligsten Städte der Vereinigten Staaten. In dieser Stadt gibt es nichts, kein Essen, keine Musik, kein Leben. Es ist eine tote Stadt.»
Da spricht der radikale Künstler, der kein Mittelmaß und keine Provinz ertragen kann, nur den Nabel der Musikwelt oder die Einöde zur Versenkung und zum freien Atmen. Immerhin aber kennt man Allentown auch als «Band City», weil die Stadt die älteste «Concert Band» Amerikas beherbergt, vergleichbar den vielen Amateurblasorchestern in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Sie und noch eine Reihe weiterer lokaler Ensembles treten regelmäßig in der Konzertmuschel des städtischen West Park auf. Die Stadt veranstaltet zudem jährlich den Drum Corps International Eastern Classic, ein Treffen der weltweit besten jungen Spielmannszüge, die in Amerika, erweitert um Tanzgruppen, «Drum and Bugle Corps» genannt werden. Von solchen Freiluftveranstaltungen und volkstümlich-populären Kapellen hat etwa Charles Ives immerhin seine Anregungen für viele hochoriginelle Orchesterwerke bekommen. Zudem wurde in Allentown 1896 eine Markthalle errichtet, die drei Jahre darauf in ein Theater für alle möglichen kulturellen Veranstaltungen umgebaut wurde. Seit 1959 dient es dem acht Jahre zuvor gegründeten Symphonieorchester von Allentown als Residenz. Dieses Haus, das heute Miller Symphony Hall heißt, hat eine Reihe illustrer Künstler erlebt, von Sarah Bernhardt zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts über die Marx Brothers, die hier in der Provinz ihre später am Broadway erfolgreich herausgebrachte musikalische Revue I’ll Say She Is erprobten, bis zu populären Entertainern wie Bing Crosby und erfolgreichen Jazzmusikern wie Benny Goodman, die Allentown in ihre Tourneen einbezogen.
All das zählte für Keith Jarrett wohl schon während seiner Kindheit in Allentown recht wenig und für den etablierten Künstler ohnehin nicht, der auf eine Zeit des Heranwachsens und der Selbstfindung zurückblickt, die früh schon durch familiäre Probleme erschüttert wurde. Keith Jarretts Eltern hatten sich noch vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kennengelernt und 1942 geheiratet. Die Herkunft des Vaters Daniel Jarrett lässt sich bis zu irisch-schottischen und französischen Einwanderern des achtzehnten Jahrhunderts zurückverfolgen. Die familiären Wurzeln der Großeltern mütterlicherseits liegen noch in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie. Die Großmutter kam um 1896 als Anna Temlin in Sögersdorf zur Welt, einer kleinen Gemeinde in der Südoststeiermark, die später durch eine neue Grenzziehung zu Jugoslawien kam und heute als Segovci zu Slowenien gehört. Um 1910 wanderte Anna aus dieser unruhigen Region Europas aus, um in Bethlehem, Pennsylvania, bei zwei älteren Schwestern zu leben, die schon Jahre zuvor nach Amerika gekommen waren. In Bethlehem lernte sie Joseph Kuzma kennen, der ebenfalls Slowene war und aus Prekmurje stammte, einer historischen Region im äußersten Nordosten Sloweniens, im heutigen Vierländereck Slowenien, Österreich, Ungarn, Kroatien. Als Anna zwanzig war, heiratete sie Joseph Kuzma und zog mit ihm nach Cleveland, Ohio, wo zwei ihrer drei Kinder zur Welt kamen, Rudolph, der im Alter von fünf Jahren bei einem Unglücksfall ums Leben kam, und Irma, die spätere Mutter von Keith Jarrett. Während Anna Kuzma mit dem dritten Kind schwanger war, trennte sich ihr Mann von ihr, und sie ging mit ihrer Tochter Irma zurück nach Pennsylvania, wo Joseph, der zweite Sohn, geboren wurde. Vier Jahre später erkrankte Anna Kuzma an Tuberkulose, und Irma kam mit ihrem Bruder in ein Waisenhaus.
Anna Kuzma war erst Mitte dreißig, als sie aus dem Sanatorium in ein Hospiz, das Lehigh County Home, verlegt wurde, weil man glaubte, nichts mehr für sie tun zu können. Im Hospiz kam es dann zu einer denkwürdigen und folgenreichen Begegnung mit einem Mitglied der «Christian Science Church». Die Gespräche, die sich zwischen Anna Kuzma und dem Mann entwickelten, bewirkten bei ihr offenbar eine Art Wunderheilung. Nach kurzer Zeit fühlte sie sich besser, konnte aus dem Hospiz entlassen werden und galt als vollkommen geheilt, wobei durch eine Röntgenuntersuchung nicht einmal mehr eine frühere Erkrankung festgestellt werden konnte. Anna Kuzma zog nach Allentown, wo ihre beiden Kinder zur Schule gingen, Joseph aber kurz vor dem Abschluss an der Highschool beim Schlittschuhlaufen auf dem zugefrorenen Fluss einbrach und ertrank. Irma Kuzma arbeitete nach der Schulzeit als Sekretärin bei dem Immobilienmakler Roscoe Q. Jarrett, dessen Sohn Daniel sie später heiratete. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass Anna Kuzma kurz nach ihrer vollständigen Genesung gemeinsam mit ihrer Tochter Irma der «Christian Science Church» beitrat.