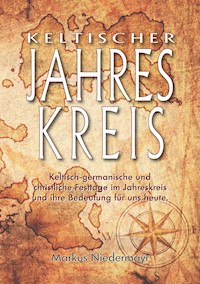
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Welche Bedeutung haben die jährlich wiederkehrenden christlichen Festtage noch für uns Menschen zu Beginn des 21. Jahrhunderts? Wie sind sie eigentlich zustande gekommen? Was verbindet sie mit den Jahreszeiten und den keltisch-germanischen Feiertagen? Welche besonderen Zeitqualitäten kommen in ihnen zum Ausdruck? Vor allem aber: Was können wir tun, um mit ihrer Hilfe unser spirituelles Leben auszurichten und zu bereichern? Es sind hauptsächlich diese Fragen, denen Markus Niedermayr in seinem gründlich recherchierten und zugleich stets praxisorientierten Buch Keltischer Jahreskreis nachgeht. Eine kurze Ausführung der Geschichte von Kelten und Germanen dient dem Verständnis des Ursprungs der Feste. Viele Inhalte dieses reich bebilderten Buches sind spiritueller und philosophischer Natur, wie es den alten Gepflogenheiten und Lebensweisen entsprach, ergänzt mit Zitaten und Geschichten. Zur weiteren Ergänzung und Vertiefung werden zusätzlich Themen angesprochen wie z. B. »Rituale«, »Räuchern«, »Schamanismus«, »Die Macht des Gebetes«, »Meditation«, »Die letzten Worte Jesus« und vieles mehr. Der Schwerpunkt des Buches liegt auf der Bedeutung und der Umsetzung alter Traditionen für das heutige Leben. Die Fakten sollen dazu dienen, die Leser anzuspornen selbst aktiv zu werden. Das Buch möchte einen Anstoß geben, die alten Weisheiten, Rituale und Bräuche für sich neu zu definieren und umzusetzen, passend zum jeweiligen Alltag. Entsprechend dem Leitsatz von M. Niedermayr: "Alte Traditionen und altes Wissen haben für mich nur dann einen Sinn, wenn es einen Bezug zum Leben heute gibt."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen Bruder Horscht
INHALTSVERZEICHNIS
ZU BEGINN
Teil 1
WIE DIESES BUCH ENTSTAND
Teil 2
KULTURELLE WURZELN
DIE KELTEN
DIE GERMANEN
DIE DEUTSCHEN
RÜCKBLICKENDE VORAUSSCHAU
Teil 3
DER JAHRESKREIS
ÜBERSICHT
Teil 4
JANUAR
FEBRUAR
MÄRZ
APRIL
MAI
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DEZEMBER
ZUM SCHLUSS
VIDEO-VORTRÄGE
EMPFEHLENSWERTE LITERATUR
DER AUTOR
ZU BEGINN
„Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.”
Gerald Krieghofer
Als Erstes möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie sich für die alte, vor allem europäische Kultur, ihre Rituale, Festtage und Gottheiten interessieren. Doch was hat das alles mit unserem Leben heute zu tun? Hat es noch Bedeutung? Sind es nur noch nette Geschichten, welche die Fantasie beflügeln, ohne weiteren Belang?
Sicherlich sind die Bräuche nicht mehr in der Form gegenwärtig, wie sie es einst einmal waren. Vieles ist verschüttet und vergessen – und doch ist da eine Kraft, die über die Jahrtausende hinweg bis heute wirkt und uns eine Ausrichtung geben kann. Das ist es, womit ich mich in diesem Buch beschäftige und Ihnen nahebringen möchte.
Das Buch ist in vier Abschnitte unterteilt. Es beginnt mit meiner persönlichen Geschichte und dem Weg, den ich gegangen bin. Was ich erforscht, gesucht und zusammengetragen habe, liegt nun in dieser Form vor Ihnen. Im zweiten Teil versuche ich, einen Eindruck zu vermitteln, wie die Lebens-, Handlungs- und Denkweise der Menschen in früheren Zeiten war. Zumindest das, was wir heute noch davon wissen. Das dient dem Verständnis, wie sich unter dem damaligen Umfeld kulturelle Gepflogenheiten entwickelt haben könnten.
Der dritte Teil gibt eine kurze Übersicht über die wichtigsten keltischen Jahreskreis-Festtage. Im Hauptteil, dem vierten, beschreibe ich von Monat zu Monat die wichtigsten natürlichen und kulturellen Ereignisse der jeweiligen Jahreszeit. Ich gehe darauf ein, welche Feste, Rituale und spirituelle Ausrichtungen von alters her gepflegt worden sind und auch heute noch werden. Sowohl keltische als auch germanische und christliche. Der für mich wichtigste Aspekt dieses Buches ist der Bezug zu unserem Leben heute. Wieso sollte sich heutzutage jemand auf eine mehr als 2000 Jahre alte Kultur berufen, sich mit den Sitten und Gebräuchen von damals beschäftigen und diese sogar zelebrieren? Ich versuche in diesem Buch aufzuzeigen, welchen Wert für uns dieses althergebrachte Wissen haben kann, was wir übernehmen und auf unsere heutige Lebensweise übertragen können.
Für mich, der sich intensiv auf den Suchprozess nach unseren traditionellen Wurzeln eingelassen hat, sind diese immer lebendiger und gegenwärtiger geworden. Deshalb beschreibe ich bestimmte Wirkungsweisen, Gottheiten und Kräfte in der Gegenwartsform – sie haben für mich noch heute Gültigkeit. Wenn ich hingegen auf alte Bräuche und Rituale Bezug nehme, die in der Form heute vermutlich nicht mehr zelebriert werden, so schreibe ich in der Vergangenheitsform. Auf diese Weise kommt es vor, dass beide Zeitformen in einem Absatz nebeneinanderstehen.
Das Buch ist keine umfassende historische Darlegung und hat keinen Anspruch, alle Details zu berücksichtigen. Es soll eine Quelle der Information und vor allem der Inspiration sein. Alle Leser werden aufgefordert, sich im eigenen Umfeld mit dem Stoff auseinanderzusetzen und zu erforschen, welche individuellen Möglichkeiten es gibt, das alte Wissen zu nutzen und umzusetzen.
Viel Freude, viele Erkenntnisse und Eingebungen bei der Lektüre wünscht Ihnen
Teil 1
Es kam die Zeit, in der das Risiko, eine verschlossene Knospe zu bleiben, schmerzvoller war als das Risiko, das ein Erblühen mit sich brachte.
Anaïs Nin
WIE DIESES BUCH ENTSTAND
Der Inhalt dieses Buches wurde von mir über lange Zeit immer weiterentwickelt. Ich habe viele Jahre einmal im Monat eine Abendveranstaltung geleitet mit dem Titel „Trommeln, Rituale und Stille”. Anfangs benutzte ich in meinen Ankündigungen stets den gleichen Text. Später sind aktuelle Themen eingeflossen. Mit der Zeit wuchs mein Interesse an den jeweiligen Jahreskreis-Festtagen. Dieses Wissen habe ich dann den Texten hinzugefügt.
Indigene Völker
Schon in jungen Jahren wandte ich mich dem Leben und der Kultur der nordamerikanischen Ureinwohner zu. Ihre Rituale, ihre Spiritualität und ihre Verbundenheit mit der Natur haben mich nachhaltig beeinflusst. Anfang zwanzig, nach einem mehrmonatigen Besuch einiger Staaten der USA und ihrer Indianer-Reservate, wurde mir klar, dass es die „Indianer” immer noch gab. Ich war jedoch erstaunt, dass sie nicht mehr in hirschledernen Leggings mit Pfeil und Bogen umherlaufen, in Kanus paddeln und in Tipis wohnen. Schließlich war Winnetou jahrelang mein Vorbild. Bestürzt habe ich im Taos Pueblo in New Mexiko neben den Häusern Chevrolets stehen und auf den Dächern Satellitenschüsseln gesehen. Meine Träume und Vorstellungen vom „edlen Wilden” wurden nachhaltig irritiert . Von da an habe ich alles gelesen, was ich zu dieser Kultur finden konnte. Wie ich festgestellt habe, war und ist sie über die Jahrhunderte zwar lädiert, aber weitergetragen worden und hat eine neue Blüte erreicht. Die damit verbundene romantische Vorstellung ist einem Verständnis von einer Lebensart gewichen, die mir auf ganz natürliche Weise sehr entsprochen hat. Ich habe im Laufe der Zeit etliche Älteste, Medizinmänner und -frauen (heute würde man Schamanen und Schamaninnen sagen), spirituelle Führer, auch aus Südamerika, kennengelernt. Von ihnen durfte ich sehr viel lernen und übernehmen. Rituale, Weisheiten, Einheit mit der Natur, Lebensanschauungen, Umgang mit Kindern und vieles mehr. Das alles habe ich aufgesaugt. Es hat nach und nach auch mein Verständnis dieser Welt geprägt.
Als Nächstes fand ich über Bücher Zugang zur Kultur der Aborigines Australiens. Ich habe Ähnlichkeiten und Unterschiede studiert, war aber nie in dem Land selbst gewesen und habe außer bei Rock-Konzerten von Aborigines keine persönlich kennengelernt. Doch die Grundhaltung war mir vertraut, und ich würde sagen, es ist eine eigene Variante eines zutiefst naturverbundenen Volkes, geprägt durch die dortige Landschaft und deren Möglichkeiten.
Von den alten Völkern Afrikas und deren Kultur weiß ich leider wenig. Doch das, was ich gehört und gelesen habe, ist ebenfalls nicht weit entfernt von dem Wissen und Leben der anderen Naturvölker.
Es gibt noch heute einige indigene Naturvölker wie die Samen in Finnland und Norwegen, verschiedenste indianische Völker in Amerika, ebenso einige in Sibirien und auch in Neuguinea, wo weltweit am meisten von ihnen leben. Doch auch an diesen Orten scheint durch die Entwicklung neuzeitlicher Kultur und Religion von den ursprünglichen Traditionen nicht mehr viel übrig geblieben zu sein. Indigene Völker machen heute immerhin knapp fünf Prozent der Weltbevölkerung aus und sind in etwa 90 Staaten zu finden.
Die alten Völker teilen die Auffassung, dass alle Lebewesen, aber auch unbelebte Objekte eine Seele besitzen oder von einem Geist erfüllt sind. Das wird unter dem Begriff „Animismus” als ethnische Religion zusammengefasst. Es wird auch als „Ur-Religion” bezeichnet. Leider wird der Begriff manchmal abwertend ( im Sinne von „primitiv”) benutzt. Sollte ich jemals gezwungen sein, mich zu einer Religion zu bekennen, würde ich den Animismus wählen.
Trance-Reisen
Als ich später in Seminaren mit Trommel-Trance-Reisen (auch sogenannten Krafttierreisen) vertraut gemacht wurde, war das wie ein Heimkommen. Ohne Übergang, Zweifel oder einen Vorbehalt bin ich sofort tief eingetaucht und wusste, dass ich meine Form gefunden hatte, die ich in meiner Weise weiterentwickeln wollte, verbunden mit dem Wissen über Rituale, das sich in mir angesammelt hat. Kurzum, der „schamanische Weg” wurde zu meinem. Und wieder habe ich alle Literatur, die ich finden konnte, parallel zu den lebendigen Erfahrungen, verschlungen.
Trommeln
Einem inneren Bedürfnis folgend, wollte ich selbst meine Trommel herstellen und experimentierte für mich allein mit verschiedenen Möglichkeiten. Ich scheiterte öfter am mangelnden Wissen über Material und Anwendung, sodass kaum brauchbare Instrumente entstanden. Doch bekam ich ein Gespür für die Richtung. Als ich ein Trommel-Seminar mit Erich Ferstl mitmachen^ durfte und seine Trommeln gesehen habe, war für mich sofort alles klar. Dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Das Grundprinzip hatte ich nun gesehen, und meine Experimente, zumindest im Hinblick auf den Korpus, waren von da ab erfolgreicher.
Die Bespannung war eine weitere große Herausforderung. Welche Häute sollte man verwenden und woher bekommt man diese, waren die großen Fragen? Ich stellte unter anderem fest, dass es in ganz München keinen einzigen Gerber mehr gab – erstaunlich. So begann die Suche nach Materialien. Ich sammelte Erfahrungen mit unterschiedlichen Qualitäten, Strukturen, Häuten von verschiedenen Tieren in Verbindung mit verschiedenen Größen und Durchmessern von Trommeln. Es gab viel zu lernen. Bis heute ist meine Entwicklung damit nicht abgeschlossen, jedoch auf einem guten Stand. Einige meiner Trommeln sind mindestens zwölf Jahre alt und nach wie vor im Einsatz, ohne Ermüdungserscheinungen aufzuweisen.
Schamanisch-Indianisch
Somit kamen verschiedene Erfahrungen zusammen und verbanden sich in mir, lehrten und entwickelten mich und führten mich immer weiter auf meinem schamanisch-indianischen Weg der Rituale und Trance-Reisen.
Noch ein Wort an dieser Stelle, um Missverständnisse zu vermeiden.
Man darf „indianisch” und „schamanisch” nicht in einen Topf werfen (was manchmal geschieht). Der Name „Indianer” stammt bekanntermaßen von Christoph Columbus. Diese verallgemeinernde Bezeichnung entspricht nicht der Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen der Völker, die auf dem amerikanischen Kontinent gelebt haben. Es wurden später die Begriffe „Native Americans” oder „Native people” eingeführt, die jedoch alle in Amerika Geborene einschließen. Deshalb bevorzugen heute die Indigenen des Landes den Begriff „American Indians”. Die Indianergruppen selbst haben sich meist mit ihren Gruppennamen entweder nach der Landschaft, in der sie lebten, oder mit dem Wort für die „Menschen” oder „das Volk” in ihrer jeweiligen Sprache bezeichnet.
Der größte Unterschied zeigt sich wohl zwischen Süd- und Nordamerika. Doch auch auf dem Gebiet der heutigen USA und Kanada haben die diversen Stämme oft nur wenige gemeinsame Bräuche, ganz zu schweigen von den Erzählungen, Riten und Lebensformen. Die unterschiedlichen Lebensarten der verschiedenen Stämme wurden oft zusammengeworfen. Man sprach, vor allem in Hollywood, verkürzt von DER Indianer.
Šaman
Doch zurück zur Definition von „schamanisch”. Es gibt bei so gut wie allen Völkern „Schamanen” und „Schamaninnen”. Der Begriff stammt ursprünglich von den Tungusen (Angehörigen der mandschu-tungusischen Bevölkerungsgruppen). Šaman bedeutet in der mandschu-tungusischen Sprache „Jemand, der weiß” und bezeichnet einen besonderen Wissensträger. Reisende und Forscher (z. B. Michael Harner) haben diesen Begriff über die Welt verbreitet. Was sie nun genau sind, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ob Priester, Heilerinnen, Hexer, Medizinmänner und -frauen, Zauberer usw. auch Schamanen sind oder doch eine andere Gruppe darstellen, wird viel diskutiert. Es werden dazu Überlegungen angestellt und verschiedene Kriterien herangezogen.
Nach meinem Verständnis sind Schamanen in erster Linie Diener des Volkes. Was alle weltumspannend gleichermaßen zu haben scheinen, ist einen Zugang zur „Anderwelt”. (auch „Anderswelt” oder „Geistige Welt” genannt). Der Zugang zu dieser Welt wird meist unter Zuhilfenahme von Trommeln, Rasseln, Flöten und anderen Instrumenten in Trancezuständen erreicht. Darüber hinaus werden mancherorts durch Substanzen und Pflanzen nicht alltägliche Zustände hervorgerufen, die sie auf diesem Weg unterstützen. Auf diese Weise werden Informationen, Hinweise von krank machenden Ursachen und deren Heilungen oder sonstige Einsichten aus der „nicht alltäglichen Wirklichkeit” vermittelt.
Ich möchte an dieser Stelle bemerken, dass ich schamanische Instrumente, Methoden und Werkzeuge benutze, mich aber niemals als Schamane bezeichne würde. Dieser Begriff ist modern geworden und wird zum Teil sehr undifferenziert benutzt, teils um sich selbst oder bestimmten Situationen einen mystischen Anstrich zu verleihen. Nach meinem Verständnis sind schamanisch Arbeitende berufene Menschen, die ausschließlich für ihren Stamm auf dieser besonderen Ebene wirken und zur Verfügung stehen. Meist werden sie von den Ältesten oder ihren Vorgängern berufen und eingeweiht.
Weiterentwicklung
Ich persönlich habe im Laufe der Jahre gelernt, die Dinge differenzierter zu betrachten, und mir erlaubt, das, was ich durch die Beschäftigung mit dieser besonderen Welt verinnerlicht habe, in meiner Form anzuwenden und weiterzuentwickeln.
Ich weiß, dass es einige geben wird, die der Meinung sind: Nur wer von einem bestimmten Stamm und dessen Führung eingeweiht wurde, ist berechtigt, Rituale zu übernehmen, und es bedarf dessen Erlaubnis, diese andernorts anzuwenden. Das mag für manche stimmen, ich sehe das anders. Die Welt ist eine Fülle und ein Geschenk an Möglichkeiten, die uns allen zur Verfügung stehen. Wir sind alle in stetiger Veränderung und Entwicklung begriffen. Mit diesem Fluss zu gehen sehe ich als Aufgabe, dem Lebendigen und unserer Bestimmung als Mensch gerecht zu werden und zu dienen. Ich bin keiner bestimmten Richtung oder ethnischen Gruppe verpflichtet und möchte es auch nicht sein. Mein Weg basiert auf der Verbundenheit mit der Natur und der geistigen Welt und auf dem, was mich dadurch gelehrt wird. Von dort bekomme ich Einsichten, Hinweise, Ausrichtung und Weisheit. Umgekehrt erlebe ich es immer wieder, dass Teilnehmer meiner Seminare Dinge von mir übernehmen und in ihrem Kreis weiterentwickeln. Ich beobachte das mit Freude, da ich mir nicht anmaße, spontan entstandene oder über längere Zeit entwickelte Rituale als „meine” zu bezeichnen und alleinigen Anspruch darauf zu erheben. Ich werde geleitet und geführt von einer Kraft, die weit über das hinausgeht, was mein begrenztes Denken erfassen kann, und die doch so spürbar, sichtbar und erlebbar ist. Dieser Quelle entspringt aus meiner Sicht alles, was uns inspiriert, alle Ideen und kreativen Einfälle, alle alten und neuen Rituale und alle Handlungen, die uns helfen, die Verbundenheit mit dem All-Einen zu zelebrieren. Auch wenn das durch einen einzelnen Menschen kanalisiert wurde, sollte es allen zur Verfügung stehen, da es nur aus einer Quelle, der einzigen, kommen kann. Egoistisches Denken ist hier nicht angebracht.
Die europäische Tradition
Nachdem ich mich also viele Jahre mit diesen Traditionen, Ritualen und Weisheiten von Völkern anderer Kontinente auseinandergesetzt hatte, kam die Frage in mir auf, wie es eigentlich um unsere eigenen Wurzeln bestellt ist. Gibt es altes Wissen und Rituale, die auf unsere, auf dem europäischen Kontinent lebenden Vorfahren zurückgehen, insbesondere in jenem Lebensraum, in dem ich mich selbst aufhalte?
Nach und nach begann ich Ausschau zu halten, was nach alter Tradition zu den jeweiligen Jahreszeiten und Feiertagen gebräuchlich ist. Welche – zumeist christlichen – Rituale bis heute immer wiederkehren und gepflegt werden. Dergestalt bin ich bald in Kontakt mit den Überlieferungen der Kelten gekommen, diesem viel älteren Gedankengut, zumindest mit dem, was sich bis heute davon erhalten hat. Und wie schon zuvor, habe ich wieder alles an Literatur, was ich zu dem Thema finden konnte, durchforstet.
Dieses Wissen, meine Verbindung zur Natur, zu den Jahreszeiten und zu den jeweiligen Stimmungen und meine eigene Intuition haben mich dazu gebracht, die Texte zu meinen Seminaren den jeweiligen Jahreszeiten anzupassen. Ich begann, Wichtiges hervorzuheben, daran zu erinnern und aufzuzeigen, was für uns Menschen zum jeweilig gegenwärtigen Zeitpunkt wichtig sein könnte. Ich habe mich dabei nicht nur an die althergebrachten Überlieferungen gehalten, sondern mich gefragt, was diese mit uns heute zu tun haben, und mich von der Natur und meiner inneren Quelle inspirieren lassen.
Vieles von dem alten Gedankengut kommt aus einer Zeit, als es noch keinen Strom, kein fließendes Wasser, keine Heizung und sonstigen Luxus gab, der uns das Leben, vor allem im Winter, so angenehm und uns von der Natur unabhängig macht. Ich suchte (und suche weiterhin) immer wieder nach Brücken in das heutige Leben: Welchen Wert haben beispielsweise die alten Verbindungen zum Lauf der Sonne, dieser so wichtigen Kraft für unser Überleben? . Mich interessiert desgleichen, welche Gedanken und Überlegungen unabhängig von Kultur und Geografie entstanden sind. Was ist allzeit wahr und umsetzbar für uns? Welche Ausrichtungen können uns in unserem Alltag helfen und unterstützen? Das alles floss in meine Texte ein und begleitet mich und dadurch auch die Teilnehmenden meiner Seminare durchs Jahr. Ich überprüfte jedes Jahr aufs Neue die Schriften auf ihren aktuellen Bezug. Dafür habe ich mich ganz besonders von der Natur, ihrem Wechsel und den damit verbundenen Botschaften inspirieren lassen.
So ist über Jahre eine stattliche Sammlung von Texten entstanden, eine Mischung aus Althergebrachtem und Gedanken zur Neuzeit. Eines Tages hatte ich dann den Wunsch, alles zusammenzufassen. Das vielfach Ergänzte liegt Ihnen nun als Buch vor.
Ich möchte betonen, dass ich mich nicht als Historiker verstehe und auch nicht den Anspruch habe, alles berücksichtigt und vollständig erfasst zu haben. Das ist nicht mein Ansinnen. Dafür gibt es Menschen, deren Beruf es ist, umfangreiche Bücher darüber zu verfassen.
Mein Hauptanliegen ist die erwähnte Übertragung und der damit verbundene Anstoß, sich zur jeweiligen Jahreszeit und zu den aktuellen (Fest-)Tagen zu besinnen, innezuhalten, sich auszurichten. Und in Verbindung mit der Natur, der Anderwelt, der Umwelt und der eigenen inneren Stimme zu lauschen und dem zu begegnen, was es außerhalb des Alltäglichen sonst noch gibt, alleine oder in Gemeinschaft mit anderen. Dazu dienen mir alte Geschichten und Mythen.
Und so bitte ich Sie, die in dem Buch dargelegten Überlieferungen, Anregungen und Überlegungen für sich zu nutzen als Impuls für eigene Gedanken und vielleicht deren Umsetzung in Handlungen. Entwickeln Sie vorhandene Ideen weiter, kreieren Sie eigene Jahreskreis-Rituale, Ihre eigenen Gebete und Meditationen!
Wenn ich Sie dazu inspiriert haben sollte, ist das Anliegen meines Buches verwirklicht.
Teil 2
Gott schläft im Stein, atmet in der Pflanze, träumt im Tier und erwacht im Menschen.
Indianisches Sprichwort
KULTURELLE WURZELN
Bevor ich auf den Jahreskreis und die damit verbundenen traditionellen Tage eingehe, möchte ich seinen Ursprung ergründen. Wo liegen eigentlich die Wurzeln unserer mitteleuropäischen Kultur, wie wir sie heute kennen?
Wie ich im vorigen Teil schon beschrieben habe, bin ich irgendwann auf die Suche nach unseren kulturellen Wurzeln gegangen. Ich war erstaunt, als mir klar wurde, dass ich nichts über die Zeit unserer Ahnen wusste, dass mir die alten Rituale und Feste unbekannt waren, erstaunt, wie wenig wir heute wissen und wie wenig davon in unseren Alltag einfließt. Es braucht einen Anstoß und Willen, um diese Ursprünge zu erforschen. Das liegt vor allem am Christentum. Dieses hat alles Alte entweder rigoros verfolgt und ausgemerzt oder sich angeeignet und integriert und teilweise in umgewandelter Form bis heute weitergeführt.
Für die meisten von uns scheint unsere Geschichte erst mit Jesu Geburt zu beginnen. Manche haben vielleicht noch die Namen und die Grundlehren einiger griechischen Philosophen im Kopf, aber alles andere ist vage und dunkel. So war auch mein Gefühl, bis ich zu fragen und zu suchen begann.
Die Wurzeln unserer Traditionen liegen im keltischen Brauchtum. Darauf werde ich weiter unten eingehen. Einige meinen, dass die alten Bräuche germanisch sind. Doch das ist nur teilweise richtig, da die Germanen keine nennenswerte Kultur hatten, sondern bereitwillig die keltischen Formen übernommen haben, wenn sie mit ihnen in Kontakt gekommen sind.
Die Quellen
Leider ist sehr wenig erhalten und überliefert. Wie zuvor erwähnt, haben die Christen ganze Arbeit geleistet. Wir wissen heute nur aus zwei verlässlichen Quellen etwas über die Zeit vor und um Christi Geburt. Weder von Kelten noch von Germanen gibt es Schriftliches, das einen Einblick in deren Lebensart gewährt.
Die eine Quelle besteht aus Aufzeichnungen der Römer. Julius Cäsar hat akribisch und umfangreich über den „Bellum Gallicum” (Gallischer Krieg) aufschreiben lassen. Nur sind diese Berichte, so umfangreich und detailliert sie auch sein mögen, natürlich aus der Sicht der Römer geschrieben und somit geprägt von deren Gedankengut, Ansichten und Kultur. Hinzu kommt, dass Cäsar dem Senat Bericht erstatten musste, um neue Gelder für seine Feldzüge zu bekommen. Dass die Berichte entsprechend ausgeführt wurden, liegt auf der Hand.
Zu meinen Youtube-Vorträgen habe ich auch Kommentare bekommen, dass Aussagen von Feinden (Römern) doch nicht glaubhaft sein können. Dazu ist zu sagen, dass nicht nur Cäsar bemüht war, diese Kulturen akribisch zu erfassen, sondern auch andere römische, aber auch griechische Gelehrte und Reisende. Es ist ihnen nicht darum gegangen, ein Volk zu denunzieren, sondern es zu dokumentieren. Die Römer haben auch nicht versucht, die Kultur zu zerstören (im Gegensatz zu den Christen), sondern sie einzuordnen. Abgesehen davon, waren die Römer nicht nur Feinde, sondern auch Kooperationspartner, vor allem der Kelten.
Die andere Quelle sind Gräber. Ausgrabungen geben wertvolle Hinweise über hierarchische Strukturen und kunsthandwerkliche Epochen. Allerdings sind es vorwiegend Fürstengräber, die man entdeckt und ausgewertet hat. Genau wie im alten Ägypten sagt das wenig über das gemeine Volk aus.
DIE KELTEN
„Die Kelten – fern im Norden jenseits der Gebirge und Wälder hausten sie, karg waren ihre Hütten und ihr ganzes Leben, nackt und kampfwütig traten sie dem Feind entgegen, Todesfurcht kannten weder ihre Männer noch Frauen, Kopfjäger waren sie, und die Krieger suchten untereinander ihre sexuelle Lust zu befriedigen, doch Kindern glichen sie in der Gier nach Essen und Trinken, in der emmungslosen Prahlerei.”
Für die Griechen, aber auch für die Römer waren sie Unzivilisierte und Barbaren. Antike Gelehrte aus Rom und Athen schildern die Kelten in ihren Werken auf diese Weise.
Es gab eine Gemeinschaft – bestehend aus einer Vielzahl von Stämmen, mit einer gemeinsamen Sprache, gemeinsamen kulturellen Bräuchen und einem spirituell-religiösen Verständnis der Welt –, die sich als Kelten (von griechischen und römischen Geschichtsschreibern „Keltoi” genannt) bezeichnete. Allerdings waren sie nie ein geeintes Volk. Es gelang ihnen nicht, sich zu größeren Gruppierungen zusammenzuschließen und dergestalt militärisch stark zu werden, was letztlich auch zu ihrem Untergang führte. In ihrem Beharren auf das Stammesdenken blieben sie konservativ und den Traditionen treu. Andererseits waren sie sehr innovativ und Neuheiten gegenüber offen, sodass wir sogar heute noch darüber staunen können.
Kulturperioden
Vor allem in den Gräbern wurden Kunstgegenstände gefunden, nach denen bestimmte Epochen benannt sind.
Hallstatt-Zeit
wird die keltische Kulturperiode ca. 1000 – 450 v. Chr. genannt. Typisch sind einfache geometrische Verzierungen und plastische figürliche Motive, etwa von Tieren. In Hallstatt (Hallstätter See im Salzburger Land) führten Salz und Eisen zu einem bemerkenswerten Reichtum der heimischen Häuptlingsschicht.
La-Tène-Zeit
ist die keltische Kulturperiode ca. 450 – 15 v. Chr. Sie ist die Blütezeit der keltischen Kultur. Typisch sind sehr filigrane, verzierte, mannigfaltige Schmuck- und Alltagsverzierungen.
Fundorte
Da die Häuser der Kelten aus Holz waren, ist nicht mehr viel davon übrig. Vermutlich liegen im Erdreich Europas noch viele unentdeckte Keltensiedlungen verborgen. Das Problem ist vielerorts, dass alte Siedlungen von neuen überbaut wurden. Gefunden wurden metallene Gegenstände, Glas, Schmuck, keramische Fragmente. Des Weiteren Tierknochen und Pflanzenreste, die einen interessanten Einblick in die Ernährung der Kelten geben. Diese bestand hauptsächlich aus Getreide, Hülsenfrüchten und Gemüse wie Löwenzahn, Zwiebeln, Brennnesseln, Sellerie und Kohl.
Eine der ältesten Siedlungen wurde bei Oberleiserberg, 50 km nördlich von Wien ausgegraben. Die Besiedlung dort begann etwa seit der Jungsteinzeit, ab 4500 v. Chr.
Keltendorf bei Ötzenhausen
In Hochdorf (Nähe Stuttgart) fand man bei Ausgrabungen eines Fürsten-Grabhügels um 550 v. Chr. wichtige Kult-Gegenstände.
Bronzegefäß mit Löwenfigur und Trinkhorn, Keltenmuseum Hochdorf
Der Schwerpunkt ihrer Siedlungen lag im heutigen Süddeutschland, Ostfrankreich und der Schweiz. Es gibt Ausgrabungen von Ansiedlungen, wie zum Beispiel in Manching bei Ingolstadt (eine mächtige Keltenstadt, größter Goldfund aus der Keltenzeit) oder Heuneburg an der Donau in Baden-Württemberg. Dort war eine der ältesten und größten Siedlungen der Kelten. Eine Ansiedlung, die sich über 100 Hektar erstreckte und vermutlich bis zu 5000 Menschen beherbergte, die hier lebten und arbeiteten.
Goldener Wagen und andere Grabbeigaben, Landesmuseum Württemberg
Überlieferungen
Vieles, was heute im wiedererwachten Bedürfnis, sich einer alten Kultur zuzuordnen, verbreitet wird, ist schlichtweg erfunden oder wurde aus dubiosen Quellen gespeist. Doch gibt es auch Überlieferungen, die sich auf die alte Zeit zurückführen lassen. Mündlich weitergegebenes Wissen muss man natürlich relativieren, da es sich sicherlich im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Vieles sind Mythen, Sagen und Geschichten, die Hinweise, aber keine gesicherten Quellen sein können. Es sind Völker am Rande von Europa, die solches bewahrt haben, die Iren, Schotten, Waliser und Bretonen. Ohne sie wüssten wir nichts von den zahlreichen Göttern und Heldenkriegern der keltischen Welt. In dem niemals von Rom besetzten Irland haben sich die meisten Überlieferungen erhalten und weiterentwickelt.
Außerdem wurden in den Klöstern zunehmend Erzählungen auf Pergament niedergeschrieben und so vor dem Vergessen bewahrt, darunter vor allem die Götter- und Heldensagen, die das vorchristliche Irland mit seiner keltischen Kultur widerspiegeln. Was fromme Mönche und andere im Mittelalter aufgeschrieben haben, ist vielfach zensiert und von offensichtlich Heidnischem gesäubert worden. Trotzdem haben diese Handschriften einen wertvollen Schatz keltischer Dichtungen bewahrt, von denen manche ein hohes Alter aufweisen.
Die Gebrüder Grimm und ihr 1825 erschienenes Buch „Irische Elfenmärchen” haben einiges dazu beigetragen, dass Geschichten über Elfen und Geister bis in die heutige Zeit bekannt und populär sind. Sie waren inspiriert vom irischen Gelehrten Thomas C. Crocker der die „Fairy Legends” geschrieben hat.
Viele Motive und Stoffe, die sich so größer Beliebtheit erfreuen, gehen jedoch auch auf ein anderes Werk zurück. Der Schotte James Macpherson (1736-1796), ein Dorf- und Hauslehrer, hatte im 18. Jahrhundert einige längere Gedichte veröffentlicht, die er, wie er sagt, in den Highlands gesammelt und aus dem Gälischen ins Englische übersetzt hat. Angeblich sollten sie auf das Werk eines keltischen Barden aus der Zeit um 300 n.
Chr. zurückgehen. Im Jahre 1765 erschienen sämtliche dieser „Works of Ossian”, Gedichte des alten gälischen Barden Ossian. Es wurde ein Bestseller. Allerdings hat sich im Laufe der Jahrzehnte herausgestellt, dass es sich mitnichten um originale Lieder aus dem 3. Jahrhundert handelt, vielmehr wurden sie – mit Rückgriff auf irische Heldengestalten – frei nachgedichtet,. Das hat aber der Beliebtheit der Gedichte keinen Abbruch getan. Viele der heutigen Erzählungen finden ihren Ursprung in den Works of Ossian. Im Zeitalter der Romantik erfreuten sich vor allem historische Romane wie die von Sir Walter Scotts („Ivanhoe”, „The Lady of the Lake”, „Rob Roy”) wachsender Beliebtheit.
Später kamen dann die Geschichte von König Arthur und andere Heldengeschichten und Sagen hinzu, die sich auf die inselkeltischen Mythen stützen. Einen Niederschlag findet sich sogar in „Alice im Wunderland” von Lewis Carroll, der aus keltischer Tradition schöpft. Von „Die Nebel von Avalon” bis zu „Der Herr der Ringe” finden sich noch zahlreiche literarische Werke, die der alten Kultur huldigen.
Man muss also vorsichtig sein mit Aussagen zu alten Gebräuchen und Sitten, Ritualen und Weisheiten, denn manches ist vielleicht gar nicht so alt, kann aber trotzdem für uns eine Inspiration sein.
Sprache
Um 2000 v. Chr. kamen die ersten Indogermanen aus dem Osten nach Europa. Sie wurden nach ihrer Keramik auch „Schnurkeramiker” oder nach den Grabbeigaben „Streitaxtleute” genannt. Aus ihrer gemeinsamen Sprache entwickelten sich im Laufe der Jahrtausende fast alle europäischen Sprachen: Griechisch, Lateinisch (mit den Tochtersprachen Italienisch, Französisch), die germanischen Sprachen (Deutsch, Englisch, Niederländisch), die meisten skandinavischen Idiome, die slawischen Sprachen, von Tschechisch bis Russisch, und schließlich auch die keltischen Sprachen.
Festlandkeltisch ist um 500 n. Chr. ausgestorben, da keine schriftlichen Aufzeichnungen erhalten geblieben sind. Inselkeltisch hat sich im Irischen, Bretonischen, Gälischen und Schottischen erhalten.
In der heutigen Sprache gibt es einige keltische Begriffe. Beispielsweise „Amt,” in dem sich das keltische Wort „ambaktos” (Gefolgsmann) verbirgt und das im englischen „embassy” und im französischen „ambassade” (Botschaft – diplomatische Vertretung) zu erkennen ist. Auch das Wort „Eisen” ist auf das keltische Wort „isaro” zurückzuführen. Das zeugt von der meisterlichen Beherrschung der Eisenherstellung der Kelten. Sogar das vermeintlich neuzeitliche Wort „Slogan”, in der Werbung für „Schlagwort” verwendet, kommt ursprünglich aus dem Keltischen und bedeutet „Kriegsruf” – wie passend.
Es gibt noch eine Vielzahl anderer Wörter, Siedlungsnamen und geografische Bezeichnungen, die keltischen Ursprungs sind.
Verbreitungsgebiete
Die Kelten prägten mit ihrer Kultur die meisten Gebiete nördlich der Alpen. Im 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. begaben sich vor allem die Krieger auf Wanderschaft. 387 v. Chr. verwüsteten sie Rom und 279 v. Chr. standen sie vor dem griechischen Heiligtum von Delphi. Das waren die Höhepunkte ihrer Macht und territorialen Ausbreitung. Bis 100 v. Chr. errangen die Kelten viele Siege über die Römer. Danach wurden sie mehr und mehr von griechischen und römischen Soldaten zurückgedrängt. Die fortgeschrittene Zivilisation, namentlich der Straßenbau, wurde ihnen zum Verhängnis, da die Feinde auf diese Weise schnell vordringen konnten. Außerdem waren die Stämme oft untereinander uneins und zerstritten. Manche paktierten sogar mit den Römern, haben sich als Kundschafter anwerben lassen und verrieten ihre Landsleute, um Privilegien zu bekommen.
Schließlich bedeutete die gallische Niederlage von Alesia 52 v. Chr. das Ende der Unabhängigkeit der Kelten auf dem europäischen Festland. Nur die britischen Inseln konnten ihre Freiheit bewahren. Sie wurden aber auch dort nach und nach in entlegene Randgebiete abgedrängt. Vor allem Schottland blieb sich selbst überlassen und wurde durch den 120 km langen Hadrianswall abgeriegelt. Das war ein römisches Grenzbefestigungssystem, das nahe der heutigen Grenze zwischen Schottland und England angelegt worden war. Er wurde zwischen 122 und 128 n. Chr. auf Anordnung Kaiser Hadrians (76–138) erbaut. Nach heute vorherrschender Sicht diente er nicht der Abwehr von Invasionen, sondern sollte in erster Linie den Handels- und Personenverkehr überwachen und an den dafür vorgesehenen Grenzübergängen kanalisieren, um dort u. a. die Erhebung von Zöllen zu ermöglichen. Des Weiteren sollte er kleinere Überfälle sowie die unkontrollierte Migration schottischer und irischer Stämme in die südlichen Gebiete verhindern. In ihrem östlichen Teil bestand die Anlage aus einer bis zu 4,5 Meter hohen Steinmauer, im westlichen Teil zunächst nur aus einem Erdwall. Zu ihrer Absicherung wurden ein Grabensystem sowie Türme und Kastelle errichtet.
England und Wales wurden römische Provinz. Als sich Rom später von den Britischen Inseln zurückziehen musste (410 n. Chr.), erlebten die keltischen Traditionen allerdings eine Renaissance. Ebenso griff man auf vorrömische Wirtschaftsformen zurück. Man gab die Geldwirtschaft wieder auf und betrieb stattdessen den traditionellen Tauschhandel. Wie in Irland zählten von da an wieder Rinder und Sklaven als Werteinheit.
Um sich gegen die einfallenden Pikten (römischer Name für Völker in Schottland) und Skoten (Schotten) zu erwehren, rief man die germanischen Angelsachsen (Land der Angeln – England) ins Land. Diese bestimmten von da an die Geschicke im Land und lieferten mit ihren germanischen Dialekten die Grundlage des Englischen.
Die keltischen Britannier wurden dagegen zu Fremden im eigenen Land, was die ursprüngliche Bedeutung von Wales ausdrückt („Land der Fremden”). Sie zogen sich in die westlichen Randgebiete zurück, nach Wales und Cornwall, wo die keltische Sprache und Kultur erhalten geblieben sind.
Irland wurde nie Teil des Imperium Romanum. Wie in Britannien ist auch hier ungewiss, auf welche Weise die Iren zu Kelten wurden – durch Einwanderung oder durch Übernahme der keltischen Kultur und Sprache. Jedenfalls blieben sie von fremden Eroberern bis ins frühe Mittelalter verschont, als die skandinavischen Wikinger ihre Küsten angriffen. Dies hatte Konsequenzen, die Irland heute zum keltischen Land schlechthin machen.
Erst christliche Missionare sorgten im 5. Jahrhundert für eine deutliche Zäsur, ohne dass nur ein einziger Missionar den Märtyrertod erlitt. An der Spitze stand der Heilige Patrick, der sich auch noch heute großer Beliebtheit erfreut. In Irland rotteten die Mönche das keltische Heidentum nicht mit Stumpf und Stiel aus, sondern übernahmen wichtige traditionelle Vorstellungen in die neue Religion. Damit bewahrte man bei allen zeitbedingten Veränderungen eine Vielzahl keltischer Relikte, für die die irische Kultur berühmt ist.
Im frühen Mittelalter konnten sich also – außer den Bretonen der Bretagne – nur noch die Kelten auf den Britischen Inseln ihre Selbstständigkeit bewahren: in Cornwall, Wales, Schottland, auf der Insel Man und in Irland. Ohne sie wüsste man nichts von den zahlreichen Mythen und Sagen, von den Göttern und Heldenkriegern der keltischen Welt, in denen auch der Arthur-Stoff seine Wurzeln hat.
Kultur und Kunst
Von 600 v. Chr. bis Christi Geburt waren die Kelten einerseits Barbaren, aber auch auf dem Weg, sich von einer Randkultur zu einer Hochkultur zu entwickeln, die sie jedoch nie erreichten. Nicht in dem Sinne wie zum Beispiel Ägypten, Mesopotamien oder Rom, da sie weder Steinarchitektur noch monumentale Anlagen, geschweige denn Städte als Zentren von Staaten hatten. Erst in den letzten beiden Jahrhunderten v. Chr. kamen stadtähnliche Zentren, sogenannte „Oppida”, auf. Ihre Basis ist aber bäuerlich. Im Gegensatz zu den unterentwickelten Nachbarn, den Germanen, war sie eine reiche Zivilisation mit beneidenswerten Lebensbedingungen. Sie hatte einen eigenen Kunst-Stil, der sich sehr deutlich vom griechischen und vom römischen unterschied. Naturalistische Wiedergaben der Wirklichkeit hatten keine Bedeutung. Einmalige Ornamentik, abstrakte und fremdartige Pflanzenmotive, eine Vielzahl von seltsamen Fabelwesen, fantastische Tiere und fratzenhafte Dämonen, verschlungen im labyrinthischen Chaos der Ornamente, kennzeichnen die keltische Kunst und deren Reichtum. Tiere mit Menschenköpfen, unbestimmbare Wesen und Tierkreuzungen verschiedener Arten zieren Gefäße, Gebrauchsgegenstände, Grabbeigaben und Waffen.
Hybrides Fabelwesen, Schmuckspange, Silberarmreif, Goldhelm, Röhrenkann
Eisen
Die Kelten galten weithin als die Meister des Eisens, mit dessen Beherrschung ihre Kultur identifiziert wurde. Deshalb fasst man die Hallstatt- und La-Tène-Zeit des letzten vorchristlichen Jahrtausends unter dem Begriff der Eisenzeit zusammen.
Das Eisen trug entscheidend zur Ausbreitung der keltischen Kultur bei, denn die Schwerter waren härter und die Pflugscharen rissen den Ackerboden tiefer auf.
Keltische Schmiede und Kunsthandwerker zeigten ein solches Geschick, dass ihre Produkte manche Arbeiten der antiken Hochkulturen in den Schatten stellten. Die Kunst ihrer einmaligen Ornamentik zeichnet sie noch heute aus, wohingegen weniger bekannt ist, dass die Kelten die Fibel, die Gewandspange und Vorläuferin der Sicherheitsnadel, anstelle der Nadel populär machten.
Häuptlinge
Die Gemeinschaft war hierarchisch geordnet. An der Spitze standen Fürsten, Könige, Häuptlinge und oberste Beamte. In früheren Zeiten wurden alljährlich durch die Dorfgemeinschaft die Häuptlinge gewählt. Heerführer wurden ebenfalls vom Volk erkoren. Ansonsten handelte es sich um eine bäuerliche Lebensart.
Das Ansehen eines Stammesführers wurde von der Anzahl der Krieger, die er beherbergte und verköstigte, und die Anzahl der Sklaven, die er besaß, bestimmt.
Druiden
Eine mächtige, tonangebende Gruppe beherrschte große Teile des Stammeslebens – die „Druiden”. Cäsar berichtet von ihnen als von einer Gesellschaft hochgeehrter Philosophen, Theologen, Männer und Frauen der Weisheit, Rechtsgelehrte, Zauberinnen und Zauberer, Priesterinnen, Erzieher von Fürstensöhnen. Sie wussten um die Geheimnisse der Gottheiten und verstanden deren Sprache. Das Wort Druiden bedeutet in der Übersetzung „Eichenkundige”. Ob alle Keltenstämme derart druidische Universalgelehrte kannten, ist genauso ungewiss wie ihre Herkunft und das erstmalige Auftreten. Es gibt keine archäologischen Spuren, die mit absoluter Gewissheit auf Druiden hinweisen. Die einzige Quelle sind die römischen Aufzeichnungen. Dass es auch Druidinnen gab, ist anzunehmen, jedoch historisch noch weniger belegt.
Sie entschieden in der Regel in allen staatlichen und privaten Streitfällen. Wenn ein Verbrechen (Mord) begangen worden war, wenn der Streit um Erbschaften oder um den Verlauf einer Grenze ging, fällten sie ein Urteil, setzten Belohnungen und Strafen fest. Hielt sich ein Privatmensch oder das Volk nicht an ihre Entscheidung, untersagten sie die Teilnahme an den Opfern. Diese Strafe galt als die schwerste, denn jene, denen die Teilnahme untersagt war, galten als Frevler und Verbrecher, alle gingen ihnen aus dem Weg und mieden den Umgang und das Gespräch mit ihnen, damit sie nicht durch ihre Berührung Schaden erlitten.
Angeblich stand ein Oberster an der Spitze aller gallischen Druiden, die sich einmal im Jahr an einem geweihten Ort im Land der Karnuten trafen, um Streitfälle zu schlichten und Urteile zu fällen.
Ihre Lehrzeit dauerte 20 Jahre, in denen alles auswendig gelernt werden musste. Sie kannten Schrift im öffentlichen und privaten Bereich und benutzten dazu die griechischen Zeichen. In religiösen und poetischen Bereichen verzichteten sie jedoch darauf. Das Druidentum wurde unter Kaiser Claudius 54 n. Chr. verboten.
Manches deutet darauf hin, dass in den letzten Jahrhunderten römischer Herrschaft die druidische Tradition eine Wiedergeburt erlebte. Erst das Vordringen der germanischen Franken und die erstarkende christliche Religion scheinen all dem ein endgültiges Ende bereitet zu haben. Manche Mönche dürften bekehrte Druiden gewesen sein.





























