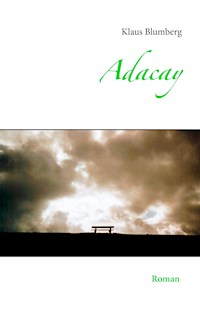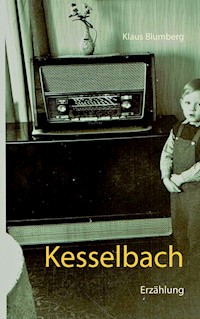
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Simon trauert um seinen Jugendfreund Gerhard Kesselbach, der ein Jedermann war. Nicht mehr und nicht weniger. Der Sound ist die Musik der siebziger Jahre, denn Kesselbach war zeitweilig ein Schallplattenaufleger. Ein Discjockey. Nicht zuletzt ist Kesselbach eine Erzählung über das unbarmherzige Vergehen des Lebens. Jeder Mensch möchte wissen, wohin er geht. Die Vorstellung von einem Nichts ängstigt, deshalb halten wir uns lange Zeit für unsterblich. Die Erkenntnis, dass wir es nicht sind, ist schwer zu ertragen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich widme diese Erzählung Lene Marie, Isabella und Jannes Paul
Lektorat: Vielen Dank an Martin Schröder
In Erinnerung an einen alten Freund 1952–2016
Die Handlung dieser Erzählung sowie die darin vorkommenden Personen sind frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten mit realen Begebenheiten und tatsächlich lebenden oder bereits verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
1
Ich hatte nicht mit einem Anruf gerechnet. Zuerst glaubte ich, mit ihm selbst, mit Gerhard, verbunden zu sein, weil die Stimme seines Bruders so identisch klang, zum Verwechseln ähnlich, und ich eröffnete das Gespräch sogleich mit einem Lachen, das meine Freude ausdrückte, endlich mal wieder von meinem alten Freund aus Jugendtagen zu hören.
Die Stimme am anderen Ende der Leitung bat um Entschuldigung. Er sei nicht der besagte Freund, sondern sein Bruder. Gerhard selbst könne nicht mehr anrufen, er sei verstorben, bereits im Juli dieses Jahres. Aber – und das täte ihm leid – erst jetzt sei man dazu gekommen, innerhalb der Familie den Nachlass zu sichten und dabei habe man meine Adresse gefunden, und er selbst, der jüngere Bruder, könne sich auch noch ganz dunkel an mich erinnern. Schade, dass man sich aus diesem traurigen Anlass nun wieder einmal höre. Ich fragte zwischendurch, nachdem ich ihm mein Beileid ausgesprochen hatte, was denn im Einzelnen geschehen sei und er erzählte mir mit einem Räuspern in der Stimme die ganze, traurige Geschichte.
Man habe Gerhard – obwohl er in Süddeutschland lebte – in Ratzeburg, auf einer Bank sitzend, gefunden. Genauer, auf einer Bank unterhalb des Königsdamms an der Bundestraße 208, die von Bad Oldesloe nach Gadebusch führt, mit Blick über den See, zum Dom hin. Einem anderen Spaziergänger sei dieser leblose Mann aufgefallen, und er habe sofort die Polizei bzw. den Rettungswagen verständigt, obwohl – das war zu sehen – offensichtlich jede Hilfe zu spät kam. Zum Glück hatte der Unglückselige Ausweispapiere bei sich, und so konnte die Familie in kürzester Zeit informiert werden. Merkwürdig sei gewesen, dass Gerhard über 150 Euro Bargeld in der Tasche hatte. Das entsprach sonst nicht seinem Naturell. Er sei meist eher klamm gewesen.
Ohje, bemerkte ich, ohne seinen Redestrom zu unterbrechen, hörte aber nicht mehr aufmerksam zu. Ich war erschüttert, dass er nicht einmal drei Kilometer von meinem Zuhause entfernt gefunden worden war. Seinem Bruder war das nicht aufgefallen, weil er mich über meine Handynummer erreicht hatte. Mir wurde sofort klar, dass Gerhard auf dem Weg zu mir war und eben auf diesem Weg vom Tod überrascht wurde.
Der alte Pechvogel.
Sofort fiel mir unser letztes Telefongespräch wieder ein, das wir vor ungefähr einem Jahr geführt hatten.
Ich wolle nicht unhöflich sein, unterbrach ich den Bruder, aber diese ganzen tragischen Informationen müsse ich erst einmal verarbeiten. Ich sei am Ende meiner Konzentrationsfähigkeit. Wir könnten ja, da er im Besitz meiner Telefonnummer sei, unser Gespräch jederzeit fortsetzen. Erinnerungen austauschen – später, wenn ein wenig Zeit vergangen ist.
Es gebe kein Grab, Gerhard habe sich eine Seebestattung gewünscht, sagte sein Bruder abschließend und legte auf.
Ich setzte mich in meinen Ohrensessel, der unweit des Fensters in meinem Wohnzimmer stand, und sah hinaus. Die Bäume vor dem Fenster wiegten sich im Wind und verstreuten ihre gelben Blätter über die Wiese. Farbtupfer auf dem grünen Gras.
Gerhards Anruf vom letzten Jahr!
Ich hatte einige Jahre nichts von ihm gehört, und nun rief er mich an und bat mich unverhohlen um Geld. Ich lachte laut, weil es etwas war, das ich von ihm kannte. Eine gewisse Unverfrorenheit war Teil seines Charakters. Er redete nicht lange darum herum. ,Keine Umschweife' war seine Devise. Es gehe im finanziell nicht besonders gut, was noch geprahlt sei, und nun müsse er sein Fahrzeug durch den TÜV bringen. Von allen möglichen Leuten, Freunden, seiner Familie habe er schon einen Korb erhalten und nun...Ich sei gewissermaßen seine letzte Hoffnung. Der Strohhalm, der ihn vor dem Ertrinken bewahren konnte.
Ich dachte einen Moment nach und sagte ihm das Geld zu. Ich kannte seine Geschichte, das heißt, ich kannte einen Teil seiner Geschichte und – ich sage es frei heraus – er tat mir leid. Er war die meiste Zeit seines Lebens ein Pechvogel gewesen, während ich sehr oft von der Sonne gestreichelt wurde. Zwei ungleiche Freunde waren wir. Ja, das wurde mir während unseres Gespräches wieder bewusst.
Einen Tag später tätigte ich die Überweisung auf sein Konto. Eine Woche später schickte er mir eine überschwängliche SMS. Es sei alles in Ordnung. Sein Fahrzeug könne jetzt repariert werden und er sei mir für meine Hilfe unendlich dankbar. Geantwortet habe ich ihm nicht mehr, auch als einige Zeit später noch einmal eine Dankes-SMS von ihm kam. Er dachte wohl, ich wolle nichts mehr mit ihm zu tun haben, nachdem er so unverfroren gewesen war, nach einer so langen Zeit der Stille zwischen uns.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass er mir das Geld zurückgeben wollte. Um ehrlich zu sein, ich hätte nicht im Traum daran gedacht. Dazu glaubte ich, ihn zu gut zu kennen. Dass es nicht so war, trieb mir nun die Tränen in die Augen.
Ich sah ihn dort auf dieser Bank sitzen, nachdem er zu Fuß unterwegs gewesen war, mit Blick auf den Ratzeburger Dom, keine drei Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Er war sicherlich stolz, mir das geliehene Geld zurückgeben zu können. Noch ein wenig die Straße entlang, ein Stück den Berg hinauf, und er hätte es geschafft.
2
Nachdem ich am Vormittag im Steingarten einige Rosen geschnitten und dabei ständig an den Freund gedacht habe, bleibt mir im weiteren Tagesverlauf nichts anderes zu tun, als mich auf den Weg zu machen. Ich gehe den schmalen asphaltierten Weg, die Anhöhe hinauf, zur Straße hin, halte einen Moment an um zu verschnaufen, überquere die Fahrbahn und befinde mich auf dem Verbindungsweg, der zu dem kleinen Waldstück führt und die beiden Ortsteile verbindet.
Spätestens hier hätte Gerhard sich geweigert, weiterzugehen. In seinen vierziger Jahren hatte er erstaunlich an Gewicht zugelegt und dieses Gewicht lag auf seinen Knochen wie Blei. Nach zehn Minuten Fußweg begann er, nach Luft zu ringen, was ihn nicht davon abhielt, mich mit allerlei Flüchen zu belegen. Er blieb stehen wie ein störrischer Esel, wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn und stellte schließlich die kindliche Frage, wie weit wir denn noch gehen müssten, um unser Ziel zu erreichen. Passte ihm die Antwort nicht, fixierte er den nächsten Baumstumpf oder eine andere passende Sitzgelegenheit und setzte sich. Ich könne ihn ja bei Gelegenheit auf dem Rückweg an dieser Stelle wieder abholen. Die Beine waren wie eine Schere geöffnet, sein gewaltiger Bauch in dem Zwischenraum abgelegt – wie ein Buddha bei der Meditation. Er begegnete meinem fragenden Blick, indem er sogleich erwähnte, dass er schon immer so gewesen sei, selbst in unserer Jugend habe es diese eklatanten Unterschiede zwischen uns gegeben. Aber sie seien nicht aufgefallen, sondern von anderen Aktivitäten kompensiert worden.
Ich erinnerte mich an einen Tag in der Schwimmhalle in Stuttgart-West. Gerhard war er guter Schwimmer und er hatte immer den Ehrgeiz, der Schnellste zu sein, gewinnen zu wollen. Kraftvoll zog er seine Bahnen und ich hatte beachtliche Mühe, mit ihm mitzuhalten. Allerdings bereitete es mir auch keinerlei Kopfzerbrechen, als Zweiter ins Ziel zu gelangen und manchmal ließ ich ihn sogar absichtlich gewinnen, weil ich wusste, wie wichtig es ihm war. Mit Achtzehn war er ein stämmiger aber durchtrainierter Zeitgenosse und seine Stärke trug er wie ein Schild vor sich her.
Ich wusste, dass es nicht leicht für ihn war. Er kam aus einem kleinen bayrischen Dorf, wie unsere Mitschüler neckisch bemerkten. Sein Vater war ein amerikanischer Soldat, der sich aus dem Staub gemacht hatte, als seine Dienstzeit abgelaufen war. Aber seine Mutter hatte wieder geheiratet, trotz des Makels, eine ledige Frau mit Kind zu sein, was für diese Zeit nicht selbstverständlich war.
Sie verließ die kleine niederbayrische Ortschaft und zog mit ihrem Mann und ihrem halbwüchsigen Sohn nach Stuttgart. Dort bekam Gerhard noch zwei Halbgeschwister: einen Bruder und eine Schwester. Aber er war sich nie sicher, zur Familie zu gehören, glaube ich.
Direkt konnte er nicht darüber sprechen. Es waren eher Äußerungen, die diesen Schluss nahelegten. Bemerkungen, an der richtigen Stelle platziert, ein Nicht-ernst-genommenwerden.
Es ist Herbst. Die Bäume haben bereits ihre Blätter abgeschüttelt. Sie bilden einen Laubteppich auf dem sumpfigen Waldboden und das Gehen ist angenehm – auf dem vollgesogenen Blattwerk.
Jetzt passiere ich die Stelle, wo die umgestürzte Birke den Weg versperrt Den Waldarbeitern ist es noch nicht gelungen, den langen Baum zu beseitigen. Sein breites Wurzelwerk ragt wie ein erstarrtes, überdimensionales Spinnennetz über den verrottenden Stamm hinweg.
Ich suche nach einem Ausweg, nach einem Pfad; finde ihn seitlich zwischen zwei Bäumen und gelange auf den Hauptweg, zu der Siedlung mit den Einfamilienhäusern. Gepflegte Vorgärten, sauber gestaltete Treppenaufgänge, verzierte Fensterbänke. Ein Idyll.
Ein Lebensentwurf, der jenseits von Gerhard Kesselbachs Lebenswelt lag. Niemals hätte ich ihn mir in so einem Haus vorstellen können, mit Frau und Kindern, mit Familie. Für ihn war ein anderer Lebensweg geplant. Ob gewollt oder nicht gekonnt, vermag ich nicht zu sagen. So gut habe ich ihn dann doch nicht gekannt.
Ich folge dem Weg zwischen den Gärten entlang, erreiche die Vorstadt und komme über die abschüssige Sedanstraße zu dem Parkplatz vor der Eisdiele. Von dort ist es nicht mehr weit bis zu der Bank, wo man ihn fand. Das kleine U-Boot-Modell treibt vertäut auf dem Wasser. Kein Nebel trübt die Sicht auf den Ratzeburger Dom. Ich setze mich. Das Wissen um die Existenz des Lebens setzt auch das Wissen um die
Nichtexistenz voraus. Das macht die Sache so schwierig, so kompliziert. Man möchte immer wissen, wohin man geht. Die Vorstellung von einem Nichts ängstigt, deshalb halten wir uns alle für unsterblich – manchmal. Die Erkenntnis, dass es nicht so ist, ist schwer auszuhalten.
3
Ich habe seine Briefe aufbewahrt. Sie stammen allesamt aus einer Zeit, in der man sich noch Briefe schrieb.
Es gibt einen Raum in unserem Haus, einen Kellerraum, in dem ich derartige Dinge aufbewahre. Briefe und Tagebücher aus der damaligen Zeit Alles ist dem Wunsch geschuldet, etwas zu bewahren. Nicht zu vergessen!
Die damalige Zeit übte auf Gerhard Kesselbach eine besondere Faszination aus. Es war – und das meinte er im Ernst – die Zeit, in der er gedanklich lebte, in der er für den Rest seines Lebens verweilen wollte.
Es ist ein Phänomen wie bei den Weltkriegsveteranen, die wir in unserer Jugend noch zahlreich kennengelernt haben. Immer wieder erzählten sie ihre Erlebnisse, als wären sie jahrelang auf einem Abenteuerspielplatz gewesen, als hätten sich die archaischen Erlebnisse des Krieges in ihr Bewusstsein gebrannt, und alles, was danach kam, in Gleichförmigkeit und Langeweile erstickt.
Genauso war es bei Gerhard. Wie ein Derwisch, der sich in Ektase tanzt, sprang erzwischen seinen riesigen Lautsprechertürmen umher und präsentierte Schallplatten aus einer Ära, die längst vergangen war:
„Bad Moon Rising", „Satisfaction".
Weißt du noch?
Dann vollführte er seine Tanzbewegungen, die Fruchtbarkeitstänzen ähnelten.
Warum, so fragte ich mich damals, war er nicht in der Lage, sich weiterzuentwickeln? Ich selbst hatte irgendwann die Zeit der Hitparadennotierungen verlassen, spezielle Stile, Musikrichtungen und Künstler bevorzugt. Gerhard hatte für diese Absonderlichkeiten, wie er es nannte, kein Ohr, kein Verständnis. Ich glaube, im Grunde mochte er Musik nicht. Sie diente ihm lediglich als Vehikel, mit dem er in seine Vergangenheit, in seine Jugend reisen konnte. Immer und immer wieder.
Szenenwechsel: 1986
Wir saßen uns gegenüber: Zwei Männer mittleren Alters, die Bier und Whiskey tranken, wobei er den amerikanischen Bourbon bevorzugte, mit reichlich Cola, und ich mich an unverdünntem Scotch festhielt.
Irgendwann gestand er, dass etwas schiefgelaufen sei in seinem Leben. Dass nichts wieder so intensiv gewesen wäre wie unsere Jugend.
Erinnerungsfetzen:
Wir fuhren mit unseren Freundinnen Mona und Uschi in Gerhards beigefarbenen VW Käfer ins Mohnbachtal. Er war stolz auf seine hübsche Freundin Uschi. Ich sah seine Augen im Rückspiegel, seinen nach Anerkennung heischenden Blick. Ich reagierte nicht, sondern wand stattdessen den Kopf zu meiner Freundin Mona und küsste sie.
Auf einer Lichtung sammelten wir Holz für ein Lagerfeuer. Aus dünnen Zweigen schnitzten wir spitze Stöcke, auf die wir Würstchen steckten. Die hielten wir ins Feuer und erzählten uns Geschichten aus unserem noch jungen Leben. Es war Frühling. Frühling 1973.
Irgendwann fingen Gerhard und ich an zu raufen, wälzten uns auf dem weichen Nadelboden, während unser Lagerfeuer noch glimmte und unsere Freundinnen sich gelangweilt und verständnislos anschauten.
Ich stehe am Fenster und schaue auf das vom Regen durchtränkte Laub. Er ist Herbst. Ein Herbst, in dem es immerfort regnet, als betrauere der Himmel die Toten des vergangenen Sommers.
Gerhard wollte immer beweisen, wie stark er war. Der muskulöse Kerl hatte mich irgendwann immer am Boden; setzte sich demonstrativ, mit erhobenem Arm und geballter Faust, seiner Siegerpose, auf meine Oberarme und nahm mir damit die Möglichkeit einer Gegenwehr.
Erinnerungssplitter: 1973
Mona, meine Freundin, glaubte dass Gerhard ein Minderwertigkeitsproblem habe.
Wahrscheinlich wegen seiner roten Haare und den vielen Sommersprossen. Außerdem, meinte sie, sei er ein fragwürdiger Charakter. Wir lagen auf der Couch in meinem Jugendzimmer und hörten Cat Stevens Teaser and the Firecat. Mona mochte so gern das griechisch inspirierte „Rubylove".
Es war unmittelbar nach diesem Titel, als sie sich aus meiner Umarmung befreite, sich aufrichtete und mir erzählte, dass Gerhard sie angefasst hätte. Ja, dass er sogar noch mehr wollte, alles wollte. Es sei in der Zeit gewesen, als ich durch die Führerscheinprüfung gerasselt war, und aus lauter Frust unbedingt eine Auszeit brauchte.
Damals ließ ich mich von einem Freund auf einem Parkplatz auf der Schwäbischen Alb absetzen und ging von dort zu Fuß weiter. Ich verbrachte einige Tage auf einer Schlossruine, während Gerhard und die anderen nicht wussten, wohin ich verschwunden war.
Genau diese Situation nutzte Gerhard, um Mona zu besuchen und sich an sie heranzumachen. Wir waren bereits bei „Peace Train" als sie mir erzählte, dass er es keinesfalls geschickt angestellt hatte, sondern eher plump, so wie er insgesamt eben sei. Auf die Frage von Mona, warum er so etwas einem guten Freund antun wolle, entgegnete er mit einem unschuldigen Hundeblick. Man müsse mir ja nicht alles erzählen. Mit dem Motto ,Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß' ließe sich gut und sorgenfrei leben. Die Reaktion von Mona konnte ich mir gut vorstellen. Am Ende zog er ab wie ein geprügelter Hund.
4
Ich bin in meinem Kellerraum und sortiere die alten Tagebücher. Abgegriffene kleinformatige Bücher, einige mit schmierigem Ledereinband. In einem dieser Bücher sind Seiten rausgerissen. Das passt in diese Zeit. Die Zeit, in der Gerhard und ich uns nichts geschenkt haben, wie man so schön sagt