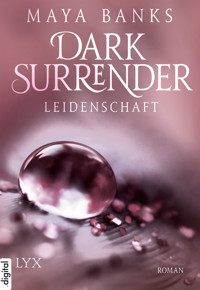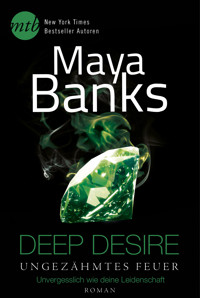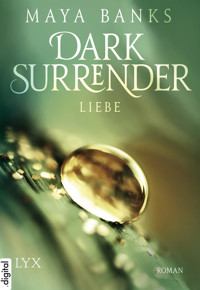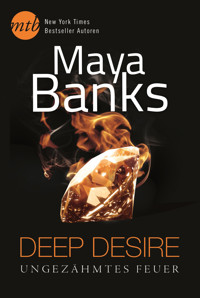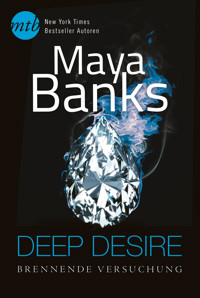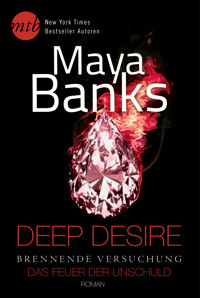9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: KGI-Reihe
- Sprache: Deutsch
Nach einem letzten Einsatz in Afghanistan will Nathan Kelly das Militär verlassen und sich dem KGI anschließen - dem Sicherheitsunternehmen seiner Brüder. Doch dann wird er gefangen genommen und grausamer Folter unterzogen. Das Einzige, was ihn am Leben erhält, ist die rätselhafte Stimme einer Frau, die er in seinem Kopf hört. Er ahnt nicht, dass Shea wirklich existiert und dass sie nichts unversucht lässt, um Nathan zu retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Danksagung
Die Autorin
Maya Banks bei LYX
Impressum
MAYA BANKS
Gefährliche
Hoffnung
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Katrin Mrugalla und Richard Betzenbichler
Zu diesem Buch
Nach einem letzten Einsatz in Afghanistan will Nathan Kelly das Militär verlassen und sich dem KGI anschließen – dem Sicherheitsunternehmen seiner Brüder, das von der Regierung für hoch brisante Aufträge angeheuert wird. Aber dann geht alles schief: Nathan wird gefangen genommen, verschleppt und wochenlang aufs Grausamste gefoltert. Schwer verletzt und halb verhungert ist er sich nicht sicher, wie lange er noch überleben kann. Doch als er kurz davor ist, die Hoffnung aufzugeben, hört er plötzlich die Stimme einer Frau. Wieder und wieder spricht sie zu ihm, fleht ihn an durchzuhalten, scheint sogar seine schlimmsten Schmerzen zu lindern. Nathan kann sich das Band, das ihn und die geheimnisvolle Shea verbindet, nicht erklären. Und obwohl er fürchtet, verrückt zu werden, gelingt es ihm, durch sie neue Kraft zu schöpfen – und vor seinen Peinigern zu fliehen. Zurück in den USA ist Nathan überzeugt, dass er sich das Ganze nur eingebildet hat. Die Retterin mit der telepathischen Gabe kann unmöglich wirklich existieren. Doch dann, sechs Monate später, empfängt er plötzlich einen Notruf von niemand anderem als Shea! Sie ist auf der Flucht vor einer Verbrecherbande, die es auf ihre Fähigkeiten abgesehen hat. Nathan zögert keine Sekunde, der Frau zu Hilfe zu kommen, die ihm in seiner schlimmsten Stunde selbstlos zur Seite stand …
Für Telisa,die schon ein Fan der KGI-Serie war,bevor sie wusste, dass ich sie schrieb
1
Shea Petersons Augen flogen auf, und sie war sofort hellwach. Im gleichen Moment war auch der unerträgliche Schmerz wieder da, und sie stöhnte leise bei jedem Atemzug. Sie krallte die Finger in die zerwühlten Laken. Ihr ganzer Körper stand unter Hochspannung.
Da hörte sie ihn wieder. Seine Verzweiflung schwappte in düsteren Wellen über sie hinweg und drohte sie zu ersticken. Sie schloss die Augen, als sich sein Schmerz mit ihrem vermischte und verworrene Muster in ihren Adern hinterließ, bis er und sie miteinander verschmolzen und sie ein Teil von ihm wurde.
In dieser Nacht spürte sie noch intensiver als sonst, wie sein Überlebenswille bröckelte. Sie spürte seine Scham und seine Gedanken, dass er ein Feigling war und es nicht verdiente, ehrenhaft zu sterben.
Tränen traten ihr in die Augen. Wie lange teilte sie nun schon sein stummes Leiden? Seine Stärke hatte sie immer wieder in Erstaunen versetzt, doch allmählich gewann seine Verzweiflung die Oberhand. Sie litt mit ihm. Sie litt für ihn.
Sie konnte sich nicht länger zurückhalten, konnte nicht länger still bleiben, auch wenn sie ein großes Risiko einging und sich und ihre Schwester Grace womöglich in Gefahr brachte. Sie konnte diesem Mann nicht den Rücken zukehren, wenn er so sehr in Not war.
Sie holte tief Luft, ängstlich und doch entschlossen. Dann schloss sie die Augen und streckte ihre Fühler aus, folgte dem Weg aus Schmerz, bis ihr die Hölle, die er durchlebte, in allen Facetten vor Augen stand.
Ein stechender Geruch drang ihr in die Nase, eine Mischung aus Blut, Dreck, Schweiß und Tod, und sie schnappte nach Luft. Ihr Instinkt befahl ihr, von diesem Ort zu fliehen, das Band zwischen dem leidenden Mann und ihr zu kappen. Ihre Kehle war vor Angst wie zugeschnürt, und der Schmerz schnitt wie eine Säge über ihre Nervenenden.
In der Ferne hörte sie Schreie, Stöhnen, gemurmelte Flüche, eine fremde, ihr unverständliche Sprache. Der Mann legte die Hand an den Kopf. Er wusste, dass irgendetwas anders war, tat es aber als weiteren Beweis für seine schwindende geistige Gesundheit ab.
Völlig reglos kauerte sie sich in seinem Kopf zusammen und untersuchte vorsichtig mithilfe seiner Sinne seine Umgebung.
Er war gefangen. Ein Soldat. Flüchtig erhaschte sie ein paar Bilder, Gedanken, die ihm im Kopf herumgingen: seine Gefangennahme. Die endlosen Tage voller Folter, Hunger und Elend.
Er saß in einer Ecke, das Gesicht in den Händen vergraben. Abscheu und Wut bestimmten sein Denken und seine Gefühle. Er hasste sich für seine Schwäche, für seinen Wunsch zu sterben, und er hasste es, dass er den anderen, die mit ihm litten, nicht helfen konnte.
Er dachte an seine Familie. Das tröstete ihn, bereitete ihm aber gleichzeitig auch Sorgen, weil er sich fragte, wie es seinen Eltern und seinen Brüdern mit seinem Verschwinden gehen mochte. Er dachte immer wieder an seinen Zwillingsbruder Joe.
Der Name floss in Sheas Kopf in Form eines Farbenblitzes, der langsam verblasste.
Seit zwei Tagen hatte man ihn nicht mehr geholt. Er empfand eine Mischung aus Erleichterung und Angst. Er wusste, diese Auszeit würde bald vorbei sein. Dann würde er wieder entsetzlich leiden müssen. Er war sich nicht sicher, ob seine Kraft reichen würde, das noch ein weiteres Mal zu überleben. Und er hasste sich für seine Schwäche, weil er sich fragte, ob der Tod diesem Dahinvegetieren nicht vorzuziehen sei. Er war eingesperrt wie ein Tier.
Noch nie im Leben hatte er sich so einsam gefühlt.
Tränen rannen Sheas Wangen hinab. Ihr war klar, dass sie nicht länger still bleiben konnte, nicht länger so tun konnte, als gäbe es keine Verbindung zwischen dem Mann und ihr.
Du bist nicht allein. Ich bin bei dir.
Er hob den Kopf und starrte regungslos in die undurchdringliche Dunkelheit. Trotz seiner Schwäche und seiner angeschlagenen Gemütsverfassung war der Soldat in ihm sofort hellwach. Seine Muskeln spannten sich an, und er drehte sich mit bebenden Nasenflügeln um, als wollte er den Eindringling wittern.
»Wer ist da?«, murmelte er mit heiserer, gebrochener Stimme.
Pscht. Du willst doch nicht, dass die anderen das mitbekommen. Rede auf diese Weise mit mir. In deinem Kopf. Ich kann hören, was du denkst.
»Meine Güte«, krächzte er. »Jetzt ist es so weit. Ich habe endgültig den Verstand verloren.«
Ein Schauer lief ihm über den Rücken, und er krümmte sich noch mehr zusammen, schlang die Arme um die Beine und wiegte sich vor und zurück. Er presste das Gesicht gegen die Knie und schloss die Augen. Erschöpfung und Traurigkeit überwältigten ihn, als er sein Schicksal akzeptierte.
Nein. Du darfst nicht aufgeben. Ich bin bei dir. Ich werde dich nicht verlassen.
»Wer bist du?«, murmelte er, ohne den Kopf von den Knien zu heben.
Warum beharrst du darauf zu sprechen? Sie werden dich hören. Tu nichts, was ihre Aufmerksamkeit erregt.
Ist doch egal, ob ich ihre Aufmerksamkeit errege oder nicht.
Sie konnte seinen Gedanken spüren, genau wie die Resignation, die darin lag, und ihre Kehle zog sich zusammen.
Du bist nicht allein, vermittelte sie ihm noch einmal, nachdrücklicher diesmal. Dann zog sie ihn an sich, stellte sich vor, wie sie ihn in die Arme nahm und ihn tröstete, so gut sie konnte.
Sie strich über seinen Körper und flüsterte ihm beruhigende, unsinnige Worte ins Ohr. Ohne auf den Schweiß- und Blutgestank zu achten, der sie umgab, küsste sie ihn auf die Augenbraue.
Sie kannte diesen Mann nicht, aber sie konnte ihm diesen Trost nicht verwehren, genauso wenig wie irgendeinem anderen leidenden Menschen.
Was sie gleich tun würde, war gefährlich. Aber wie hätte sie es nicht tun sollen, wenn sie doch die Fähigkeit besaß, ihm wenigstens eine Zeit lang Erleichterung zu verschaffen?
Sie verband sich intensiver mit ihm, begab sich in die Tiefen seiner Seele hinab. Als sein Schmerz durch sie hindurchflutete, musste sie sich auf die Zunge beißen, um nicht laut aufzuschreien. Seine Qual wurde zu ihrer.
Als das ganze Ausmaß seines Leids wie ein außer Kontrolle geratenes Buschfeuer über sie hinwegfegte, liefen ihr wieder Tränen die Wangen hinab. Es kostete sie all ihre Kraft und Konzentration, die Verbindung aufrechtzuerhalten.
Was tust du da?
In seiner lautlosen Frage schwang Erstaunen und Ungläubigkeit mit. Sie konnte diese Ungläubigkeit spüren, und gleichzeitig spürte sie, wie sein Körper die kurze Atempause von all dem Entsetzlichen genoss, dem er ausgeliefert war. Sein Verstand hielt das, was geschah, für einen bizarren Traum, einen Beweis dafür, dass er immer mehr den Verstand verlor. Er hielt sie für eine Illusion, die sein Geist geschaffen hatte, um mit der unerträglichen Realität fertigzuwerden.
Sie brauchte eine Weile, bis sie in der Lage war, ihm zu antworten. Zitternd lag sie auf ihrem Bett, und die Schmerzen, die sie von ihm aufsaugte, jagten kleine Feuerblitze durch ihre Nervenbahnen.
Bist du hier?
Hoffnung schwang in der vorsichtigen Frage mit. Er wusste nicht, ob dies Realität oder Halluzination war, kam aber rasch zu dem Schluss, dass es ihm egal war, ob sie wirklich existierte oder nicht. Verzweifelt klammerte er sich an den Gedanken, dass er nicht länger allein war.
Ich bin hier.
Ihre Stimme war jetzt leiser, und er hob stirnrunzelnd den Kopf, streckte die Arme nach oben und zur Seite.
Was hast du getan?
Sie antwortete nicht. Es kostete sie ihre gesamte Kraft, das Band zwischen ihnen nicht reißen zu lassen, und doch spürte sie, wie es brüchiger wurde.
Was hast du getan?, wiederholte er, drängender jetzt. Sie spürte, wie die Kraft in seinen Körper zurückkehrte, genau wie er es spürte, als er seine Arme, seine Hände und schließlich seine Beine testete. Wie hast du das geschafft? Wer bist du?
Ich werde zurückkommen. Ihr Gedanke kam nur noch als leises Flüstern in seinem Kopf an. Ich werde da sein, damit du dies nicht allein durchstehen musst. Ich schwöre es dir.
Bevor sie losließ und sich aus seinem Kopf zurückzog, konnte sie noch spüren, wie frustriert er war. Danach blieb sie lange auf dem Bett liegen, zitternd und schwer atmend, während sie die körperlichen und seelischen Schmerzwellen zu verarbeiten versuchte.
Sie drehte sich auf die Seite und zog die Knie an, bis sie in einer ganz ähnlichen Körperhaltung befand wie er in seiner dreckigen, dunklen Zelle. Sie ließ den Kopf auf die Knie sinken und kämpfte mühsam um jeden Atemzug, bis der Schmerz allmählich nachließ.
Ihre Wangen waren nass, die Haarsträhnen an ihrem Ohr feucht von ihren Tränen. Schwerfällig erhob sie sich, ging mit schleppendem Schritt ins Badezimmer und spritzte sich Wasser ins Gesicht.
Wer war dieser Mann? Wieso fühlte sie sich zu ihm hingezogen? Wieso hatte sie ausgerechnet seinen Schrei unter den Millionen von Schreien in der Nacht gehört? Ihre Gabe hatte etwas so Willkürliches. Sie schlug mit der Faust auf das Waschbecken. Es war ihr nicht möglich, ihre Gabe unter Kontrolle zu bringen. Jedenfalls nicht so, wie die Leute, die sie und ihre Schwester jagten, sich das vorstellten.
Im Gegensatz zu Grace konnte Shea andere Menschen nicht heilen. Sie konnte ihnen ihr Leid nur eine Zeit lang etwas leichter machen. Sie konnte die Gedanken der Menschen hören und sich auf diesem Weg mit ihnen austauschen. Wem nützte das schon?
Und trotzdem wurde sie rücksichtslos verfolgt. Genau wie Grace. Die beiden Schwestern hatten einen Pakt geschlossen: So schmerzlich es war, voneinander getrennt zu sein – sie waren in verschiedene Richtungen geflohen und hatten sich versteckt, ohne miteinander Kontakt aufzunehmen.
Falls eine der Schwestern gefunden würde, würde man sie benutzen, um die jeweils andere aus ihrem Versteck zu locken. Das konnte Shea nicht riskieren. Sie wollte nicht dafür verantwortlich sein, dass Grace gefangen genommen wurde.
Grace war etwas Besonderes. Sie war verletzlich, und ihre Gabe war nicht nur ein kostbares Geschenk, sondern auch ein schrecklicher Fluch. In der Hand von Leuten, die sich ihrer Gabe ohne Rücksicht auf die Folgen bedienen wollten, würde sie nicht überleben. Sie würden sie töten, weil sie ihre Fähigkeiten nicht verstanden, auch wenn das gar nicht ihr Ziel war.
»Ich werde das nicht zulassen«, murmelte Shea entschlossen.
Grace war ein guter Mensch. Sie war weichherzig bis zur Selbstaufgabe. Sie ertrug es nicht, jemanden leiden zu sehen, und das führte dazu, dass Grace oft Schmerzen litt, wie Shea sie sich kaum vorstellen konnte. Die Schmerzen, die sie selbst an diesem Abend für einen kurzen Zeitraum hatte aushalten müssen, waren nichts im Vergleich zu den Krankheiten, die Grace anderen Menschen abnahm und die sie dann oft tagelang quälten.
Shea warf hastig ihre Toilettenutensilien in ihren Koffer. Dann stand sie vor dem Waschbecken, die Hände auf den Rand gestützt, die Augen geschlossen, und versuchte die Erschöpfung abzuschütteln, die von ihr Besitz ergriffen hatte.
Sie hatte gehofft, es würde ihr ein wenig Erleichterung bringen, wenn sie ihre geistigen Fühler nach ihm ausstreckte. Aber alles, was sie empfand, war Traurigkeit. Sie konnte ihn nicht allein lassen in seinem Leid. Er war so kurz davor, alle Hoffnung aufzugeben. Sie spürte seinen Wunsch zu sterben, um seiner grauenvollen Realität zu entkommen.
Sie schüttelte abwehrend den Kopf. Sie würde ihn nicht gehen lassen.
Nathan Kelly saß reglos in der Ecke seiner winzigen Zelle und starrte grübelnd in die Dunkelheit. Er hatte keine Ahnung, ob es Tag oder Nacht war. Er saß quasi in einer Kiste. In einer winzigen, sauerstoffarmen Kiste. Wie lange war er bereits hier?
Die ersten Wochen hatte er die Tage noch gezählt, überzeugt, seine Rettung stünde kurz bevor. Schließlich konnte er sowohl auf die US-Armee zählen, als auch auf seine Brüder, die ein erstklassiges Unternehmen für militärische Operationen leiteten. Es war ein Privatunternehmen, das Jobs übernahm, die sonst keiner machen konnte oder wollte. Häufig erhielten seine Brüder Aufträge von der US-Regierung, aber genauso häufig auch aus dem privaten Sektor. Sie würden ihn niemals in solch einem finsteren Loch verrotten lassen. Nicht nach dem, was Rachel zugestoßen war. Sie würden alles infrage stellen. Sie würden nicht einfach akzeptieren, dass er tot war, egal was man ihnen erzählte.
Er schloss die Augen und dachte an seine zerbrechliche Schwägerin, die Frau seines älteren Bruders Ethan. Dann schüttelte er den Kopf. Nein, Rachel war nicht zerbrechlich. Ein zerbrechlicher Mensch wäre nicht in der Lage gewesen, ein Jahr Gefangenschaft in der Hölle zu überleben.
Nathan konnte noch nicht viel länger als einen Monat hier sein, und schon büßte er den Bezug zur Realität ein – und seine geistige Gesundheit.
Er bewegte sich behutsam, darauf gefasst, von der nächsten Schmerzwelle überrollt zu werden. Aber sie kam nicht. Er war nicht gefühllos geworden oder in einen Zustand jenseits des Schmerzes eingetreten. Er war sich seiner Umgebung bewusst, extrem bewusst sogar. Er konnte jeden einzelnen Schweißtropfen fühlen, der seine Brust hinablief. Der Schmerz war einfach verschwunden.
Nachdem er so lange mit den Schmerzen gelebt hatte, nachdem jeder wache Moment schier unerträgliches Leiden bedeutet hatte, war der schmerzfreie Zustand irgendwie beunruhigend.
Wie war das möglich? War sie ein Engel? Die Stimme in seinem Kopf konnte nur eine Halluzination sein. Lieblich. Warm. So beruhigend, dass er am liebsten darin gebadet hätte.
Einen kurzen Moment lang hatte er Frieden empfunden. Sein Kopf war leer, Ruhe war eingekehrt und hatte sich wie eine warme, kuschelige Decke um ihn gelegt.
Es war absurd zu glauben, dass es in der Hölle Frieden gab. Er würde nicht von Dauer sein, aber Nathan war dankbar für jede Verschnaufpause.
Er ließ sich auf den rauen Boden sinken und kauerte sich zu einer möglichst kleinen Kugel zusammen, bis er nur noch ein undeutlicher Schatten in der Ecke war.
Die Erschöpfung hatte ihn fest im Griff, doch auf einmal spürte er eine sanfte Berührung. Es war, als würde ihm jemand leicht über das Haar streichen. Ein Wispern, wie ein leichter Sommerwind, wehte durch seinen Kopf.
Ich bin hier.
Er schloss die Augen, versuchte sich auszuruhen, seine Kraft zurückzugewinnen. Egal was da heute mit ihm geschehen war, ob er endgültig jeglichen Bezug zur Wirklichkeit verloren hatte oder nicht – sein Lebensmut war wieder erwacht. Er würde kämpfen.
Er konzentrierte sich auf seine Familie. Für sie würde er leben. Dies hier würde vorbeigehen. Er würde es überstehen.
Ja. Du wirst leben. Ich werde nicht zulassen, dass du aufgibst.
Der Engel hatte es ihm zugeflüstert, und das Unerträgliche war erträglicher geworden. Wenn er gekonnt hätte, hätte er den Engel gepackt und sich in ihn eingewickelt.
Er spürte, dass sein Engel lächelte. Es war wie ein Sonnenstrahl in seinem gemarterten Hirn. Und dann spürte er Arme, die sich um ihn schlangen und ihn hielten. Genau wie er es sich vorgestellt hatte.
Schlaf jetzt, drängte die Stimme sanft.
»Bleib bei mir«, konnte er noch sagen, bevor er in einen heilsamen Schlaf sank.
2
Shea trat vor die Tür und atmete tief die kühle Morgenluft ein, in der Hoffnung, dann wieder klar denken zu können. Noch immer schossen ihr blitzartig die Bilder der nächtlichen Begegnung durch den Kopf, und die Gefühle, die sie auslösten, lasteten schwer auf ihr. Nachdem sie Kontakt zu dem Mann in Gefangenschaft aufgenommen hatte, hatte sie versucht, wieder einzuschlafen, aber sie war zu aufgewühlt gewesen.
Sie zog die Jacke enger um sich und starrte die Straße hinunter. Allmählich erhellte sich der Himmel. Es war noch immer ziemlich ruhig, aber in etwa einer Stunde würde die Hektik des morgendlichen Stoßverkehrs die Stille verdrängt haben. Heute musste sie nur ein einziges Haus putzen, und dafür würde sie nicht lange brauchen. Sie hatte nie gewagt, eine Stelle anzunehmen, bei der sie Auskunft über ihre persönlichen Daten geben musste. Sie nahm jeden Job an, für den sie das Geld bar auf die Hand bekam, und nach kurzer Zeit wechselte sie den Wohnort. Zu lange an einem Ort zu bleiben machte sie nervös, und sie war entschlossen, ihren Verfolgern immer ein paar Schritte voraus zu sein.
Schon jetzt schrie ihr Bauchgefühl, dass sie bereits viel zu lange hier sei. Es war Zeit zu gehen.
Sie bückte sich, als wollte sie ihren Schuh zubinden, und sah unauffällig nach links und rechts. Es wirkte, als würde sie sich auf ihr Training einstimmen.
In Wirklichkeit hasste sie Joggen. Sie hielt sich fit, einfach weil es notwendig war, nicht aus Begeisterung für die sportliche Betätigung. Aber es war auch eine gute Möglichkeit, die Umgebung im Auge zu behalten, um kleine Veränderungen zu bemerken oder etwas Ungewöhnliches. Sie war auf der Hut vor denen, die sie jagten.
Du bist sehr nachdenklich heute Morgen, Shea.
Shea erhob sich stirnrunzelnd und streckte sich.
Du darfst mich nicht ignorieren, bat Grace leise. Ich weiß, dass du mich hörst. Rede mit mir.
Shea seufzte. Du weißt doch, dass wir nicht miteinander in Kontakt treten sollten, Grace. Es ist nicht sicher. Ich will nichts wissen, was gegen dich verwendet werden könnte. Und du solltest über mich auch nichts wissen. Was ich nicht weiß, kann auch niemand aus mir herausfoltern.
Es ist nicht deine Aufgabe, mich zu beschützen, wies Grace sie zurecht.
Und ob. Du besitzt eine Gabe, Grace. Ich werde nicht zulassen, dass diese Schweine sie ausbeuten. Oder dich. Ich will, dass du in Sicherheit bist. Ist alles okay bei dir? Brauchst du irgendwas?
Shea spürte den genervten Seufzer.
Ich habe deinen Schmerz gespürt und deine Angst. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ich … ich vermisse es, mit dir zu reden.
Sheas Herz zog sich zusammen, und die Traurigkeit schnürte ihr die Kehle zu. Ich vermisse dich auch. Und jetzt verschwinde, bevor ich mehr sehe, als ich sollte.
Grace schwieg einen Moment. Auch du hast eine Gabe, Shea. Du solltest dein Licht nicht immer unter den Scheffel stellen. Was du den Menschen gibst, ist unbezahlbar. Was du mir gibst, ist unbezahlbar.
Ich liebe dich, erwiderte Shea fest. Wir werden wieder zusammen sein. Das schwöre ich dir.
Shea spürte Grace’ Traurigkeit und lief ein wenig langsamer, um ihre ältere Schwester mental in den Arm zu nehmen, genau wie sie es in der vergangenen Nacht mit dem Soldaten gemacht hatte, der so dringend Trost brauchte.
Die Umarmung, die ihre Schwester ihr zurückgab, war so warm und voller Energie, dass Shea die Augen schloss, um sie besser genießen zu können.
Ich liebe dich auch, Shea. Pass gut auf dich auf.
Mache ich.
Wie immer, wenn sie mit ihrer Schwester Kontakt gehabt hatte, fühlte Shea sich anschließend so leer, dass es schmerzte. Ihre Schwester war gleichzeitig auch ihre beste Freundin, und sie hatte sie seit einem Jahr nicht mehr gesehen.
Tränen ließen ihr die Sicht verschwimmen, doch sie zwang sich, wieder schneller zu laufen, bis die Muskeln in ihren Beinen zitternd protestierten.
Bis vor einem Jahr hatten ihre Familie und sie noch ein normales Leben geführt – so normal, wie das möglich war bei den außergewöhnlichen Fähigkeiten, über die Grace und sie verfügten. Sie hatten bei ihren Eltern gelebt, hauptsächlich weil diese sich Sorgen gemacht hatten, wie es den beiden Töchtern ohne sie ergehen würde.
Shea und Grace hatten sich gutmütig damit abgefunden, auch wenn sie ihre Eltern immer für etwas paranoid gehalten hatten. Ihre Fähigkeiten waren ein Geheimnis. Niemand wusste, wozu sie in der Lage waren. Ihre Eltern hatten darauf bestanden, dass sie sie niemals einsetzten. Es war, als wollten sie diese Fähigkeiten aus der Welt schaffen, indem sie sie einfach nicht zur Kenntnis nahmen.
Und dann war eines Nachts bei ihnen eingebrochen worden, trotz ihrer erstklassigen Alarmanlage. Ihre Eltern waren erschossen worden, und Shea und Grace waren der Gefangennahme nur entgangen, weil ihr Vater ihnen einen Schutzraum mit einem Fluchttunnel in den dichten Wald gebaut hatte, der das Haus umgab.
Ihr Vater hatte sie in den Schutzraum geschubst und die Schlösser versperrt. Die beiden Mädchen hatten wie angewurzelt im Inneren gestanden und entsetzt mit anhören müssen, wie ihre Eltern nur wenige Meter von ihnen entfernt ermordet wurden.
Ihre Eltern waren nicht paranoid gewesen. Sie waren sich der Gefahr sehr bewusst gewesen, in der ihre Töchter schwebten. Wenn Shea und Grace ihre Ängste ernster genommen hätten, wären ihre Mom und ihr Dad vielleicht noch am Leben.
Wütend ballte sie die Fäuste. Sie verlangsamte ihren Schritt und verfluchte die Tatsache, dass sie diesmal weiter gelaufen war als üblich. Sie drehte sich um und joggte den Weg zurück, den sie gekommen war.
Auf halbem Weg zu der kleinen Doppelhaushälfte, die sie gemietet hatte, fiel ihr eine schwarze Limousine mit getönten Scheiben auf, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkte. Auf dem Hinweg hatte der Wagen noch nicht dort gestanden. Sie hätte ihn garantiert bemerkt. Und er gehörte auch nicht dem Besitzer des Hauses.
Sie informierte sich immer genauestens über ihre Umgebung. Im Umkreis von acht Straßen wusste sie bei jedem Auto, zu wem es gehörte. Sie hatte sich sogar die Nummernschilder eingeprägt. Unauffällig warf sie einen Blick auf den Wagen, speicherte das Kennzeichen ab und beschleunigte dann leicht ihren Schritt.
Am Ende der Häuserreihe bog sie nach rechts ab statt weiter geradeaus in Richtung ihrer Straße zu laufen. Um möglichst unbeschwert zu wirken, schwang sie im lockeren Trab die Arme und rollte die Schultern, als wollte sie Verspannungen lösen.
Aber als sie sich umschaute, sah sie, wie der Wagen anfuhr, wendete und sich dann langsam in ihre Richtung bewegte.
Shea hielt den Atem an. Sie zwang sich, ruhig zu bleiben und nicht loszustürmen. Noch nicht. Ihr fehlten noch ein paar Meter, bis sie an der Stelle war, wo man sie kurzzeitig nicht mehr sehen konnte.
Sobald sie außer Sichtweite war, rannte sie los, über einen Hof und zwischen zwei Häusern hindurch. Jeder in dieser blöden Straße hatte einen Zaun, und es war nicht so einfach hinüberzukommen.
Sie kletterte hinauf und landete auf der anderen Seite. Sie sprang auf, floh auf die Rückseite des Grundstücks und zog sich auch dort über den Zaun.
Sie hoffte, der Wagen würde in die Straße einbiegen, in die auch sie eingebogen war, und nicht in Richtung ihres Hauses weiterfahren. Sie brauchte nur ein paar Minuten, um dort hinzukommen, sich die vorsichtshalber immer gepackte Tasche zu schnappen und im Eiltempo zu verschwinden.
Während der ganzen Zeit schirmte sie ihre Gedanken sorgfältig ab, damit ihre Schwester nichts von ihrer Angst und ihrer Aufregung mitbekam. Grace durfte auf gar keinen Fall ihr Versteck verlassen, nur weil sie glaubte, ihre Schwester wäre in Gefahr.
Denn das würde sie sofort tun. Sie würde alles opfern, um für Sheas Sicherheit zu sorgen. Genau wie Shea das für Grace tun würde. Wenn Shea sich schnappen ließ, schwebte Grace in großer Gefahr.
Aber sie würde sich nicht einfach gefangen nehmen lassen, sie würde mit allen Mitteln kämpfen.
Als sie bei ihrem Garten ankam, war sie völlig erledigt und bekam kaum noch Luft. Statt direkt ins Haus zu stürmen, beobachtete sie zunächst genau die Umgebung, horchte, ob sich ein Wagen näherte, und schlich erst dann zu ihrer Hintertür.
Unüberlegt in eine ungünstige Situation zu geraten war das Letzte, was sie jetzt brauchen konnte.
Vorsichtig öffnete sie die Tür. Sie lauschte, ob von drinnen etwas zu hören war. Sobald sie das Haus betreten hatte, warf sie als Erstes einen Blick aus dem Panoramafenster, durch das sie die gesamte Straße überblicken konnte.
Erleichtert holte sie tief Luft und machte sich an die Arbeit. Sie lief in ihr Schlafzimmer, holte die gepackte Tasche aus dem Schrank und nahm die Pistole aus der Nachttischschublade. Sie schob das Magazin hinein, sicherte die Waffe und steckte sie dann in ihre Shorts. Ohne die Sachen, die sie zurückließ, auch nur eines Blickes zu würdigen, eilte sie zur Haustür.
Ihr Wagen stand so nah wie möglich am Haus, aber nicht so nah, dass sie nicht hätte wenden und ohne zurücksetzen zu müssen aus der Einfahrt schießen konnte.
Es war grässlich, so leben zu müssen, aber die Alternative war noch weniger verlockend.
Shea stieß die Tür auf, rannte zu ihrem Wagen und warf ihre Tasche hinein. Sie schob den Schlüssel ins Zündloch, ließ den Motor an und raste mit heulendem Motor aus der Einfahrt.
Nachdem sie in die Straße eingebogen war, warf sie einen Blick in den Rückspiegel. Ein Angstschauer lief ihr über den Rücken und schnürte ihr die Kehle zu.
Die Limousine, die sie vorher gesehen hatte, kam die Straße heraufgefahren und hielt soeben vor ihrem Haus.
Es war sinnlos, die Unbeteiligte zu mimen und so zu tun, als hätten sie einander nicht längst entdeckt. Sie überfuhr das Stoppschild am Ende der Straße und gab Gas.
Shea war irgendwo in Colorado, auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit, als sie von einem unvorstellbaren Schmerz überfallen wurde. Ihr gesamter Körper versteifte sich, und ihr Mund wurde staubtrocken. Nach all den Tagen, die sie nun schon unterwegs war, mit nur wenig oder gar keinem Schlaf, war sie so erschöpft, dass sie die Wucht des Schmerzes ihres Soldaten nicht abblocken konnte.
Mit letzter Kraft gelang es ihr, an den Straßenrand zu fahren, bevor sich eine weitere Schmerzwelle den Weg durch ihren Körper bahnte und sie von innen nach außen in Brand setzte.
Oh nein. Nein.
Sie beugte sich vor, legte den Kopf auf das Lenkrad und versuchte, sich wieder in den Griff zu bekommen. Dann streckte sie ihre Fühler nach ihm aus, glitt in seinen Körper und in seine Gedanken. Sie hatte nicht vorgehabt, ihn so lange allein zu lassen, und so gesellten sich zu den Schmerzen auch noch Schuldgefühle. Die letzten Tage war sie ständig auf der Flucht gewesen, hatte dauernd über die Schulter geschaut, bis sie sicher war, ihre Verfolger abgeschüttelt zu haben.
Ich bin bei dir. Halte durch. Bitte. Lass nicht zu, dass sie dich zerstören.
Sie konnte die Tränen spüren, die ihm über das Gesicht liefen. Hilflosigkeit und Verzweiflung trafen sie mit solcher Wucht, dass sie tief in den Sitz gedrückt wurde. Sie zwang sich, durch seine Augen zu sehen. Entsetzt schnappte sie nach Luft, und Tränen schossen ihr in die Augen.
Ein Mann kniete vor dem Soldaten, den man aus dem winzigen dunklen Loch geholt hatte, in dem er gefangen gehalten wurde. Nachdem es ihnen nicht gelungen war, von dem Soldaten zu erfahren, was sie wissen wollten, hatten sie einen weiteren Mann in den Raum geschleppt und ihn vor ihm auf die Knie gezwungen.
Shea schloss die Augen, um die Gräueltaten auszublenden. Aber es nützte nichts. Sie sah durch die Augen ihres Soldaten, spürte alles, was er spürte, und wusste alles, was er wusste.
Wut packte ihn. Entsetzen, Angst, Abscheu, Schmerz.
Er hätte seine Peiniger am liebsten umgebracht. Dann überlegte er, ob er nachgeben sollte, aber er wusste, dass das nichts am Schicksal des anderen Gefangenen ändern würde. Das hier waren Tiere ohne das geringste bisschen Ehrgefühl.
Plötzlich fiel ein Schuss. Erst dröhnte er durch den Kopf des Soldaten, anschließend durch ihren. Mit glasigen Augen starrte sie durch die Windschutzscheibe, während sie den anderen Gefangenen zu Boden stürzen sah. Eine Blutlache bildete sich rund um seinen Kopf.
Eine schreckliche Traurigkeit überfiel sie, aber sie hätte nicht sagen können, ob es ihr eigenes Gefühl oder das ihres Soldaten war. Außerdem spürte sie seine Selbstzweifel und seine Schuldgefühle. Er dachte, dass der andere Gefangene das bessere Los gezogen hatte, musste er doch wenigstens nicht mehr leiden.
Warum ließen sie ihn am Leben? Warum töteten sie ihn nicht endlich und machten dem allen ein Ende?
Seine Gefühle prasselten wie ein Bombenhagel auf sie ein. Sie waren eine Mischung aus Überlebenswille und dem Wunsch, endlich die Schmerzen nicht mehr spüren zu müssen. Er hasste sich für seine Schwäche, und sein Selbstekel nahm immer bitterere Formen an.
Es war nicht deine Schuld. Du darfst dir nicht die Schuld an seinem Tod geben. Richte deinen Hass auf diese Tiere, die haben ihn verdient. Nicht gegen dich selbst.
Wer bist du?
Die Frage klang barsch. Noch immer hatte ihn die Wut fest im Griff. Sie fraß ihn auf, mehr noch als der Schmerz. Sie spürte sie durch seine Adern jagen und in ihre hinüberfließen. Sie war grell, wie elektrisch aufgeladen und von blendender Intensität.
Jemand, der dir helfen möchte.
Wie solltest du mir helfen können?
Das klang so hoffnungslos. Sie wusste, dass er keine Antwort erwartete. Er hielt sie ja nicht einmal für real.
Als er plötzlich hochgezerrt und brutal aus dem Raum geschleift wurde, in dem der Tote lag, verhielt sie sich ganz still. Es war unsinnig, denn sie konnten sie nicht entdecken. Dennoch hatte sie Angst, sich zu bewegen, Angst, ihr Soldat könnte auf irgendetwas, das sie tat, reagieren und daraufhin von seinen Entführern noch schlimmer misshandelt werden.
Als er in seine Zelle geschubst wurde, landete er hart auf dem Boden. Er kroch in seine Ecke, dieselbe Ecke, in die er sich Tag für Tag, Nacht für Nacht zurückzog.
Er zitterte heftig, eine Reaktion auf die Folter, die er erlitten hatte, und sie konnte nicht anders, sie musste ihn in die Arme nehmen und ihn halten. Die Luft war warm und abgestanden, und trotzdem überlief ihn ein Schauer nach dem anderen.
Sie schloss die Augen, holte tief Luft und konzentrierte sich dann auf ihre Aufgabe, ihn von seinen Schmerzen zu befreien.
Diesmal gab sie nicht einen Laut von sich. Ihre Kiefermuskulatur war zu angespannt, ihr Körper zu steif. Sie wäre wohl kaum in der Lage gewesen, laut zu schreien, aber im Geist schrie sie unaufhörlich wegen all der Dinge, die man ihm angetan hatte.
Als sie fertig war, sank sie erschöpft in sich zusammen, den Kopf zur Seite geneigt, und versuchte mühsam, wieder Herrin ihrer Sinne zu werden. Sie spürte seine Frage, wusste, dass er verwirrt die Stirn runzelte, weil er seinen schmerzlosen Zustand nicht fassen konnte.
Weißt du, wo du bist?
Sie versuchte, ihre Frage entschlossen und zuversichtlich klingen zu lassen, aber es misslang ihr völlig. Die Frage kam nur als kaum hörbares Flüstern in seinem Kopf an.
Sofort wurden seine Niedergeschlagenheit und seine Hilflosigkeit so riesig wie vorher sein Schmerz.
Nein.
Es muss irgendetwas geben, das wir tun können. Du kannst so nicht weitermachen. Gibt es jemanden, der dir helfen kann?
Sie spürte, wie er seufzte. Er rieb sich den Kopf, dann presste er die Handteller vor die Augen und legte die Finger auf die Stirn.
Meine Brüder suchen nach mir. Ich weiß es. Sie geben nicht auf, bevor sie mich gefunden haben. Tot oder lebendig.
Ich könnte Kontakt zu ihnen aufnehmen.
Die Worte sprudelten aus ihr heraus, ohne dass sie erst überlegt hätte. Sofort bereute sie ihr Angebot. Sie durfte Grace und sich nicht in Gefahr bringen! Wie konnte sie nur ihrer beider Sicherheit für diesen unbekannten Mann aufs Spiel setzen?
Und doch wusste sie, dass sie keine Wahl hatte. Sie würde ihn nicht sterben lassen. Sein Überleben hatte für sie inzwischen oberste Priorität. Warum das so war, wusste sie nicht. Sie hat außerdem keine Ahnung, wieso diese Verbindung zwischen ihnen entstanden war. Auch dieser Aspekt ihrer Gabe war dem Zufall unterworfen – so wie alles, was mit ihrer Gabe zusammenhing.
Er lachte. Es klang heiser und nicht sehr angenehm. Seine Stimme war eingerostet, weil er sie lange nicht gebraucht hatte. Wieder rieb er sich die Augen.
Wie kannst du mir helfen? Du existierst doch gar nicht.
Sie würde sich mit ihm auf keine Diskussion über ihre Existenz einlassen. Ihre Kraft reichte gerade noch, um die Verbindung zu ihm nicht abreißen zu lassen, und im Moment, das spürte sie genau, konnte er das Alleinsein noch weniger ertragen als sonst. Er kam dem Abgrund immer näher.
Stell dir doch einfach mal einen Moment lang vor, ich wäre real, würde vor dir stehen, aber niemand könnte mich sehen. Ich kann unentdeckt kommen und gehen. Was könntest du mir erzählen, das hilfreich für dich wäre? Wie könnte ich Kontakt mit deinen Brüdern aufnehmen?
Er schüttelte den Kopf. Ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt schon Selbstgespräche führe.
Verdammt, rede mit mir! Frustriert schlug sie auf das Lenkrad. Hör auf mit dem Leugnen. Was hast du schon zu verlieren? Wenn ich nicht real bin, dann kommt eben niemand. Aber so kommt schließlich auch niemand. Sag mir, was ich wissen muss, um dir helfen zu können. Irgendetwas muss es doch geben, was ich ihnen ausrichten kann.
Schweigend ließ er sich ihre Worte durch den Kopf gehen. Ein Hoffnungsfunke glimmte in ihm auf, aber er erstickte ihn sofort wieder. Er weigerte sich, einer Fantasie nachzugeben. Er hielt diese Hoffnung für einen letzten Strohhalm, und wenn er sich ihr hingab, würde er endgültig den Verstand verlieren.
Sag mir deinen Namen. Sag mir, wer du bist, damit ich dir helfen kann.
Nathan … Er holte tief Luft und seufzte. Nathan Kelly.
Sie richtete sich auf. Wenn sie zu lange am Straßenrand stehen blieb, würde sie unter Umständen die Aufmerksamkeit von irgendjemandem auf sich ziehen.
Erschöpft strich sie sich das Haar aus dem Gesicht und ließ den Wagen an.
Nathan.
Ihr wurde erst bewusst, dass sie seinen Namen gesagt hatte, als er antwortete.
Wenn wir uns schon vorstellen, wüsste ich gern, wie sich der verrückte Teil von mir nennt.
Sie biss sich auf die Lippe und lenkte den Wagen zurück auf den Highway. Sie war so erledigt, dass sie kaum die Augen offen halten konnte.
Er runzelte die Stirn und legte die Hand an den Kopf. Alles … alles in Ordnung mit dir?
Es ärgerte ihn, dass er das fragte, dass er akzeptierte, dass sie nicht eine verrückte Ausgeburt seines Gehirns war. Und doch konnte er sie genauso fühlen wie sie ihn, und er spürte ihre Schwäche und ihren Schmerz, vor allem jetzt, wo sein eigener Schmerz verschwunden war.
Seine widerwillige Sorge um sie entlockte ihr ein Lächeln.
Ich heiße Shea, sagte sie schließlich, nachdem sie einen Moment mit sich gekämpft hatte, ob sie dieses winzige Detail von sich preisgeben wollte.
3
Nathan lehnte den Kopf nach hinten gegen die raue Oberfläche der Zellenwand und starrte blicklos in die Dunkelheit. Sein Schmerz war verschwunden. In gewisser Weise. Er spürte, wie er irgendwo in der Nähe lauerte, fast als würde er einen Eindruck vom Schmerz eines anderen empfangen, ohne ihn tatsächlich im eigenen Körper zu spüren.
Existierte sie wirklich? Das konnte einfach nicht sein.
Andererseits: Spielte das eine Rolle, solange ihm seine Vorstellungskraft durch diese Situation hindurchhalf?
Shea. Sie hatte gesagt, ihr Name sei Shea. Und sie wolle ihm helfen.
War er verrückt? War dies irgendeine brutale Falle, die seine Entführer aufgestellt hatten, um ihm Informationen zu entlocken? Wie konnten sie sich Zugang zu seinem Kopf verschaffen? Er hatte davon gehört, dass man das Unterbewusstsein beeinflussen konnte, aber er hatte sich nie groß Gedanken darüber gemacht. Außerdem, wie sollte jemand unterbewusst mit einem reden können? Shea − wer auch immer sie war − pflanzte ihm keine Ideen ein. Sie hatte ihm seinen Schmerz abgenommen und sie litt. Wegen ihm.
Sie hatte jetzt schon eine Weile geschwiegen, und allmählich erfasste ihn Panik. Sein Puls beschleunigte sich, und in seiner Kehle bildete sich ein Kloß, der nicht weichen wollte, sooft er ihn auch hinunterzuschlucken versuchte. Egal ob sie wirklich oder nur eingebildet war, er wollte nicht, dass sie verschwand.
Shea.
Er testete in Gedanken ihren Namen, und der Klang gefiel ihm.
Ich bin hier.
Sie klang schwach. Er runzelte die Stirn. Was hast du getan? Wieso kannst du mir meine Schmerzen nehmen?
Das ist nicht wichtig. Du musst mir sagen, wie ich dir helfen kann. Kannst du mir denn gar nichts über deinen Aufenthaltsort erzählen? Wer hält dich gefangen? Zu welcher militärischen Einheit gehörst du? Es gibt doch sicher jemanden, mit dem ich Kontakt aufnehmen kann.
Er spürte, wie ihre unzähligen Fragen in sein Gehirn drängten. Sie war frustriert und ungeduldig. Sie brauchte rasch Informationen, denn sie fürchtete, die Verbindung zwischen ihnen nicht aufrechterhalten zu können.
Wieder runzelte er die Stirn, weil sein Kopf zu dröhnen begann. Jetzt spürte er ihren Schmerz.
Alles in ihm beharrte darauf, dass das alles völlig verrückt war. Es musste sich um irgendeine bizarre Erscheinung handeln, eine Folge von zu vielen Folterungen. Er hatte sich aus der Wirklichkeit entfernt.
Aber wenn das stimmte und er sich diese Gespräche mit Shea nur einbildete, dann schadete es trotzdem nicht, wenn er ihr die Adresse seiner Brüder gab.
Ein Hoffnungsfunke blitzte in ihm auf, den er wütend sofort wieder abtötete. Er wusste, dass er an jeder weiteren Enttäuschung womöglich endgültig zerbrechen würde.
Nathan, beeil dich.
Er presste die Handflächen gegen die Schläfen und schloss die Augen. Sam Kelly. Er lebt in Dover, Tennessee, zusammen mit dem Rest der Familie. Garrett, Donovan, Ethan und Joe … Meine Güte, wo mochte Joe wohl sein? Der Gedanke, dass sein Zwillingsbruder in einer ähnlichen Hölle schmoren könnte, machte ihm unglaubliche Angst. Nein, Joe war nicht hier. Das hätte er gewusst, er hätte es gehört. Joe war nicht einmal im selben Team gewesen. Er musste inzwischen zu Hause sein. Vielleicht war er sogar schon aus der Armee entlassen. Nathan musste daran glauben, dass es so war, weil die Alternativen einfach unerträglich waren.
Er spürte, dass sie sich bewegte, und hatte den Eindruck, als würde sie aus einem Wagen steigen. War sie unterwegs? Sie entfernte sich weiter von ihm. Alarmiert schreckte er hoch. Ihm brach der Schweiß aus, und er musste mehrmals schlucken.
Dann berührte sie ihn. Er spürte ihre Hände auf seinen Schultern, beruhigend und warm. Sanft strichen ihre Lippen über seine Schläfe.
Lass mir einen Moment Zeit. Ich muss sicherstellen, dass ich nicht in Gefahr bin. Ich verlasse dich nicht. Noch nicht.
Die nächsten Sekunden waren die längsten seines Lebens. Reglos saß er in der Dunkelheit. Da war … nichts. Keine Schreie in der Ferne. Keine Hinweise auf Anwendung von Gewalt. Es war so still, dass er sich immer unwohler fühlte, bis ihn die Panik wieder fest im Griff hatte.
Sie würde nicht wiederkommen. So bald nicht.
Er fuhr sich mit der Zunge über die trockenen, aufgeplatzten Lippen. Für einen Liter Wasser hätte er seine Seele verkauft. Auf Essen hatte er schon lange keinen Appetit mehr. Aber Wasser! Wenn er das hätte, könnte er es schaffen, krank zu werden.
Er dachte an seine Brüder, an seine Mom und seinen Dad. Er stellte sich vor, wie er zu Hause, im Schoß seiner Familie saß. Wo waren sie? Suchten sie gerade nach ihm? Was hatte ihnen die Armee über sein Verschwinden mitgeteilt?
Aber noch während er an Rettung und Heimkehr dachte, fragte er sich, ob er jemals wieder der alte Nathan Kelly sein würde.
Er fühlte sich nicht wie ein Mensch. Er fühlte sich wie ein Tier. Oder noch eine Stufe darunter. Nicht einmal sein Verstand funktionierte noch richtig. Seine ganze Existenz war auf das nackte Überleben reduziert. Er hangelte sich von einer Stunde zur nächsten, eingesperrt in der Hölle.
Als Soldat lebte er mit dem Wissen, dass jeder Tag der letzte sein konnte. Der Tod ließ sich nicht verleugnen. Er war nicht einfach etwas, das anderen zustieß. Täglich ereilte er den einen oder anderen seiner Kameraden.
Und jetzt hatte er erfahren müssen, dass es Dinge gab, die schlimmer waren als der Tod. Tod bedeutete Frieden. Ruhe. Erlösung von unvorstellbaren Lebensbedingungen. Selbst Tieren ließ man mehr von ihrer Würde als ihm. Etwas ertragen zu müssen war manchmal schlimmer als der Tod.
Den Tod fürchtete er nicht. Ein Teil von ihm hieß ihn sogar willkommen.
Er ließ die Hand über seine nackte Brust gleiten, hinunter zu seinem mageren Bauch. Jede einzelne Rippe war fühlbar. Sein nackter Körper war voller Dreck und Blut, aber schon lange regte er sich nicht mehr darüber auf, dass man ihm seine Kleidung weggenommen hatte.
Stell dir vor, du sitzt in einer Badewanne mit heißem Wasser, und um dich herum auf dem Rand steht etwas zu essen.
Er schreckte auf, als sich ihre Stimme sanft in seinen Kopf drängte, doch bei dem Bild, das sie für ihn entwarf, musste er lachen. Bist du in Sicherheit? Wo steckst du? Wieso glaubst du, du wärst in Gefahr?
Sie war hundemüde, und der Schmerz hämmerte ununterbrochen auf ihren Kopf ein. Sie hatte sich zu einer Kugel zusammengerollt. Lag sie auf einem Bett? Wenn sie in Gefahr war, war sie extrem verletzlich. Hatte sie die Türen abgesperrt? Kannte sie sich mit Selbstverteidigung aus?
Du bist derjenige, um den wir uns Gedanken machen müssen, murmelte sie mit einer schläfrigen Stimme, die wie süßer Honig durch seinen Kopf summte. Erzähl mir mehr. Ich kann … ich kann deinen Bruder nicht so ohne Weiteres anrufen. Das ist zu riskant für mich. Aber ich kann ihm einen Brief schreiben. Oder … Frustriert seufzte sie auf und schloss die Augen, um ihre sieben Sinne wieder zusammenzubekommen. Ihr innerer Kampf verwirrte ihn. Er hatte keine Vorstellung davon, was hier vor sich ging. Ich weiß es nicht. Mir wird schon was einfallen.
Neben ihrer Müdigkeit und ihrer Resigniertheit spürte er jedoch auch ihre stählerne Kraft. Sie war wild entschlossen, ihm zu helfen.
Du könntest Donovan eine E-Mail schicken. Er hängt immer am Computer. Er würde sie sofort sehen. Die Worte sprudelten aus ihm heraus, bevor er sich überlegen konnte, was er da tat. Er gab seiner eingebildeten Freundin die Mail-Adresse seines Bruders! Dann drang zu ihm durch, was sie gesagt hatte. Wieso ist das riskant für dich? In was für Schwierigkeiten steckst du? Meine Brüder könnten dich beschützen. Sie stehen in deiner Schuld, wenn du ihnen hilfst, mich zu finden.
Für mich gibt es keine Sicherheit, wird es niemals geben.
Sanft glitten die Worte durch seinen Kopf. Sie drückten Bedauern aus, klangen aber auch endgültig. In was für einer Situation sie auch stecken mochte, sie war jedenfalls felsenfest davon überzeugt, in Gefahr zu sein. Das akzeptierte sie, ohne es zu hinterfragen.
Denk nach, Nathan. Überleg, wo du dich befinden könntest. Wo warst du, als du gefangen genommen wurdest? Warst du zu dem Zeitpunkt bei Bewusstsein? Es muss doch irgendwas geben, was ich deinen Brüdern mitteilen kann.
Er holte tief Luft und versuchte, seine Gedanken zur Ruhe zu bringen. Immer wenn er an jenen Tag zurückdachte, war in seinem Kopf nur ein einziges Durcheinander aus Schüssen, Explosionen, Schreien. Einige stammten von seinen eigenen Leuten, einige vom Feind.
Er war mit seinem Team auf einem Aufklärungseinsatz gewesen. Nichts Kompliziertes. Sie waren nicht auf ein Gefecht gefasst gewesen. Die Gegend galt als ruhig. Die gefährliche Zone lag weiter im Süden. Sie hatten sich von Joes Team getrennt, das weiter nach Norden vorgedrungen war, während Nathan und sein Team die unmittelbare Umgebung durchforstet hatten.
Und dann war plötzlich die Hölle los gewesen.
Es war schwierig, den Tag zu rekonstruieren. Eine Explosion ganz in seiner Nähe hatte ihn bewusstlos werden lassen, und als er wieder zu sich gekommen war, hatte er gefesselt hinten in einem klapprigen Lastwagen gelegen. Drei Mitglieder seines Teams waren ebenfalls dort gewesen. Einer war kurz darauf gestorben, den anderen hatte es heute erwischt. Jetzt war nur noch Swanny übrig. Lebendig in der Hölle begraben, gemeinsam mit Nathan.
Die Traurigkeit überwältigte ihn, und seine Gefühle schnürten ihm die Kehle ab. Er hatte sein Wort gehalten und den Pakt mit dem Team nicht verraten. Sie hatten geschworen, sich nicht brechen zu lassen und nicht zu kooperieren, egal wie hoch der Preis sein sollte. Und jetzt war Taylor tot.
Seine letzten Worte an Nathan waren gewesen: »Tu es nicht, Kelly. Verdammt, tu es ja nicht.«
Nathan hatte geschwiegen, und Taylor war gestorben.
War es das wert? War irgendetwas von alldem es wirklich wert?
Nie zuvor hatte er seine Berufung oder seine Entschlossenheit hinterfragt. Er war Soldat. Sein Job war es, seinem Land zu dienen. Es war eine Pflicht, der er sich mit Hingabe gewidmet hatte.
Aber hier in der Finsternis, allein, ohne Hoffnung, zweifelte er an allem, was ihn zu dem machte, der er war.
Nathan.
Ihre Stimme klang verständnisvoll. Mitfühlend. Wie konnte sie so viel Mitgefühl empfinden? Sie kannte ihn nicht einmal.
Ich kann die Verbindung zwischen uns nicht viel länger aufrechterhalten. Du musst mir alles über deinen Aufenthaltsort erzählen, alles, was du weißt. Ich werde es aufschreiben. Wort für Wort. Ich tue, was ich kann, um dir zu helfen, und soweit das in meiner Macht steht, werde ich dich nicht verlassen. Ich bleibe bei dir, bis sie dich finden.
Ihr Versprechen entfachte einen Funken in der Dunkelheit seiner Seele. Er wollte so gern, dass es stimmte. Er wollte dieses Wunder. War es Gott, der da zu ihm sprach? War sie ein Engel?
Seine Mailadresse lautet [email protected]. Sag ihm … sag ihm, er soll mit Joe reden. Sag ihm … Nathan fiel es schwer, sich zu konzentrieren, sich zu erinnern. Er war von dem Lastwagen heruntergezerrt worden. Es war helllichter Tag gewesen. Ihm fiel wieder ein, dass er hinuntergeschaut hatte. Sag ihm, ich war im Korengal-Tal.
Kannst du dich jetzt ausruhen? Du musst deine Kräfte schonen. Sind deine Schmerzen erträglicher?
Er spürte, wie ihm eine Hand über die Wange strich, so sanft und beruhigend. Er schloss die Augen und schmiegte sich an die imaginäre Hand. Obwohl ihre Kräfte fast aufgebraucht waren, gab sie ihm, was ihr noch verblieben war, um ihm Trost zu spenden.
Er legte die Hand an sein Gesicht, als wollte er ihre festhalten, doch seine Finger berührten nur seine eigene dreckige, blutverkrustete Haut. Dennoch wölbte er die Hand um seine Wange und genoss die Vorstellung, ihre in seiner zu spüren.
Ruh dich mit mir zusammen aus. Ich kann deine Schwäche spüren. Mein Schmerz ist verschwunden, aber deiner nicht. Wenn ich könnte, würde ich ihn dir abnehmen.
Er spürte ihr Lächeln, und ihm wurde warm ums Herz.
Dummerchen, murmelte sie. Das ist doch nicht der Sinn der Sache, dass ich dir den Schmerz nehme, und dann nimmst du ihn wieder zurück. Schlaf jetzt. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Ruf mich einfach.
4
»Zwei Monate sind es jetzt schon, und was haben wir? Nichts!«, rief Donovan wütend. Seine Wut fraß ihn schier auf. Am liebsten hätte er die neu gebaute Einsatzzentrale mit bloßen Händen auseinandergenommen.
Seine Brüder wirkten auch nicht viel glücklicher.
Sam Kelly hatte sich über die Landkarte gebeugt, die auf dem Tisch lag. Auf ihr waren an all den Orten, die KGI bereits nach Nathan abgesucht hatte, Reißnägel angebracht. Garrett stand auf der einen, Ethan auf der anderen Seite von seinem Bruder. Alle drei starrten frustriert auf die Karte hinunter.
Sie waren erschöpft. Ihre Ressourcen gingen zur Neige. Sie hatten schon so viel Zeit fernab von ihren Familien verbracht, von ihren Frauen. Sams Tochter. Nathans Verschwinden hatte sie alle eine Menge Kraft gekostet, und doch würde keiner von ihnen aufgeben, bevor er gefunden und heimgebracht worden war.
»Das ist Schwachsinn«, fuhr Donovan fort. »Ihr könnt mir doch nicht weismachen, dass die alles dransetzen, ihn zu finden.«
Sam hob beschwichtigend die Hand, ließ sie wieder auf den Tisch sinken. Donovan schwieg, aber die Wut hatte ihn nach wie vor fest im Griff. Er drehte sich um und ging zum Fenster, von wo aus man das Grundstück der Kellys überblicken konnte.
Überall entstanden Bauten, die unterschiedlich weit fortgeschritten waren. Weiter hinten lag das Stück Land, das er für sein eigenes Haus ausgewählt hatte, noch unberührt und dicht mit Bäumen bestanden. Wie zum Teufel sollte er sich Gedanken über so ein blödes Haus machen, wenn sein Bruder noch immer verschwunden war? Wie konnte auch nur einer von ihnen an irgendetwas anderes denken?
Alles in der Familie Kelly war zum Stillstand gekommen. Garrett und Sarah wollten erst heiraten, wenn sie wussten, was mit Nathan geschehen war. Wenn die Familie nicht komplett war, gab es wenig Grund zum Feiern.
Die KGI-Teams hatten sich bereits viermal auf die Suche nach Nathan gemacht, die ersten beiden Male ohne Uncle Sams Erlaubnis. Nicht dass sie das auch nur im Geringsten interessiert hätte. Resnick hatte ihnen die Erlaubnis rundheraus verweigert. Er wollte verhindern, dass es zu Kompetenzgerangel zwischen einer privaten und einer von der US-Regierung eingeleiteten Rettungsaktion kam − ganz abgesehen von dem, was passieren würde, wenn KGI diejenigen in die Finger bekam, die ihren Bruder entführt hatten.
Zu dem Zeitpunkt, als sie die offizielle Genehmigung bekamen, bereitete KGI bereits die dritte Mission nach Afghanistan vor. Keinen von ihnen hatte gewundert, dass Uncle Sam ihnen nun zwar nicht mehr Knüppel zwischen die Beine warf, sie aber auch in keinerlei Hinsicht offiziell unterstützte.
»Ihr seid auf euch allein gestellt«, hatte Resnick grimmig gesagt.
Klar doch. Sonst noch was Neues?
Donovan hielt Resnick nicht unbedingt für ein komplettes Arschloch. Ihm waren die Hände gebunden. Es war nicht wie in der Vergangenheit, als die Regierung von den KGI-Missionen profitiert hatte. Diesmal ging es nicht um jemanden, der ganz oben auf der Most-Wanted-Liste der CIA stand. Es war keine Gefahr für die nationale Sicherheit zu erkennen. Es ging nur um einen Bruder, dessen Rettung Donovan nicht vertrauensvoll in die Hände anderer Leute legen würde.
Joe lag noch immer mit Gips im Bett und war unausstehlich, weil er nicht losziehen und seinen Bruder suchen konnte. Offiziell war er noch nicht einmal aus der Armee entlassen, und so hielt ihn Uncle Sam nach wie vor an der kurzen Leine, egal ob er reisetüchtig war oder nicht.
Doch das hinderte ihn nicht daran, seinen Brüdern die Hölle heißzumachen, dass sie Nathan gefälligst da rausholen sollten.
Wenn sie nur gewusst hätten, wo er steckte.
»Donovan, druck mir mal das neueste Satellitenbild aus«, sagte Garrett. »Vielleicht haben wir Glück und entdecken irgendwelche Bewegungen.«
Donovan wandte sich dem Computer zu, den sie Hoss nannten, und beugte sich hinunter, um die Karte aufzurufen. Sie waren erst vor ein paar Tagen zurückgekehrt. Es war ihnen nicht möglich, unbegrenzte Zeit in Afghanistan zu bleiben. Das war zu gefährlich. Sie mussten rein und wieder raus, und das möglichst unauffällig. Aber alles in ihm drängte danach, wieder hinzufliegen. Er hatte das Land nicht verlassen wollen. Nathan war dort. Irgendwo. Und er brauchte sie.
Er druckte die Karte aus, damit er sie mit dem letzten Bild vergleichen konnte, und wollte sich gerade umdrehen, als ihm unten links am Bildschirm das Symbol ins Auge fiel, dass er eine neue E-Mail hatte.
Er rief die Mail auf und sah stirnrunzelnd auf den Absender. Das war niemand, den er kannte. Offensichtlich war es eine dieser gefälschten Hotmail-Adressen, die normalerweise im Spam-Filter hängen blieben.
Dann fiel sein Blick auf den Inhalt, und er erstarrte.
Nathan sagt: Reden Sie mit Joe. Er ist nicht weit von den letzten Koordinaten entfernt. Ich soll Ihnen sagen: Korengal-Tal. Er braucht Ihre Hilfe. Er hält nicht viel länger durch.
Das war es? Meine Güte! In hilfloser Wut starrte Donovan auf die wenigen Worte des Textes. Joe fragen? Als ob sie ihren Bruder nicht schon gnadenlos ausgequetscht hätten! Als ob Joe ihnen nicht schon alles erzählt hätte, was er wusste!
»Verdammte Scheiße!«
Hatte sich Ethan auch so gefühlt, als er Informationen über seine Frau, Rachel, erhalten hatte? Wie zum Teufel sollte er das hier ernst nehmen? Aber wie könnte er es nicht tun? Schließlich hatten die Informationen über Rachel sie damals auch direkt zu ihr geführt.
»Was ist los, Donovan?«, fragte Sam.
Donovan drehte sich langsam zu seinen Brüdern um. »Schaut euch das mal an.«
Nathan lag im Dunkeln und wollte sich zum Ausruhen zwingen, aber jeder Muskel in seinem Körper war angespannt. In den letzten Stunden war der Schmerz zurückgekehrt, aber Nathan war still geblieben, hatte ihren Namen nicht sagen wollen. Er hatte sich nicht einmal erlaubt, ihn zu denken.
Das erforderte eine wahnsinnige Anstrengung, denn er hätte nur zu gern ihre Stimme in seinem Kopf gehört. Er wollte die beruhigende Gegenwart eines anderen menschlichen Wesens spüren. Er sehnte sich nach dem Trost, den nur sie ihm spenden konnte. Aber er wollte nicht, dass sie seine Schmerzen auf sich nahm. Er wollte nicht, dass sie erneut litt.
Und so lag er da und erduldete sowohl körperliche als auch seelische Qualen.
Seine Gedanken kreisten immer nur um Flucht, Rache, Hass und Hoffnungslosigkeit, vor allem aber um Flucht. Er schloss die Augen und stellte sich vor, wie er daheim mit seinen Brüdern am See saß und Bier trank. Moms Essen. Die ruhige Gegenwart seines Vaters. Rachels liebevolles Lächeln. Sogar Rustys große Klappe.
Würde er sie jemals wiedersehen?
Er hielt den Gedanken kaum aus, was seine Familie durchleiden musste. Sie hatten schon so viel durchgemacht, erst Rachels Gefangenschaft, dann die Entführung seiner Mutter. Wie viel mehr würden sie noch aushalten können?
Er schüttelte den Kopf. Es ging nicht darum, wie viel sie aushalten konnten. Die Kellys waren nicht zu erschüttern. Eher musste er sich Sorgen um seine eigene geistige Gesundheit machen. Wie sehr würde er sich verändert haben, wenn er jemals wieder heimkehren sollte?
Du kommst wieder nach Hause, Nathan. Du musst fest daran glauben.
Sein Puls beschleunigte sich, und er setzte sich rasch auf. Seine Hände zitterten, und seine Knie ebenfalls. Sie war wieder da.
Ich habe deinem Bruder die E-Mail geschickt. Allerdings sind das nicht gerade viele Informationen. Ist dir noch irgendetwas eingefallen, was ihnen bei der Suche nach dir helfen könnte?
Nathan beugte sich vor, schlang die Arme um seine Beine und legte den Kopf auf die Knie. Er hasste sich dafür, dass er sofort wieder anfing, sich Hoffnung zu machen. Hoffnung war nicht mehr als Kohle in einem erlöschenden Feuer, die noch einen Rest Hitze in sich trug.
Nathan, rede mit mir. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Ohne Hoffnung kannst du nicht überleben. Wenn du jetzt aufgibst, was sollen deine Brüder dann finden?
Sag ihnen … verdammt, ich weiß es nicht. Ich habe seit ewigen Zeiten kein Tageslicht mehr gesehen. Ich sitze in diesem elenden Loch, und wenn ich nicht hier drinsitze, bearbeiten sie mich in irgendeinem feuchten, schimmeligen Raum. Die meiste Zeit bin ich so orientierungslos, dass ich kaum auseinanderhalten kann, was wirklich ist und was nicht.
Etwas machte »Klick« in seinem Gehirn. Er schloss einen Moment lang die Augen und rief sich das Bild von Taylors Ermordung ins Gedächtnis.
Höhle. Verdammt, ich bin in einer Höhle!
Die Hoffnung, die kurzzeitig aufgeflackert war, erlosch.
Die werden mich hier niemals finden. In diesen Bergen sind überall Höhlen.
Dann musst du fliehen.
Er versuchte zu lachen, brachte aber nur ein raues Keuchen zustande. Du sagst das, als wäre es das Einfachste von der Welt. Glaubst du nicht, ich wäre längst geflohen, wenn ich das könnte? Ich habe es versucht! Und wie ich es versucht habe!
Da hattest du mich noch nicht.
Ihr resoluter Ton ließ ihn auf seinem Selbstmitleidstrip innehalten.
Hast du noch weitere Fähigkeiten? Außer in meinem Kopf zu reden und meine Gedanken zu hören?
Leider nein. Aber wir arbeiten mit dem, was wir haben.
Ich bin ein Idiot! Du hast mir meine Schmerzen abgenommen, und das ist wahrlich keine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, wie du das machst oder warum, aber ich bin sehr dankbar dafür. Ich glaube, ich habe nicht einmal Danke gesagt.
Du hast jetzt wieder Schmerzen.
Er wollte es gerade leugnen, aber dann wurde ihm bewusst, wie absurd es war, etwas abzustreiten, das sie bereits wusste.
Bevor er antworten konnte, spürte er, wie sich Wärme in ihm ausbreitete, bis in sein tiefstes Inneres. Für dieses tröstende Gefühl, das sein Herz und seinen Verstand einlullte, hätte er nicht einmal ein Wort gewusst. Er wollte ihr sagen, sie solle aufhören, sie solle nicht statt seiner leiden, aber er war völlig überwältigt und fast schon wehrlos angesichts der sofort einsetzenden Erleichterung.
Und dann wurde ihm auf einmal bewusst, dass sie zusammengekrümmt dasaß, die Arme um den Körper geschlungen, und leise stöhnte. Ohne sich zu fragen, wie er das fertigbringen sollte, wandte er sich ihr einfach zu und stellte sich vor, wie er sie hielt und ihr in gleicher Weise Trost spendete, wie sie das so selbstlos bei ihm tat.
Sie versteifte sich, war auf einmal vorsichtig und wachsam. Doch dann, als wäre ihr plötzlich klar geworden, wer sie da umarmte, entspannte sie sich.
Sofort stürmte auf ihn ein, wie sie sich anfühlte und wie sie roch. Ihr Duft stieg ihm in die Nase, ein intensiver und willkommener Kontrast zu dem Gestank nach Schweiß, Blut und Tod.
Das Gefühl, sie zu halten, war so echt, dass er die Augen schloss und sich vorstellte, an einem Ort ganz weit weg zu sein. Sie lag warm in seinen Armen, auch wenn sie noch immer von der Anstrengung zitterte, ihm seine Schmerzen genommen zu haben. Ihr Haar strich sanft über seine Wange, und er vergrub sein Gesicht darin, sodass es ihn an der Nase kitzelte.
Er atmete den Duft ihres Haarshampoos tief ein. Geißblattgeruch stieg ihm in die Nase und erinnerte ihn an den Sommer in Tennessee.
Erzähl mir von dir. Du hast gesagt, du steckst in Schwierigkeiten.
Sie versteifte sich, und er fürchtete schon, sie würde sich ihm entziehen. Seine Verbindung zu ihr war das Einzige, was noch von Bedeutung war in seinem momentanen Leben.
Erzähl mir irgendwas, verbesserte er sich rasch. Rede einfach mit mir. Wer bist du? Wieso besitzt du die Fähigkeit, mit mir zu reden, mir meine Schmerzen zu nehmen und meine Gedanken zu hören?
Sie lachte leise. Du willst aber auch gleich alles wissen.
Es ist egal, worüber wir reden. Ich kann nur diese Stille nicht ertragen.
Sie seufzte, und er spürte einen leichten Luftzug im Nacken.
Ich weiß nicht, wie und warum ich diese Fähigkeiten besitze. Ich hatte sie schon immer, zumindest solange ich zurückdenken kann. Meine Mutter wusste schon von Anfang an, dass ich anders bin − zumindest hat sie das behauptet. Sie hat mir eine Geschichte erzählt aus der Zeit, als ich noch ganz klein war. Sie hatte sich beim Kochen die Hand verbrannt, und als sie aufschrie, habe ich nach ihrer Hand gegriffen, weil ich ihr den Schmerz nehmen wollte.
Sie sagte, nachdem ich einen Moment ihre Hand gehalten hatte, hätte ich zu weinen angefangen, und als sie die Hand wegzog, hatte ich in der Handfläche eine absolut identische Brandwunde. Ihr Schmerz war völlig verschwunden, aber wir hatten beide eine Blase.
Schweigend ließ er sich durch den Kopf gehen, was sie ihm da gerade erzählt hatte. Ihm kam ein schrecklicher Verdacht. Heißt das etwa, wenn du mir den Schmerz nimmst, bekommst du auch meine Wunden?
Sie antwortete nicht.
Sag es mir, forderte er.
Was soll ich dir sagen, Nathan? Ja, ich nehme den Schmerz und die Wunden oder Verletzungen, aber sie bleiben nicht. Sie halten bei mir nicht so lange an wie bei dir. Manchmal verschwinden sie schon nach wenigen Stunden.
Verdammt. Ich will nicht, dass du das noch mal machst.
Das ist meine Entscheidung.
Warum? Warum, verdammt noch mal? Du kennst mich nicht. Ich könnte das letzte Arschloch sein. Wieso tust du so etwas für mich, obwohl es dich selbst so schwer belastet?
Weil du mich brauchst.
Weil er sie brauchte. Das war eine Erklärung, die ihm nun wirklich nicht in den Kopf wollte. Sie war so einfach und doch völlig verstörend. Tat denn jemals jemand etwas für einen anderen Menschen, weil der es brauchte? Es war ja nicht so, als würde sie einem hungrigen Kind helfen oder einem Obdachlosen Geld geben. Sie nahm unvorstellbare Schmerzen auf sich, und das aus dem einzigen Grund, weil sie glaubte, dass er sie nicht länger ertragen konnte.