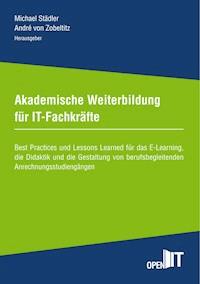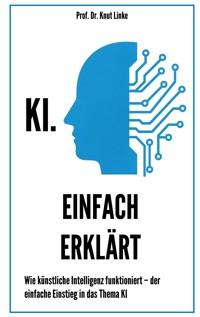
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Künstliche Intelligenz (KI) fasziniert, polarisiert und prägt unseren Alltag - ob als Sprachassistent, im Medizinbereich, bei der Erstellung von Texten und Bildern oder in sozialen Medien. Doch was steckt wirklich dahinter? Nach dem großen Hype und teils diffusen Ängsten bietet dieses Buch einen klaren, verständlichen und aktuellen Überblick über das, was KI heute ist - und was nicht. Sie erhalten Antworten auf zentrale Fragen: * Was ist eigentlich Intelligenz? Wie unterscheiden sich Menschen und Maschinen? * Wie funktioniert KI in der Praxis (Trainingsdaten, neuronale Netze, Deep Learning, Transformers)? * Wie wird KI-Leistung gemessen - und kann sie als intelligent gelten? * Was leisten heutige KI-Anwendungen wie ChatGPT, Midjourney & Co., wo liegen ihre Grenzen? * Wie bringt man KI dazu, genau das zu tun, was man will (Prompting)? * Welche Chancen und Risiken bringt KI für Wirtschaft, Medizin, Bildung und Gesellschaft? * Wie sieht ein kritischer, reflektierter Umgang mit KI aus? Dieses Buch richtet sich gezielt an neugierige Einsteiger, Berufstätige in verschiedensten Branchen, Bildungspersonal und alle, die sich nicht von Technik überrollen lassen, sondern KI als Werkzeug aktiv in ihren Alltag integrieren wollen. Fachbegriffe werden verständlich erklärt, Zusammenhänge klar dargestellt - ohne unnötigen Ballast, aber mit der Tiefe, die für einen echten Durch- und Weitblick nötig ist. Ob Sie KI bereits im Alltag begegnen, beruflich profitieren oder gesellschaftlich mitdiskutieren wollen; dieses Buch macht Sie fit für die Anforderungen und Chancen der digitalen Transformation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Das Geheimnis des Erfolges ist es, den Benutzer zu verstehen.«
HAL 9000
Inhaltsverzeichnis
Willkommen in der faszinierenden Welt der Intelligenz
Von der natürlichen zur künstlichen Intelligenz
Die Basis der KI: Daten, Algorithmen und das Streben nach Fairness
Im Gehirn der KI: Neuronale Netze und Deep Learning
Im Detail: Wie funktioniert eine KI wie ChatGPT?
Generative KI: Wie ChatGPT, Midjourney & Co. die Welt verändern
Wie wird eigentlich die Intelligenz einer KI gemessen?
Prompting oder auch: Das richtige Wort zur richtigen Zeit
KI im Einsatz: Die gesellschaftlichen Auswirkungen
KI als Chance: Der Gestaltungsauftrag für uns alle
Zum Abschluss: Ihr Aufbruch
1
WILLKOMMEN IN DER FASZINIERENDEN WELT DER INTELLIGENZ
Stellen Sie sich vor, Ihr Smartphone schlägt Ihnen nicht nur den schnellsten Weg zur Arbeit vor, sondern warnt Sie auch proaktiv vor einem Stau, den noch keine Nachrichtenagentur gemeldet hat. Oder denken Sie an Serienempfehlungen auf Streaming-Plattformen, die wie magisch genau Ihren Geschmack treffen. Hinter all diesen kleinen und großen Alltagshelfern steckt oft ein und dasselbe Phänomen: Künstliche Intelligenz, kurz KI.
Der Begriff KI ist in aller Munde, manchmal klingt er nach ferner Zukunftsmusik, manchmal fast schon bedrohlich. Doch was verbirgt sich dahinter? Im Grunde geht es darum, Computern und Maschinen Fähigkeiten beizubringen, die wir normalerweise mit menschlicher Intelligenz verbinden: Lernen, Probleme lösen, Entscheidungen treffen, Sprache verstehen oder sogar kreativ sein. KI ist also kein bestimmtes Gerät oder eine einzelne Software, sondern ein riesiges Forschungsfeld innerhalb der Informatik, das sich mit der Entwicklung solcher „denkender“ Systeme beschäftigt.
Wenn wir über KI sprechen, lohnt es sich, zuerst einen Schritt zurückzutreten und einen Blick auf das große Ganze zu werfen: Was ist eigentlich Intelligenz? Warum sind wir Menschen so fasziniert von dieser Eigenschaft, und wie unterscheiden sich unser Gehirn und ein Computer, wenn es darum geht, die Welt zu begreifen und darin zu handeln?
Intelligenz ist weit mehr als nur die Fähigkeit, blitzschnell Kopfrechnen zu können oder knifflige Logikrätsel zu lösen. Im Kern beschreibt sie die Fähigkeit, Probleme zu lösen, neues Wissen zu erwerben, daraus zu lernen und dieses Wissen dann flexibel in neuen und unbekannten Situationen anzuwenden. Wir Menschen lernen Sprachen, erkennen die Gesichter unserer Freunde in einer Menschenmenge, finden kreative Lösungen für unerwartete Herausforderungen oder denken uns komplexe Geschichten aus – all das sind Fähigkeiten, die uns als intelligente Wesen auszeichnen.
Aber wie beschreiben Forscher eigentlich Intelligenz?
Schon seit Langem haben sich Psychologen, Philosophen und Wissenschaftler den Kopf darüber zerbrochen, was Intelligenz im Kern ausmacht. Dabei kristallisieren sich oft drei grundlegende Fähigkeiten heraus, die entscheidend dafür sind, wie wir (und potenziell auch Maschinen) die Welt um uns herum erfassen und darauf reagieren:
Lernen: Das ist die fundamentale Fähigkeit, neue Informationen aufzunehmen, sie zu verarbeiten, mit bereits vorhandenem Wissen zu verknüpfen und daraus Schlüsse für zukünftiges Denken und Handeln zu ziehen. Ohne Lernen gäbe es keinen Fortschritt, keine Anpassung.
Schlussfolgern: Hier geht es um die Kunst, auf Basis von vorhandenem Wissen und logischen Regeln zu neuen Erkenntnissen, sinnvollen Konsequenzen oder fundierten Entscheidungen zu gelangen. Es ist das Werkzeug, mit dem wir aus Bekanntem auf Unbekanntes schließen.
Selbstkorrektur: Eine oft unterschätzte, aber enorm wichtige Eigenschaft. Sie beschreibt die Fähigkeit, eigene Fehler zu erkennen, bisherige Annahmen und Überzeugungen kritisch zu hinterfragen und sich flexibel an neue Gegebenheiten, Informationen oder Erkenntnisse anzupassen. Wer nicht bereit ist, sich zu korrigieren, bleibt stecken.
Es wird deutlich: Intelligenz ist kein eindimensionales Konstrukt, das sich allein auf das Lösen von Matheaufgaben oder einen besonders hohen Wert im Intelligenzquotienten (IQ) reduzieren lässt. Moderne wissenschaftliche Ansätze betonen immer wieder die beeindruckende Vielseitigkeit und Komplexität von dem, was wir Intelligenz nennen.
Der Versuch, Intelligenz messbar zu machen, hat zur Entwicklung verschiedener Modelle und Tests geführt. Neben dem bekannten IQ-Modell, das bestimmte kognitive Fähigkeiten erfasst, gibt es eine Reihe spannender weiterer Sichtweisen, die uns helfen, die erstaunliche Bandbreite menschlicher Klugheit besser zu verstehen:
Der amerikanische Psychologe Howard Gardner hat mit seiner Theorie der multiplen Intelligenzen für viel Aufsehen gesorgt. Er argumentiert überzeugend, dass es nicht die eine universelle Intelligenz gibt, sondern eine ganze Palette unterschiedlicher, relativ unabhängiger Talente. Ursprünglich beschrieb er sieben Talente. Dazu gehören beispielsweise:
Linguistische Intelligenz: Die Fähigkeit, Sprache gekonnt einzusetzen (Schriftsteller, Redner).
Logisch-mathematische Intelligenz: Die Fähigkeit, logisch zu denken, Zahlen zu verstehen und wissenschaftliche Probleme zu lösen (Wissenschaftler, Mathematiker).
Räumliche Intelligenz: Die Fähigkeit, räumliche Beziehungen wahrzunehmen und sich Dinge im Raum vorzustellen (Architekten, Künstler).
Musikalische Intelligenz: Die Fähigkeit, Musik zu verstehen, zu komponieren und aufzuführen (Musiker, Komponisten).
Körperlich-kinästhetische Intelligenz: Die Fähigkeit, den eigenen Körper geschickt einzusetzen und Bewegungen zu koordinieren (Sportler, Tänzer, Handwerker).
Interpersonale Intelligenz: Die Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen, ihre Motive und Gefühle zu erkennen und gut mit ihnen zu interagieren (Lehrer, Therapeuten, Verkäufer).
Intrapersonale Intelligenz: Die Fähigkeit, sich selbst, die eigenen Gefühle, Stärken und Schwächen zu verstehen (Philosophen, Psychologen).
Später fügte Gardner noch die naturalistische Intelligenz hinzu – die Fähigkeit, Muster in der Natur zu erkennen und zu verstehen (Biologen, Gärtner).
Robert Sternbergs Triarchische Theorie der Intelligenz ist ein weiteres einflussreiches und erwähnenswertes Modell. Dieses hebt drei Hauptformen hervor, die im Zusammenspiel unsere Intelligenz ausmachen sollen:
Analytisches Denken: Dies entspricht oft dem, was in akademischen Kontexten und IQ-Tests gemessen wird – die Fähigkeit, Probleme zu analysieren, Informationen zu bewerten und logische Schlüsse zu ziehen.
Kreatives Denken: Hier geht es darum, neue Ideen zu entwickeln, originelle Lösungswege für Probleme zu finden und flexibel mit neuartigen Situationen umzugehen.
Praktisches Denken: Oft auch als Alltagsintelligenz oder „Street Smart“ bezeichnet, beschreibt diese Form die Fähigkeit, alltägliche Probleme effektiv zu meistern, sich geschickt an die Umwelt anzupassen und Wissen in praktischen Kontexten anzuwenden.
Für Sternberg sind also nicht nur abstrakte Logik und akademische Fähigkeiten entscheidend, sondern auch die Fähigkeit, im echten Leben zurechtzukommen und innovative Einfälle zu haben.
Ein weiteres wichtiges Modell, das oft in der Intelligenzforschung zitiert wird, stammt von Raymond Cattell, welches er später zusammen mit seinem Studenten John Horn erweitert. Cattell unterscheidet zwischen zwei grundlegenden Arten von Intelligenz:
Fluide Intelligenz: Das ist die angeborene Fähigkeit, neuartige Probleme zu lösen, flexibel und abstrakt zu denken, Muster zu erkennen und logische Schlüsse zu ziehen - und das weitgehend unabhängig von bereits erworbenem Wissen oder kulturellen Einflüssen. Sie ist unser „geistiger Motor“.
Kristalline Intelligenz: Diese Form der Intelligenz bezieht sich auf unser im Laufe des Lebens erworbenes Wissen, unsere Erfahrungen, kulturellen Kenntnisse und die Fähigkeiten, die wir uns angeeignet haben (zum Beispiel Wortschatz, Allgemeinwissen). Sie ist das Ergebnis von Lernen und Erfahrung.
Interessanterweise kann die fluide Intelligenz im Laufe des Lebens, besonders im höheren Alter, tendenziell abnehmen, während die kristalline Intelligenz oft bis ins hohe Alter stabil bleiben oder sogar noch zunehmen kann. Viele klassische IQ-Tests versuchen, vor allem diese beiden Formen der Intelligenz zu erfassen und zu quantifizieren.
Wenn wir gerade schon von IQ-Tests schreiben: Was misst ein IQ-Test eigentlich und was bleibt bei einem IQ-Test meistens außen vor?
IQ-Tests sind standardisierte psychologische Werkzeuge, die versuchen, bestimmte kognitive Fähigkeiten messbar zu machen und mit den Ergebnissen einer repräsentativen Vergleichsgruppe (der Normgruppe) in Beziehung zu setzen. Typischerweise prüfen sie verschiedene Bereiche, darunter:
Logisches Denken und Problemlosen: Das kann das Erkennen von Mustern in Zahlenoder Figurenreihen sein, das Lösen von logischen Schlussfolgerungsaufgaben oder Aufgaben, die Abstraktionsvermögen erfordern.
Verbale Fähigkeiten: Hier wird oft der Wortschatz geprüft, das Verstehen von Texten, das Erkennen von Wortbedeutungen (zum Beispiel Synonyme oder Antonyme) oder die Fähigkeit, sprachliche Analogien zu bilden.
Räumliches Vorstellungsvermögen: Getestet wird die Fähigkeit, Objekte im Kopf zu drehen und zu manipulieren, räumliche Beziehungen zwischen Objekten zu erkennen oder Puzzles zu lösen.
Arbeitsgedächtnis: Wie gut können wir Informationen kurzfristig speichern und gleichzeitig mental bearbeiten? Ein klassisches Beispiel ist das Rückwärtsaufsagen einer zuvor gehörten Zahlenreihe.
Verarbeitungsgeschwindigkeit: Wie schnell und genau können relativ einfache kognitive Aufgaben unter Zeitdruck erledigt werden, beispielsweise das schnelle Zuordnen von Symbolen zu Zahlen.
Diese Bereiche kommen Ihnen vielleicht schon etwas bekannt vor, oder?
Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein IQ-Wert ist immer nur ein Ausschnitt der gesamten menschlichen Intelligenz.
Viele andere entscheidende Aspekte unserer Klugheit und unserer Fähigkeiten bleiben bei solchen standardisierten Tests meist unberücksichtigt. Dazu gehören beispielsweise:
Kreativität: Die Fähigkeit, originelle Ideen zu haben und neue Lösungswege zu finden.
Emotionale Intelligenz: Wie gut wir unsere eigenen Gefühle und die Emotionen anderer Menschen wahrnehmen, verstehen, ausdrücken und regulieren können. Konzepte wie die Emotionale Intelligenz (EQ), populär gemacht durch Daniel Goleman, haben hier große Bekanntheit erlangt.
Soziale Intelligenz: Unsere Fähigkeit, erfolgreich mit anderen Menschen zu interagieren, Beziehungen aufzubauen und soziale Situationen geschickt zu meistern.
Praktische Alltagsintelligenz: Das Geschick, sich im täglichen Leben zurechtzufinden, Probleme des Alltags zu lösen und sich an die Umwelt anzupassen.
Deshalb betonen moderne Intelligenzmodelle, wie die von Gardner oder Sternberg, und auch die Bildungsforschung immer wieder: Intelligenz ist ein unglaublich vielschichtiges Phänomen. Sie wird nicht nur von angeborenen Anlagen bestimmt, sondern auch stark von unserer Kultur, unserer Erziehung, unseren persönlichen Erfahrungen und dem gesellschaftlichen Umfeld, in dem wir aufwachsen und leben, geprägt.
Im Alltag, in der Schule oder im Berufsleben bedeutet Intelligenz oft weit mehr als nur einen hohen IQ-Wert zu haben. Es geht darum, sich neues Wissen effektiv anzueignen, gut mit anderen Menschen auszukommen, deren und die eigenen Gefühle zu verstehen und zu berücksichtigen, oder auch verantwortungsvolle und nachhaltige Entscheidungen für sich und die Gemeinschaft zu treffen. Auch kulturelle Werte spielen eine riesige Rolle: Was in einer Gesellschaft als besonders „intelligent“, erstrebenswert oder bewundernswert gilt, kann sich weltweit erheblich unterscheiden.
2
VON DER NATÜRLICHEN ZUR KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ
Mit diesem breiten und facettenreichen Verständnis von menschlicher Intelligenz im Hinterkopf wird schnell klar: Es ist eine gewaltige und unglaublich komplexe Herausforderung, Maschinen „intelligent” zu machen und ihnen Fähigkeiten zu verleihen, die auch nur annähernd an die menschliche Intelligenz heranreichen. Entwickler von KI-Systemen müssen daher nicht nur brillante Experten in Informatik sein, sondern greifen oft auch auf tiefgreifende Erkenntnisse aus der Mathematik, Statistik, Psychologie (wie lernen und entscheiden Menschen?), Linguistik (wie funktioniert Sprache?), Neurowissenschaften (wie ist das Gehirn aufgebaut?) und sogar aus der Soziologie und Philosophie zurück.
Künstliche Intelligenz (KI), so wie wir sie heute im Allgemeinen verstehen, ist ein faszinierendes und sich rasant entwickelndes Teilgebiet der Informatik. Im Kern beschäftigt sie sich damit, wie Computer und die von ihnen gesteuerten Systeme (wie Roboter oder Softwareanwendungen) Aufgaben lösen können, die typischerweise menschenähnliche Intelligenz erfordern – also zum Beispiel lernen, schlussfolgern, Probleme lösen, Sprache verstehen, Muster erkennen und sich bei Bedarf selbst korrigieren.
Im weiteren Sinne, und oft auch im alltäglichen Sprachgebrauch, umfasst der Begriff KI alles, was ein Computerprogramm oder eine Maschine tun kann, dass uns irgendwie „intelligent“ erscheint oder das bislang der „echten“ menschlichen Intelligenz vorbehalten schien. Wir nennen eine Software oft schon dann „intelligent“, wenn sie uns komplexe oder lästige Aufgaben abnimmt, die wir ursprünglich uns selbst oder anderen Menschen vorbehalten hätten.
Wirklich spannend und revolutionär wird KI im engeren wissenschaftlichen Sinn aber erst dann, wenn sie nicht nur stur vorprogrammierte Regeln und Anweisungen abarbeitet, sondern wenn sie eigene Lösungswege findet, sich flexibel an neue und unbekannte Herausforderungen anpassen kann und vor allem aus Erfahrung lernt, um ihre Leistung kontinuierlich zu verbessern.