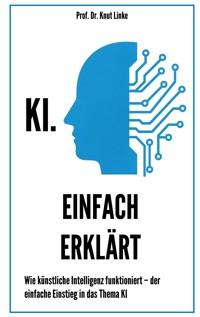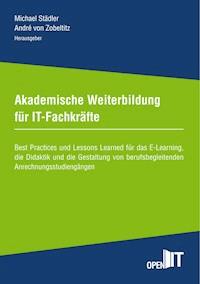
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Schriftenreihe: Hochschule Weserbergland
- Sprache: Deutsch
Im Rahmen der Bund-Länder-Initiative "Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen" wurden an der Hochschule Weserbergland in Zusammenarbeit mit dem Institut für Soziologie der TU Darmstadt spezielle Anrechnungsstudiengänge für IT-Fachkräfte entwickelt und erprobt. Dieses Buch fasst wesentliche Erkenntnisse der verschiedenen Projektbeteiligten im Sinne von Best Practices und Lessons Learned zum Ende der ersten Förderphase zusammen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schriftenreihe Hochschule Weserbergland
Band 1
Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter den Förderkennzeichen 16OH21005 und 16OH21006 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den AutorInnen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Das Forschungsprojekt „Open IT“ und die Bedeutung für IT-PraktikerInnen mit abgeschlossener IT-Erst- und Zweitausbildung
Michael Städler, André von Zobeltitz, Knut Linke
Rechtliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Anrechnungsstudiengängen in Deutschland und speziell in Niedersachsen im Jahr 2017
Michael Städler, Eva Blochberger, Mario Stephan Seger
Vom L3 AnrechnungsManagementSystem zur bundesweiten Anrechnungs- und Anerkennungsdatenbank
Mario Stephan Seger
Individuelle und pauschale Anrechnung und Anerkennung – Erfahrungen der Hochschule Weserbergland und aus den „Open IT“ Anrechnungsstudiengängen
Knut Linke, Kathleen Blanke, Ramona Salzbrunn
Anrechnungsstudiengänge – eine Herausforderung für berufsausgebildete PraktikerInnen und Hochschulen?
André von Zobeltitz, Knut Linke
Best Practices für die didaktische Gestaltung von berufsbegleitenden Anrechnungsstudiengängen
Eva Blochberger, Lasse Bönick, Sophie Huck, André von Zobeltitz
Die zeitliche Abfolge und Ausrichtung der ersten Semester für berufsbegleitende Anrechnungsstudiengänge
Lasse Bönick, Sophie Huck, André von Zobeltitz
Best Practices für die Gestaltung von E-Learning-Angeboten für berufsbegleitende Anrechnungsstudiengänge
Knut Linke, Sophie Huck, Eva Blochberge
r
Ideen für die zukünftige Unterstützung der Nutzung von E-Learning-Angeboten an der Hochschule Weserbergland und im Forschungsprojekt „Open IT“
Knut Linke, Jasmin Wrede, Lasse Bönick
Die standardisierte und zukunftsfähige Weiterbildung von Lehrkräften in Didaktik und E-Learning am Beispiel der Hochschule Weserbergland
Michael Städler, Eva Blochberger, Hans Ludwig Meyer
Über die Herausgeber und Autoren
Vorwort
Die akademische Weiterbildung von IT-Fachkräften ist angesichts der fortschreitenden Digitalisierung aller Branchen und des anhaltenden Fachkräftemangels in diesem Feld eines der großen Zukunftsthemen unserer Gesellschaft. Im Rahmen der Bund-Länder-Initiative „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ konnte die Hochschule Weserbergland zusammen mit ihrem Projektpartner – dem Institut für Soziologie der Technischen Universität Darmstadt, namentlich Herrn Dr. Mario Stephan Seger – von August 2014 bis Januar 2018 spezielle Anrechnungsstudiengänge für IT-Fachkräfte entwickeln und erproben. Ziel war und ist es, dass die beruflichen Kompetenzen der Zielgruppe derart gewürdigt werden, dass keine unnötigen – weil bekannten – Themen „noch einmal“ im Studium wiederholt werden und dass dadurch eine substanzielle Studienzeitverkürzung erzielt werden kann, ohne dass die Befähigung zum analytisch-wissenschaftlichen Arbeiten darunter leidet.
Dieses Buch fasst wesentliche Erkenntnisse der verschiedenen Projektbeteiligten im Sinne von Best Practices und Lessons Learned zum Ende der ersten Förderphase zusammen. Die Erprobung der entwickelten Studiengänge befindet sich zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Herausgeberbandes auf „halber Strecke“. Auch wenn das Projekt erst Mitte 2020 abgeschlossen sein wird, wollen wir mit diesem Buch unsere ersten Erkenntnisse mit der wissenschaftlichen wie berufspraktischen Öffentlichkeit teilen. Der/Die LeserIn darf im Übrigen einen abschließenden Band im Jahr 2020 erwarten!
Insgesamt erwartet den/die LeserIn ein „bunter Strauß“ an Themen, angefangen bei der Darstellung der Zielgruppen über rechtliche Rahmenbedingungen bis hin zu Besonderheiten von Anrechnungsstudiengängen hinsichtlich ihrer organisatorischen, zeitlichen und fachlichen Ausgestaltung. Selbstverständlich werden auch Erfahrungen aus der didaktischen Umsetzung sowie die spezifischen Anforderungen an die Lehrenden angesprochen.
Wir möchten allen AutorInnen dieses Buches herzlich für ihre Beiträge und die reibungslose Zusammenarbeit danken.
Die Druck- und Verlagskosten wurden im Rahmen der Bund-Länder-Initiative „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ finanziert. Dafür möchten wir dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Projektträger VDI/VDE Innovation + Technik GmbH danken.
Wir danken ebenfalls den Mitgliedern des Projektbeirats Herrn Jörg Ferrando (Ressort Bildungs- und Qualifizierungspolitik, IG Metall Vorstand), Herrn Dierk Harder (ComPers GmbH), Frau Monika Hartmann-Bischoff und Herrn Helmar Hanak (beide Servicestelle Offene Hochschule gGmbH), Herrn Jochen Reinecke (DIHK), Herrn Michael Royar (eXirius IT Dienstleistungen GmbH), Herrn Prof. Dr. Rudi Schmiede (Technische Universität Darmstadt) sowie Herrn Henrik Schwarz (Bundesinstitut für Berufsbildung) für ihre konstruktive Unterstützung und die angenehme Zusammenarbeit.
Danken möchten wir ferner Frau Dorothee Mareike Emsel (Magister der Germanistik) und Frau Nora Pierau (Master of Arts) für die Übernahme des Lektorats und die mühevolle Detailarbeit bei der begrifflichen Angleichung verschiedener Beiträge der recht ansehnlichen Anzahl von AutorInnen.
Ein besonderer Dank geht an Herrn Knut Linke (MBA, M. Comp. Sc.), der durch seinen großen organisatorischen Einsatz dieses Manuskript technisch in sehr kurzer Zeit „auf die Beine gestellt“ hat.
Bei Interesse an dem Forschungsprojekt freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme über die Projekthomepage www.offene-hochschule.org und einen konstruktiven Austausch.
Hameln, im Januar 2018
Michael Städler, André von Zobeltitz
1. Das Forschungsprojekt „Open IT“ und die Bedeutung für IT-PraktikerInnen mit abgeschlossener IT-Erst- und Zweitausbildung
Michael Städler, André von Zobeltitz, Knut Linke
Ziele des Vorhabens
Im Zentrum des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens „Open IT Bachelor und Open IT Master“ steht die Entwicklung und Erprobung spezieller Anrechnungsstudiengänge für IT-PraktikerInnen. Ergebnisse sind zum einen das 3-jährige berufsbegleitende Bachelorprogramm „Wirtschaftsinformatik“ für IT-Erstausgebildete. Zum anderen wird ein auf IT-Professionals ausgerichtetes 2-jähriges berufsbegleitendes Bachelorprogramm „IT Business Management“ sowie ein daran anschließendes 1,5-jähriges berufsbegleitendes Masterprogramm „IT Business Management“ entwickelt und erprobt.
Die genannten Studiengänge wurden und werden vor dem Hintergrund von zwei Forschungsfragen entwickelt. Zunächst steht die Überlegung im Mittelpunkt, welchen beruflichen Anforderungen IT-MitarbeiterInnen in klein- und mittelständischen Unternehmen zum Ende der nächsten Dekade nachkommen müssen, um weiterhin wettbewerbsfähig Kundenansprüche erfüllen zu können. Zudem wird analysiert, welche Strukturen und Abläufe in berufsbegleitenden Studienprogrammen förderlich sind, um zukünftige berufliche Anforderungen an IT-PraktikerInnen qualitätsgesichert in diese Programme integrieren zu können.
Im Bachelorprogramm werden die Studierenden die für WirtschaftsinformatikerInnen üblichen Kompetenzen erwerben, welche ihnen vor dem Hintergrund ihrer bisherigen Bildungskarriere ggfs. noch fehlen. Hierbei wird insbesondere ein Fokus auf die Entwicklung analytischer und wissenschaftlicher Kompetenzen gelegt. Die MasterabsolventInnen sollen auf Führungspositionen in der Informations- und Kommunikationstechnik-Branche (IKT-Branche) bzw. auf die Geschäftsführung in KMU aus der IKT-Branche vorbereitet werden. Daher sollen im Masterstudium die nötigen Controlling-, Projektmanagement- und Personalführungskompetenzen aufgebaut werden. Darüber hinaus werden die Studierenden mit wählbaren Vertiefungsrichtungen u.a. auf Herausforderungen in digitalisierten Arbeitsumfeldern vorbereitet.
Das Projekt verfolgt das Ziel der gleichwertigen beruflichen Chancen für beide Geschlechter. So werden alle Angebote so entwickelt, dass sowohl Frauen als auch Männer auf der Basis von Anrechnung beruflicher Vorqualifikationen die berufsbegleitenden Bachelorprogramme „Wirtschaftsinformatik“ und „IT Business Management“ absolvieren können. Durch die Implementierung individueller Anrechnungsverfahren − im Forschungsprojekt unterstützt durch die L3AMS-Software1 − hat das Projekt darüber hinaus das Ziel, den Abbau von Benachteiligungen sowie eine freie, selbstbestimmte Lebensgestaltung beider Geschlechter zu ermöglichen. So können insbesondere Frauen ohne eine IT-Erstausbildung, welche den Abschluss des Operativen Professionals erworben haben, also über nichtlineare Lebensläufe verfügen, das entwickelte Studienangebot nutzen.
In Bezug auf die Studierenden ist das zentrale Ziel von „Open IT Bachelor und Open IT Master“, auf der Grundlage vielfältiger flankierender Maßnahmen – u.a. Beratung, Self-Assessment, pauschale Anrechnung, individuelle Anrechnung, Brückenkurse, Blended-Learning, virtuelle Klassenräume – berufspraktisch vorgebildete Studieninteressierte (je nach Ausprägung der Vorqualifikation) in zwei Jahren („IT Business Management“) bzw. in maximal drei Jahren („Wirtschaftsinformatik“) berufsbegleitend zum Abschluss des Bachelorprogramms bzw. in maximal weiteren 1,5 Jahren zum Abschluss des Masterprogramms („IT Business Management“) zu führen.
In Bezug auf die Konzeption der Studienprogramme strebt das Forschungsprojekt die Entwicklung nachhaltig implementierbarer Angebote an. Die Studienangebote von „Open IT Bachelor und Open IT Master“ sollen mit individuellen Anrechnungs- und Studienplänen für die bisherigen wie auch für die zukünftigen novellierten IT-Berufe aufwarten können. Anders ausgedrückt: Im Hinblick auf die nachhaltige Angebotssicherung soll das Studienangebot von „Open IT“ zukunftsorientiert am Markt der heutigen als auch der ab 2019 IHK-ausgebildeten Klientelen ausgerichtet sein.
Resultierende Strukturen der erarbeiteten Anrechnungsstudiengänge
Die durch die gewählte Anrechnungsstruktur erzielte Verkürzung der Studiendauer für Studierende mit einer IT-Erstausbildung wird im Folgenden kurz skizziert. Die identifizierten Anrechnungspotentiale für Personen mit einer Ausbildung zum/zur IT-System-ElektronikerIn sind die Module „Netzwerktechnik“, „Grundlagen der VWL“, „Rhetorik und Präsentation“, „Grundlagen des Projektmanagements“, „Grundlagen der Programmierung“, „Informatik-Praktikum“, „Grundlagen der Informatik“, „Erfahrungen aus der Berufspraxis“ sowie „IT-Systemelektronik“. Es ist in der Folge ein Angleichungssemester notwendig, um alle Studierenden auf einen einheitlichen Kenntnisstand zu bringen (siehe folgende Abbildung).
Abbildung 1: Anrechnung IT-System-ElektronikerIn (eigene Darstellung)
Die identifizierten Anrechnungspotentiale für Personen mit einer Ausbildung zum/zur FachinformatikerIn Systemintegration, Informatik-Kaufmann/-frau und IT-System-Kaufmann/-frau sind die Module „Netzwerktechnik“, „Hardware- und Systemarchitekturen“, „Betriebssysteme“, „Grundlagen der VWL“, „Rhetorik und Präsentation“, „Grundlagen des Projektmanagements“, „Informatik-Praktikum“, „Grundlagen der Informatik“ sowie „Erfahrungen aus der Berufspraxis“. Auch für diese Erstausbildungen ist somit ein Angleichungssemester notwendig, um alle Studierenden auf einen einheitlichen Kenntnisstand zu bringen (siehe folgende Abbildung).
Abbildung 2: Anrechnung FachinformatikerIn Systemintegration, Informatikkaufmann/-frau; IT- System-Kaufmann/-frau (eigene Darstellung)
Die identifizierten Anrechnungspotentiale für Personen mit einer Ausbildung zum/zur FachinformatikerIn Anwendungsentwicklung sind die Module „Grundlagen der Programmierung“, „Datenbanken“, „Grundlagen der VWL“, „Rhetorik und Präsentation“, „Grundlagen des Projektmanagements“, „Informatik-Praktikum“, „Grundlagen der Informatik“ sowie „Erfahrungen aus der Berufspraxis“. Auch für diese Erstausbildungen ist somit ein Angleichungssemester notwendig, um alle Studierenden auf einen einheitlichen Kenntnisstand zu bringen (siehe folgende Abbildung).
Abbildung 3: FachinformatikerIn, Fachrichtung Anwendungsentwicklung (eigene Darstellung)
Die nachfolgende Tabelle zeigt als Überblick die ermittelten Anrechnungspotentiale für die jeweiligen Erstausbildungen.
Anrechnung mit der Zweitausbildung „Operative Professional“
Die Logik bei der Berücksichtigung verschiedener Zielgruppen bei der Anrechnung von Kompetenzen der IT-Professionals (IT-Meister-Ebene) verhält sich analog zu der bei den IT-Erstausgebildeten. Da die IT-MeisterInnen noch mehr Kompetenzen als diese einbringen, fällt im Ergebnis der Umfang der Anrechnungsmodule höher aus. Die folgenden Abbildungen veranschaulichen zunächst die pauschalen Anrechnungsoptionen. Hier werden neben den jeweiligen Anrechnungspotentialen aus der IT-Erstausbildung zusätzlich die Module „Zeit- und Selbstmanagement“, „Mitarbeiterführung“, „Personalmanagement“, „Arbeitsrecht“ sowie ein Wahlpflichtfach angerechnet. Insgesamt ergibt sich so ein Anrechnungspotenzial von 89 ECTS-Punkten aus beruflicher Bildung. Daraus folgt eine lediglich 2-jährige Studiendauer mit einem Schwerpunkt in den wissenschaftlich-methodischen Studienfächern. Lediglich 91 ECTS-Punkte müssen noch regulär durch das Absolvieren der Studienmodule erworben werden. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass in diesem Fall eine individuelle Anrechnung nicht mehr sinnvoll greifen kann, da lediglich ein weiterer ECTS-Punkt angerechnet werden könnte.
Abbildung 4: Pauschale Anrechnung Bachelor IT Business Management (eigene Darstellung)
Abbildung 5: Studieninhalte Bachelor IT Business Management (eigene Darstellung)
Fazit
Die im Forschungs- und Entwicklungsvorhaben „Open IT Bachelor und Open IT Master“ entwickelten Anrechnungsstudiengänge haben für die adressierte Zielgruppe eine hohe Bedeutung. Die Anrechnung von verschiedenen Modulen ermöglicht einen schnelleren Studienabschluss. Durch diesen zeitlichen Vorteil entscheiden sich ggf. mehr Personen den akademischen Weg anzustreben, da mit einer besseren Integration in das Berufsleben auch eine geringere Beeinträchtigung des Privatlebens einhergeht. Dennoch wird in der verkürzten Studienzeit der akademische Anspruch gewahrt. Darüber hinaus ermöglicht eine individuelle Anrechnungsprüfung auch Personen mit nichtlinearen Lebensläufen einen Zugang zu den entwickelten Programmen. Das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben leistet somit einen konkreten Beitrag zur Öffnung der Hochschullandschaft für BerufspraktikerInnen.
Nachdem im vorangegangenen Beitrag insbesondere die Ziele des Forschungsvorhabens sowie die grundlegende Konzeption der Studienprogramme im Fokus standen, widmet sich der nachfolgende Beitrag den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Entwicklung von Anrechnungsstudiengängen, insbesondere auf Basis der Lissabon-Konvention.
1 Siehe Kapitel 3 "Vom L3 AnrechnungsManagementSystem zur bundesweiten Anrechnungs- und Anerkennungsdatenbank" in dieser Veröffentlichung.
2. Rechtliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Anrechnungsstudiengängen in Deutschland und speziell in Niedersachsen im Jahr 2017
Michael Städler, Eva Blochberger, Mario Stephan Seger
Überblick
Die Themen „Anrechnung außerhochschulischer Kompetenzen“ und „Anerkennung hochschulischer Kompetenzen“ waren insbesondere in den letzten Jahren auch und gerade in rechtlicher Perspektive einer großen Dynamik unterworfen. Die Themenbereiche bewegen sich in einem komplexen Feld aus Gesetzgebungen und Regelungen, z.B. im Kontext der Akkreditierung. Um hier einen strukturierten Überblick zu geben, werden relevante Gesetze in ihrer hierarchischen Rangfolge beschrieben. Dementsprechend beginnt die Erläuterung mit der Thematisierung der Lissabon-Konvention, eine Regelung auf Ebene der Europäischen Union. Darauffolgend wird die nationale Gesetzlage analysiert. Hierbei wird das Hochschulrahmengesetz betrachtet. Aufgrund der föderalen Struktur in Deutschland existiert auf nationaler Ebene das Hochschulrahmengesetz, welches auf Länderebene durch die entsprechenden Landeshochschulgesetze spezifiziert wird. Zuletzt gelten die entsprechenden Regelungen wie etwa Studien- und Prüfungsordnungen der jeweiligen Hochschule.
Lissabon-Konvention
Das „Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region“ (Bundesgesetzblatt, 2007, S. 712ff.), welches auch kurz als „Lissabon-Konvention“ bezeichnet wird, gilt seit dem 16. Mai 2007. Damit wurde eine europäische Grundlage zur Bewerbung auf Studienplätze sowie die Anerkennung von Studienleistungen zwischen Hochschulen gelegt. Im Rahmen der europäischen Gemeinschaft soll die Lissabon-Konvention ein flexibles Studieren ermöglichen. Im Folgenden sollen relevante Artikel aus dem entsprechenden Gesetz aufgelistet und in Zusammenhang gestellt werden. Die Auswahl folgt dem ASIIN-Newsletter (ASIIN e.V., 2011, S. 5f.), dem auch andere Autoren, wie beispielsweise Seger, Waldeyer, Leibinger (2017), im Rahmen der Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Anerkennung von Studienleistungen gefolgt sind.
Vor allem der Artikel III.1 (Bundesgesetzblatt, 2007, S. 718) und auch die Artikel in „Abschnitt VI Anerkennung von Qualifikationen, die den Zugang zur Hochschulbildung ermöglichen“ (Bundesgesetzblatt, 2007, S. 719) sagen aus, dass Entscheidungen bezüglich der „Anerkennung von Qualifikationen allein auf der Grundlage der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten zu treffen“ (Bundesgesetzblatt, 2007, S. 718) sind. Demnach sind die von Studierenden erworbenen Kompetenzen ausschlaggebend für eine Anerkennung, gleichzeitig spielen der zeitliche Umfang bzw. die Inhalte der Curricula keine entscheidende Rolle (ASIIN e. V, 2011, S. 5). Der Artikel III.2 der Lissabon-Konvention legt fest, dass die Kriterien und Regelungen, die für den Anerkennungsprozess verwendet werden, nachvollziehbar und einheitlich gestaltet sein müssen (Bundesgesetzblatt, 2007, S. 718). Außerdem regelt der Artikel III.3 die Pflichten zur Informationserbringung. Der bzw. die Antragstellende ist verpflichtet, entsprechende Informationen zum bisherigen Studienverlauf zu liefern, während die Hochschule, bei der der Antrag eingegangen ist, ggf. darlegen muss, warum es nicht zu einer Anerkennung kommen kann (Bundesgesetzblatt, 2007, S. 718). Als Voraussetzung zur Prüfung eines solchen Antrages müssen laut Artikel III.4 Informationen zum entsprechenden Bildungssystem vorhanden sein und bereitgestellt werden (Bundesgesetzblatt, 2007, S. 719).
Auf den „Abschnitt V Anerkennung von Studienzeiten Artikel V.1“ (Bundesgesetzblatt, 2007, S. 721) soll ein weiterer Fokus gelegt werden. Demnach werden Studienzeiten anerkannt, „sofern nicht ein wesentlicher Unterschied zwischen den in einer anderen Vertragspartei vollendeten Studienzeiten und dem Teil des Hochschulprogrammes nachgewiesen werden kann“ (Bundesgesetzblatt, 2007, S. 721). Die Lissabon-Konvention zielt also auf einen „wesentlichen Unterschied“ bzgl. der Nicht-Anerkennung von Lernergebnissen.
In Hinblick auf die in Deutschland geltende Normenhierarchie ist die Lissabon-Konvention als übergreifende Regelung zu betrachten, welche die Zulassung zum Studium und die Anerkennung von Studienleistungen im europäischen Hochschulraum definiert sowie entsprechende Grundsätze festlegt.
Hochschulrahmengesetz und Landeshochschulgesetze
Die föderale Struktur des Bildungssystems in Deutschland führt dazu, dass auf Bundesebene ein Hochschulrahmengesetz (HRG, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2017) existiert, welches in sechzehn Landeshochschulgesetzen (Kultusministerium Thüringen 2016; Landtag Bayern 2011; Landtag Brandenburg 2014; Landtag Hessen 2015; Landtag Mecklenburg-Vorpommern 2011; Landtag Niedersachsen 2010; Landtag Saarland 2016; Landtag Sachsen 2013; Landtag Sachsen-Anhalt 2014; Landtag Schleswig-Holstein 2016; Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz 2012; Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 2007; Ministerium für Wissenschaft, Forschung, Kunst Baden-Württemberg 2014; Senatsverwaltung Berlin 2011; Senatsverwaltung Hamburg 2010; Senatorin für Bildung und Wissenschaft Bremen 2010) teils unterschiedlich spezifiziert wird.
Gemäß §20 des Hochschulrahmengesetzes werden „Studien- und Prüfungsleistungen, die an ausländischen Hochschulen erbracht worden sind, […] anerkannt, wenn ihre Gleichwertigkeit festgestellt ist“ (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2017, S. 8). Hierbei wird deutlich, dass von einer Gleichwertigkeit gesprochen wird.
Bezüglich der Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen finden sich auch 2017 im HRG immer noch keinerlei Regelungen. Ebenso wird im HRG bis heute die Lissabon-Konvention nicht präzise berücksichtigt, da das Konzept des „wesentlichen Unterschieds“ der Lissabon-Konvention nicht schlüssig mit dem Konzept der „Gleichwertigkeit“ des HRG verbunden wird bzw. das Konzept der „Gleichwertigkeit“ im Kontext der Anerkennung hochschulisch erworbener Kompetenzen nicht durch das Konzept des „wesentlichen Unterschieds“, wie es die übergeordnete europäischere Regelung (Lissabon-Konvention) vorsieht, ersetzt wird.
Außerhochschulische Kompetenzen im Kontext der Anrechnung und Zulassung
Der Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 28.06.2002 sah Folgendes vor:
Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können im Rahmen einer – ggf. auch pauschalisierten – Einstufung auf ein Hochschulstudium angerechnet werden, wenn
1.1 die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen – ggf. auch über die Möglichkeiten des Hochschulgangs für besonders qualifizierte Berufstätige – gewährleistet werden;
1.2 sie nach Inhalt und Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, der ersetzt werden soll;
1.3 entsprechend den Grundsätzen des neuen Qualitätssicherungssystems im Hochschulbereich die qualitativ inhaltlichen Kriterien für den Ersatz von Studienleistungen durch außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten im Rahmen der Akkreditierung überprüft werden.
Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können höchstens 50 % eines Hochschulstudiums ersetzen.“ (Kultusministerkonferenz, 2002, S. 2)
Während 2002 noch die eher unverbindliche Formulierung „können [Herv. durch die Verf.] höchstens 50 %“ verwendet wird, findet sich in den „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor-und Masterstudiengängen“ aus 2010 eine verbindlichere Formulierung:
„Nachgewiesene gleichwertige Kompetenzen und Fähigkeiten, die außerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden, sind [Herv. durch die Verf.] bis zur Hälfte der für den Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte anzurechnen [Herv. durch die Verf.].“ (Kultusministerkonferenz, 2010, S. 3)
Im Weiteren sind neben den zahlreich geänderten LHGs Akkreditierungsagenturen seit dem 1.1.2015 angehalten, das Fehlen von Regelungen, Kriterien und Verfahren zur Anrechnung von Lernergebnissen in Studiengang-konzepten und Prüfungsordnungen zu beauflagen. Ferner „stellt der Hochschulausschuss der Kultusministerkonferenz klar, dass zur Schließung einer ‚Bachelor-Master-Lücke’ [Anm. durch die Verf.: wg. fehlender ECTS-Punkte] auch die Anrechnung außerhochschulischer Kompetenzen herangezogen werden kann“ (Seger, Waldeyer & Leibinger, 2017, S. 86).
Zu beachten ist außerdem, dass außerhochschulische Lernergebnisse nicht „verbraucht“ werden können: Werden diese z.B. für die Zulassung zu einem Studium verwendet, so können sie bei entsprechender Eignung auch für eine Anrechnung in diesem Studiengang verwendet werden (Kultusministerkonferenz, 2011, S. 4). Es handelt sich hier um eine sehr begrüßenswerte Klarstellung. Schließlich ist das Vermeiden von „Doppellernen“ und insbesondere die Möglichkeit der Anrechnung von außerhochschulischen Lernergebnissen ein zentraler Aspekt hinsichtlich der Entscheidung für ein Studium bei der in aller Regel berufstätigen Zielgruppen, für die ein berufsbegleitendes Studium ohnehin eine hohe Belastung darstellt (vgl. Linke, von Zobeltitz & Klassen, 2017, S. 36ff.).
Implikationen für die Zulassung von PraktikerInnen auf Meisterebene zu Masterprogrammen
Im „Open IT“-Projekt wurde anfangs u.a. ein auf IT-PraktikerInnen mit Fortbildung zum/zur MeisterIn („Operative Professionals“) zugeschnittenes Masterprogramm entwickelt. Vor die eigentliche Masterphase war eine 1-jährige Vorbereitungsphase vorgeschaltet, die als zwingende Zulassungsvoraussetzung galt und keinerlei ECTS-Punkte in den Master einbrachte – so zumindest der Plan. In dieser Phase sollten die IT-MeisterInnen grundlegende Kompetenzen vor allem im wissenschaftlichen Arbeiten und in Mathematik erwerben, die denen eines/einer typischen BachelorabsolventIn entsprechen. Die Masterphase in der ursprünglichen Form hätte berufsbegleitend in 2,5 Jahren absolviert werden können, so dass die IT-MeisterInnen innerhalb von 3,5 Jahren berufsbegleitend den Masterabschluss hätten erreichen können.
Die rechtliche Situation in Niedersachsen, dem Sitzland der HSW, hatte das Projektteam im Vorfeld selbstverständlich auf Kompatibilität mit dem avisierten Studienmodell überprüft. Im damaligen NHG (2014) hieß es in §18, Absatz 8:
"(8) Die Zugangsberechtigung zu weiterführenden Studiengängen und Masterstudiengängen setzt einen Bachelorabschluss oder gleichwertigen Abschluss und eine besondere Eignung voraus."
Da der Wortlaut im Gesetz bzgl. des geforderten Vor-Abschlusses nicht „gleichartig“, sondern lediglich „gleich-wertig“ lautete, sah das Projektteam keine Notwendigkeit eines akademischen Grades: In der von der EU genutzten Einstufung nach dem Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) beinhalten sowohl ein beruflicher Meister als auch ein Bachelor die Stufe 6 und sind als „gleichwertig“ eingestuft. Wegen der „besonderen Eignung“ konzipierte das Projektteam die o.g. 1-jährige Vorbereitungsphase als Tauglichkeitsprüfung durch die Hochschule, in der jedes Modul mit einer zu bestehenden Prüfung validiert hätte werden sollen.